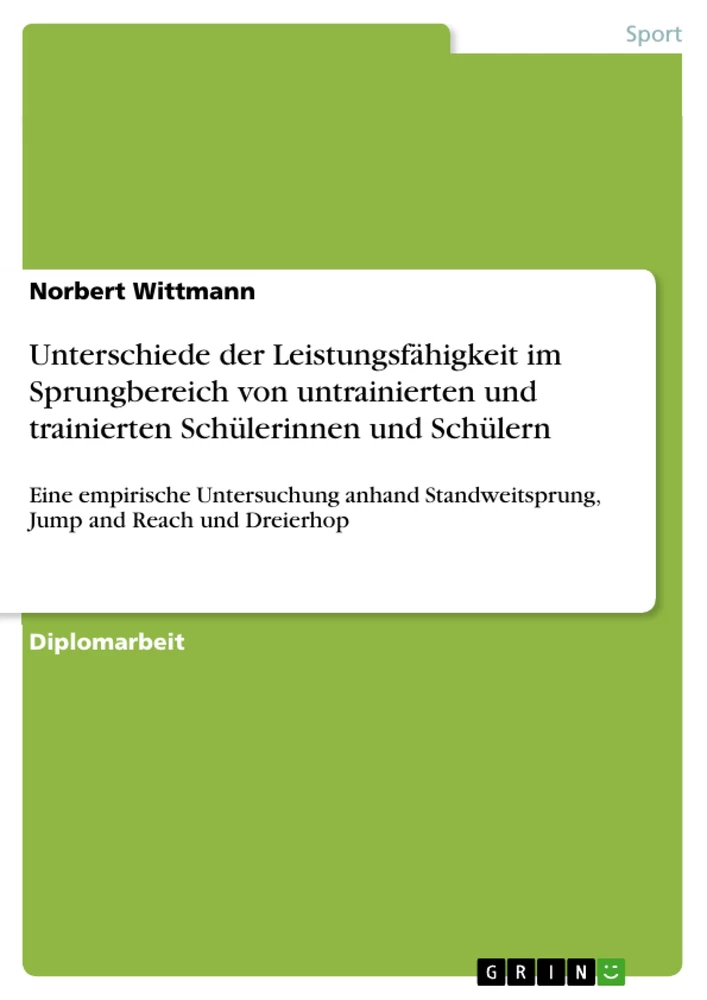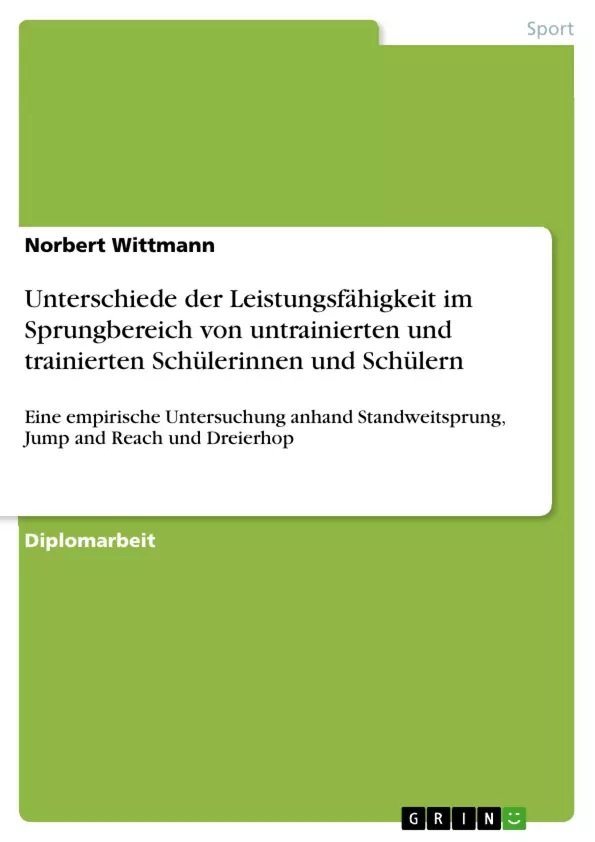In unserer automatisierten, von Technologie überfluteten Welt – eine Welt, welche dieser Entwicklung eine übergeordnete Rolle zukommt lässt - scheint das körperliche Leistungsvermögen nur noch von geringer Bedeutung zu sein. Für die Bewältigung des Berufsalltags ist eine herausragende muskuläre Leistungsfähigkeit keine zwingende Voraussetzung mehr. Unser rapider technischer Fortschritt erlaubt uns, in wenigen Stunden fremde Länder zu erfliegen, Berggipfel ohne große muskuläre Beanspruchung zu erzwingen, die oberste Etage einer Skyline in Sekunden zu erreichen, sowie eine Strecke von A nach B schnellstmöglich zurückzulegen. Durch den allgemeinen Bewegungsmangel – vermindertes sich Bewegen, wie Gehen und Treppensteigen - welcher in den letzten Jahrzehnten aufgrund des technischen Wandels rasant voranschritt, sind die biologischen Gesetzmäßigkeiten vernachlässigt worden. Die adäquaten Reize für die Entwicklung und Erhaltung der Leistungsfähigkeit von Herz, Kreislauf, Atmung und Stoffwechsel sowie die spezielle Leistungsfähigkeit der verschiedenen Muskelgruppen werden auf ein Minimum reduziert.
Vor allem im Kindes- und Jugendalter ist es wichtig die heranreifenden Organe und die Muskulatur förderlich zu entwickeln, um als junger, erwachsener Mensch mit optimaler körperlicher und geistiger Ausstattung dem Leben entgegentreten zu können. Bleiben diese Kraftbeanspruchungen großer Muskelgruppen aufgrund des Bewegungsmangels über längere Zeit unterhalb einer bestimmten Reizschwelle, so entstehen Funktions- und Leistungsverluste (vgl. Hollmann/ Hettinger 2000, 7F).
Neben dem technischen Wandel trägt die Situation des Sportunterrichtes im erheblichen Maße an der Verschlechterung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei. Der Beschluss der Bayerischen Staatsregierung im Jahr 1996 hat zur Folge, dass von zwei Stunden wöchentlichem Basissportunterricht und zwei Stunden differenzierter Sportunterricht nur 18 % an Hauptschulen, 9,5 %, an Realschulen, 32,5 % an Gymnasien und 77,5 % an Wirtschaftsschulen der vorgeschrieben Sollstunden abgehalten werden (Stand: Mai 1999). Weiterhin ist an berufsbildenden Schulen die Schulsportsituation äußerst bedenklich. Nur etwa eine Sportstunde ist in der Stundentafel pro Woche verankert welche nur zu 77,4 % abgehalten wird.[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Situationsbeschreibung
- 2. Ziel der Arbeit
- 3. Aufbau der Arbeit
- II. Theoretische Grundlagen
- 1. Psychophysische Kurzcharakterisierung der getesteten Altersstufen
- 1.1 SPÄTES SCHULKINDALTER
- 1.2 ERSTE PUBERALE PHASE
- 1.3 ZWEITE PUBERALE PHASE
- 2. Anthropometrische Entwicklung im Kindes- und Jugendalter
- 2.1 KÖRPERGRÖßE
- 2.2 KÖRPERGEWICHT
- 2.3 BODY-MASS-INDEX
- 2.4 BEWEGUNGSAPPARAT
- 2.4.1 AKTIVER BEWEGUNGSAPPARAT
- 2.4.2 PASSIVER BEWEGUNGSAPPARAT
- 2.5 KÖRPERFETT
- 3. Faktoren, welche die Sprungkraft beeinflussen
- 3.1 AUS ANTHROPOMETRISCHER SICHT
- 3.1.1 KÖRPERGRÖßE
- 3.1.2 KÖRPERGEWICHT
- 3.2 ÜBERSICHT DER FAKTOREN DER SPORTLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT
- 3.2.1 KONDITION
- 3.2.1.1 Kraft
- 3.2.1.1.1 Maximalkraft
- 3.2.1.1.2 Schnellkraft
- 3.2.1.2 Schnelligkeit
- 3.2.2 DIE KOORDINATION
- 3.3 MOTIVATION
- 4. Sprungkraftentwicklung im Kindes- und Jugendalter in den Kategorien Standweitsprung, Jump and Reach und Dreierhop
- 4.1 IM SPÄTEN SCHULKINDALTER
- 4.2 ERSTE PUBERALE PHASE
- 4.3 ZWEITE PUBERALE PHASE
- III. Empirische Untersuchung
- 1. Zielsetzung der Arbeit und Formulierung der Hypothesen
- 2. Untersuchungsmethodik
- 2.1 VERSUCHSANORDNUNG
- 2.2 STICHPROBENBESCHREIBUNG
- 2.3 GERÄTEBESCHREIBUNG
- 2.3.1 HOCHSPRUNGSTÄNDER
- 2.3.2 BIOIMPEDENZWAAGE
- 2.3.3 MAGNESIUMCARBONAT
- 2.3.4 SCHULTURNMATTEN
- 2.3.5 WEITSPRUNGANLAGE
- 2.4 Testbeschreibung
- 2.4.1 TESTARTEN
- 2.4.1.1 Standweitsprung
- 2.4.1.2 Jump and Reach
- 2.4.1.3 Dreierhop
- 2.5 ORT DER UNTERSUCHUNG
- 2.6 ABLAUF DER UNTERSUCHUNG
- 2.6.1 ERHEBUNGSBOGEN
- 2.6.2 AUFWÄRMEN
- 2.6.3 TESTREIHENFOLGE
- 2.7 TESTGÜTEKRITERIEN
- 2.7.1 HAUPTGÜTEKRITERIEN
- 2.7.1.1 Objektivität (Genauigkeit)
- 2.7.1.2 Reliabilität (Zuverlässigkeit)
- 2.7.1.3 Validität (Gültigkeit)
- 2.7.2 NEBENGÜTEKRITERIEN
- 2.8 STATISTISCHE AUSWERTUNG
- 2.8.1 DESKRIPTIVE STATISTIK
- 2.8.1.1 Maße der zentralen Tendenz
- 2.8.1.1.1 Arithmetische Mittel
- 2.8.1.1.2 Median
- 2.8.1.2 Streuungsmaße
- 2.8.1.2.1 Standardabweichung
- 2.8.1.2.2 Varianz
- 2.8.2 KOMPARATIVE STATISTIK
- 3. Darstellung der Ergebnisse
- 3.1 HYPOTHESE 1
- 3.1.1 ERGEBNISSE DER HYPOTHESE 1
- 3.1.1.1 Anthropometrische Messergebnisse
- 3.1.1.1.1 Mädchen
- 3.1.1.1.1.1 Körpergröße
- 3.1.1.1.1.2 Körpergewicht
- 3.1.1.1.1.3 BMI
- 3.1.1.1.1.4 Körperfett
- 3.1.1.1.2 Jungen
- 3.1.1.1.2.1 Körpergröße
- 3.1.1.1.2.2 Körpergewicht
- 3.1.1.1.2.3 BMI
- 3.1.1.1.2.4 Körperfett
- 3.1.1.2 Sportmotorische Messergebnisse
- 3.1.1.2.1 Nicht Sport treibende Schülerinnen
- 3.1.1.2.1.1 Standweitsprung
- 3.1.1.2.1.2 Jump and Reach
- 3.1.1.2.1.3 Dreierhop
- 3.1.1.2.2 Sporttreibende Schülerinnen
- 3.1.1.2.2.1 Standweitsprung
- 3.1.1.2.2.2 Jump and Reach
- 3.1.1.2.2.3 Dreierhop
- 3.1.1.2.3 Nicht Sport treibende Schüler
- 3.1.1.2.3.1 Standweitsprung
- 3.1.1.2.3.2 Jump and Reach
- 3.1.1.2.3.3 Dreierhop
- 3.1.1.2.4 Sporttreibende Schüler
- 3.1.1.2.4.1 Standweitsprung
- 3.1.1.2.4.2 Jump and Reach
- 3.1.1.2.4.3 Dreierhop
- 3.2 HYPOTHESE 2
- 3.2.1 ERGEBNISSE DER HYPOTHESE 2
- 3.2.1.1 Anthropometrische Messergebnisse - LeichtathletInnen
- 3.2.1.1.1 Mädchen
- 3.2.1.1.1.1 Körpergröße
- 3.2.1.1.1.2 Körpergewicht
- Einfluss des Trainings auf die Sprungkraft
- Zusammenhang zwischen Alter und Sprungleistung
- Anthropometrische Unterschiede zwischen den Gruppen
- Analyse der sportmotorischen Fähigkeiten im Sprungbereich
- Entwicklung der Sprungkraft im Kindes- und Jugendalter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede in der sportlichen Leistungsfähigkeit im Sprungbereich (Standweitsprung, Jump and Reach, Dreierhop) zwischen trainierten und untrainierten Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 10 und 19 Jahren. Ziel ist es, den Einfluss von Training und Alter auf die Sprungkraft zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Ausgangssituation und formuliert das Ziel der Arbeit. Es wird der Aufbau der Arbeit erläutert und der Leser auf die folgenden Kapitel vorbereitet. Die Einleitung stellt den Rahmen für die gesamte Untersuchung dar und liefert die notwendigen Hintergrundinformationen.
II. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Untersuchung dar. Es beschreibt die psychophysischen Charakteristika der verschiedenen Altersstufen (spätes Schulkindalter, erste und zweite puberale Phase) und beleuchtet die anthropometrische Entwicklung im Kindes- und Jugendalter (Körpergröße, Körpergewicht, BMI, Körperfett, sowie den aktiven und passiven Bewegungsapparat). Es werden zudem Faktoren analysiert, die die Sprungkraft beeinflussen, sowohl aus anthropometrischer Sicht (Körpergröße und Körpergewicht) als auch im Hinblick auf Kondition (Kraft, Schnelligkeit), Koordination und Motivation. Zusammenfassend bildet dieses Kapitel die theoretische Basis für die Interpretation der empirischen Ergebnisse.
III. Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es werden die Zielsetzung, die Hypothesen, die Versuchsanordnung, die Stichprobenbeschreibung, die Gerätebeschreibung, die Testbeschreibung, der Ablauf der Untersuchung, die Testgütekriterien und die statistische Auswertung detailliert dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der präzisen Beschreibung der methodischen Vorgehensweise, um die Reproduzierbarkeit der Studie zu gewährleisten. Das Kapitel dient als methodische Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse und deren Validität.
Schlüsselwörter
Sprungkraft, Standweitsprung, Jump and Reach, Dreierhop, trainiert, untrainiert, Schülerinnen, Schüler, Kindesalter, Jugendalter, Anthropometrie, Körpergröße, Körpergewicht, BMI, Körperfett, Kondition, Koordination, Motivation, empirische Untersuchung, statistische Auswertung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Sprungkraftentwicklung im Kindes- und Jugendalter
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Unterschiede in der sportlichen Leistungsfähigkeit im Sprungbereich (Standweitsprung, Jump and Reach, Dreierhop) zwischen trainierten und untrainierten Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 10 und 19 Jahren. Der Fokus liegt auf dem Einfluss von Training und Alter auf die Sprungkraft.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Einfluss des Trainings auf die Sprungkraft, den Zusammenhang zwischen Alter und Sprungleistung, anthropometrische Unterschiede zwischen den Gruppen und die sportmotorischen Fähigkeiten im Sprungbereich. Ein weiteres Ziel ist die Darstellung der Sprungkraftentwicklung im Kindes- und Jugendalter.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die psychophysischen Charakteristika verschiedener Altersstufen (spätes Schulkindalter, erste und zweite Pubertätsphase) und die anthropometrische Entwicklung (Körpergröße, Körpergewicht, BMI, Körperfett, Bewegungsapparat). Zusätzlich werden Faktoren wie Kondition (Kraft, Schnelligkeit), Koordination und Motivation im Zusammenhang mit der Sprungkraft beleuchtet.
Welche Methoden wurden in der empirischen Untersuchung angewendet?
Die empirische Untersuchung beschreibt die Methodik detailliert, inklusive Zielsetzung, Hypothesen, Versuchsanordnung, Stichprobenbeschreibung, Gerätebeschreibung (Hochsprungständer, Bioimpedanzwaage, Magnesiumcarbonat, Schulmatten, Weitsprunganlage), Testbeschreibung (Standweitsprung, Jump and Reach, Dreierhop), Ablauf der Untersuchung, Testgütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) und statistische Auswertung (deskriptive und komparative Statistik).
Welche Tests wurden durchgeführt?
Es wurden drei Sprungtests durchgeführt: Standweitsprung, Jump and Reach und Dreierhop. Diese Tests dienten zur Messung der Sprungkraft bei den Teilnehmern.
Welche Altersgruppen wurden untersucht?
Die Studie umfasste Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 10 und 19 Jahren, aufgeteilt in spätes Schulkindalter, erste und zweite puberale Phase.
Wie wurden die Daten ausgewertet?
Die Daten wurden sowohl deskriptiv (Maße der zentralen Tendenz wie arithmetisches Mittel und Median, Streuungsmaße wie Standardabweichung und Varianz) als auch komparativ statistisch ausgewertet.
Welche Ergebnisse wurden erzielt (im Überblick)?
Die Ergebnisse werden für Hypothese 1 (Einfluss von Training und Alter auf die Sprungkraft) und Hypothese 2 (Vergleich der anthropometrischen Daten von Leichtathleten) getrennt dargestellt. Sie beinhalten anthropometrische (Körpergröße, Körpergewicht, BMI, Körperfett) und sportmotorische Messergebnisse (Standweitsprung, Jump and Reach, Dreierhop) für Mädchen und Jungen, getrennt nach trainierten und untrainierten Gruppen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprungkraft, Standweitsprung, Jump and Reach, Dreierhop, trainiert, untrainiert, Schülerinnen, Schüler, Kindesalter, Jugendalter, Anthropometrie, Körpergröße, Körpergewicht, BMI, Körperfett, Kondition, Koordination, Motivation, empirische Untersuchung, statistische Auswertung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Einleitung (Situationsbeschreibung, Ziel der Arbeit, Aufbau), Theoretische Grundlagen (Psychophysische Kurzcharakterisierung der Altersstufen, Anthropometrische Entwicklung, Einflussfaktoren auf die Sprungkraft, Sprungkraftentwicklung im Kindes- und Jugendalter) und Empirische Untersuchung (Zielsetzung, Methodik, Ergebnisse).
- Citar trabajo
- Diplom Handelslehrer Norbert Wittmann (Autor), 2007, Unterschiede der Leistungsfähigkeit im Sprungbereich von untrainierten und trainierten Schülerinnen und Schülern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113927