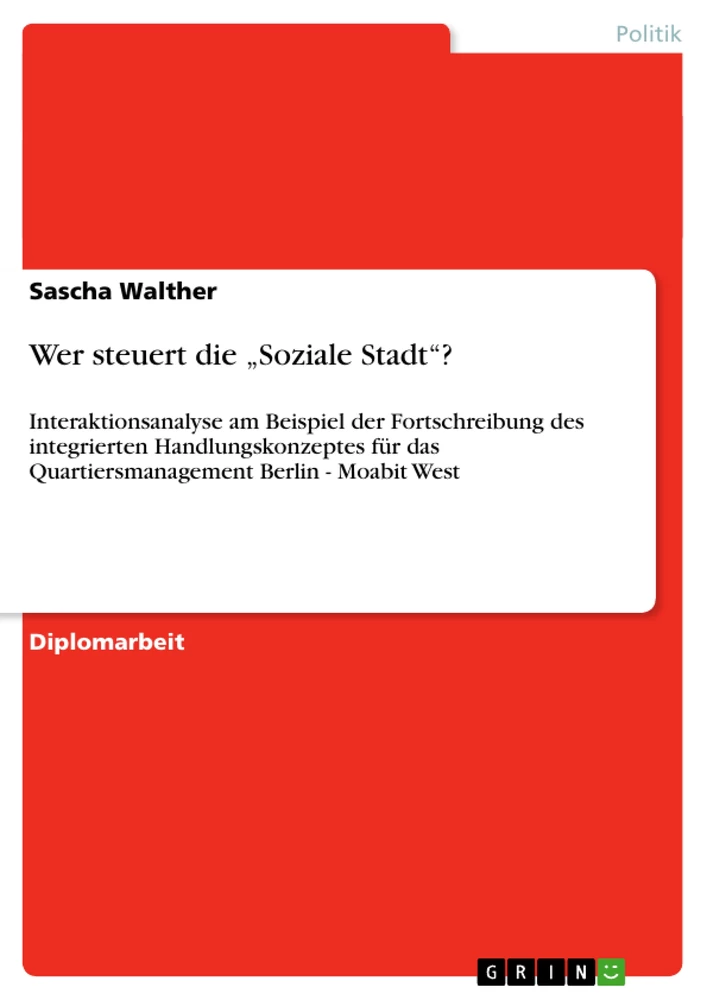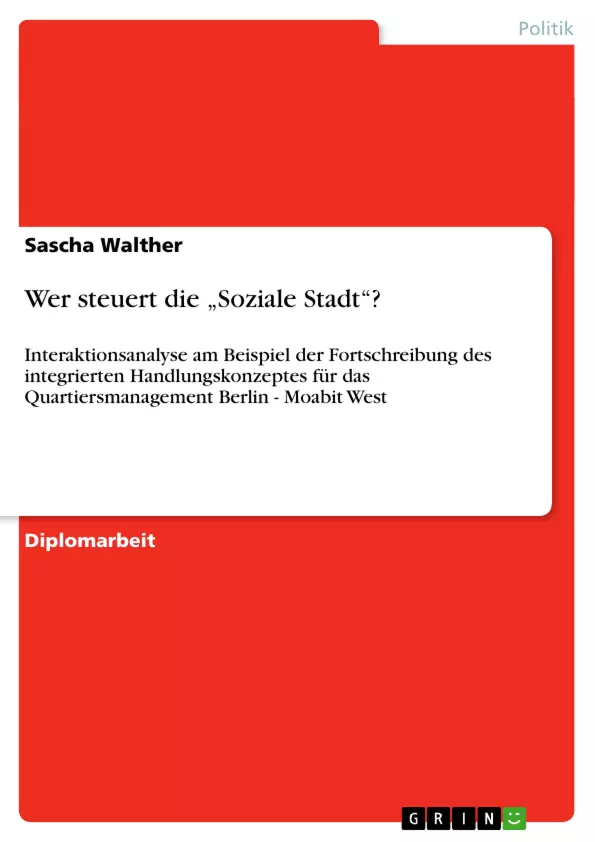Beschleunigt durch die in den 80er Jahren rapide zunehmende Massenarbeitslosigkeit, welche sich zunehmend in bestimmten innerstädtischen Strukturen räumlich konzentrierte, entwickelten sich einhergehend mit einer anhaltend hohen Zuwanderung von Ausländern und den damit daraus resultierenden ethnisch-kulturellen Spannungen und Abschottungtendenzen zwischen den Bevölkerungsgruppen Segregationstendenzen, die eine immer brisanter werdende soziale und politische Lage in den großen Städten provozierten.
Der Terminus sozialräumliche Segregation umschreibt, dass sich soziale Gruppen nicht gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilen, sondern sich in bestimmten Stadtteilen konzentrieren. Der Sozialraum der Stadt lässt sich somit „als eine Landkarte lesen, auf der die Sozialstruktur der Gesellschaft verzeichnet ist“ (Häußermann/Siebel 2001, S. 70). Segregation beschreibt in der Stadtforschung daher ein Gerechtigkeits- und Integrationsproblem, da die sozialen Strukturen und die ethnisch-kulturelle Herkunft unmittelbar in räumliche Strukturen überführt werden. In baulich benachteiligten und unattraktiven Gebieten konzentrieren sich Verlierer der gesellschaftlichen Modernisierung (z.B. Arbeitslose, Ausländer), während in den Innenstadtgebieten mit gut ausgebauter Infrastruktur und hoher Lebensqualität die Gewinner der Modernisierung leben. Insofern sind Stadtgebiete, die durch Segregation gekennzeichnet sind, solche, in denen die Durchmischung der sozialen Gruppen nur gering ist und sich im gesamtstädtischen Aspekt eher ein Nebeneinander als ein Miteinander der verschiedenen Bevölkerungsschichten zeigt (ebd., S. 70ff.).
Das politische Bewusstsein für die Wichtigkeit einer sozialen Stadtentwicklung bildete sich mit diesem tief greifenden Wandel der Sozial- und Bevölkerungsstruktur in Deutschland heraus und führte zu einem tendenziellen Wandel der Methodik in der Stadterneuerungpolitik. Stadterneuerungsprozesse zielten bis dato primär auf die baulich-investive Beseitigung von Struktur- und Funktionsschwächen in betroffenen Stadtgebieten ab und wurden untersetzt durch das in § 136 BauGB verankerte Ziel der sozialen Stabilisierung.
Inhaltsverzeichnis
- VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN
- LESEHINWEISE
- VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
- 1 EINFÜHRUNG
- 1.1 STADTENTWICKLUNGSTENDENZEN SEIT DEN 60ER JAHREN
- 1.2 DIE SOZIALE STADT ALS „, MAẞSTAB UND PRAXISTEST"
- 1.2.1 GRUNDLEGENDE FAKTEN ZUM BUND-LÄNDER-PROGRAMM SOZIALE STADT
- 1.2.2 PROGRAMMZIELE DER SOZIALEN STADT
- 1.3 INTEGRIERTE HANDLUNGSKONZEPTE ALS ZENTRALE STEUERUNGSINSTRUMENTE
- 1.4 AUFTRAG DER DIPLOMARBEIT
- 1.5 AUFBAU DER DIPLOMARBEIT
- 2 METHODISCHE ASPEKTE: AKTEURSZENTRIERTER INSTITUTIONALISMUS ALS ANALYSEANSATZ
- 2.1 GRUNDANNAHMEN DES AKTEURSZENTRIERTEN INSTITUTIONALISMUS
- 2.2 UNTERSUCHUNGSDESIGN
- 2.2.1 GRUNDLEGENDE ANMERKUNGEN ZUM UNTERSUCHUNGSDESIGN
- 2.2.2 ANALYSEBESTANDTEILE DES AKTEURSZENTRIERTEN INSTITUTIONALISMUS
- 2.2.2.1 Probleme und Gegebenheiten
- 2.2.2.2 Institutioneller Kontext
- 2.2.2.3 Akteursanalyse
- 2.2.2.4 Akteurskonstellation
- 2.2.2.5 Interaktionsformen
- 2.3 UNTERSUCHUNGSINSTRUMENTE
- 2.3.1 DOKUMENTENANALYSE
- 2.3.2 LEITFADENINTERVIEWS
- 3 DAS INNOVATIVE STEUERUNGSMODELL DER SOZIALEN STADT
- 3.1 DER FORMWANDEL VON POLITIK: VON AUTORITÄRER STAATLICHER STEUERUNG ZUM KOOPERATIV-AKTIVIERENDEN STAAT
- 3.2 ,,GOVERNANCE" ALS INTERAKTIONSHANDELN
- 3.3 INNOVATIVE ELEMENTE DES STEUERUNGSMODELLS DER SOZIALEN STADT
- 3.3.1 REAKTION AUF REGULATIVE POLITIK ALS ÜBERKOMMENES STEUERUNGSMODELL
- 3.3.2 SCHLÜSSELFUNKTION DER LOKALEN AKTEURE
- 3.3.3 POLITIKVERFLECHTUNG
- 3.3.4 STEUERUNGSTYPEN
- 3.3.5 ZUR STEUERUNGSFUNKTION DER ZIELSTRUKTUR
- 3.3.6 STEUERUNGSNETZ STATT STEUERUNGSKETTE
- 3.4 ZENTRALE STEUERUNGSZIELE BEI DER HANDLUNGSKONZEPTFORTSCHREIBUNG
- 3.4.1 VERWALTUNGSINTERNE KOORDINATION
- 3.4.1.1 Grundaussagen zu dem Steuerungsziel
- 3.4.1.2 Thesen und Fallstricke zu dem Steuerungsziel
- 3.4.2 VERTIKALE KOOPERATION
- 3.4.2.1 Grundaussagen zu dem Steuerungsziel
- 3.4.2.2 Thesen und Fallstricke zu dem Steuerungsziel
- 3.4.3 BÜRGERMITWIRKUNG
- 3.4.3.1 Grundaussagen zu dem Steuerungsziel
- 3.4.3.2 Thesen und Fallstricke zu dem Steuerungsziel
- 3.4.1 VERWALTUNGSINTERNE KOORDINATION
- 4 HANDLUNGSKONZEPTE ALS ZENTRALE STEUERUNGS- UND KOORDINIERUNGSINSTRUMENTE
- 4.1 DARSTELLUNG DES STEUERUNGSVERFAHRENS SOZIALE STADT/QM UND AUSSAGEN ZU HANDLUNGSKONZEPTEN IN ZENTRALEN STEUERUNGSDOKUMENTEN
- 4.1.1 STEUERUNG AUF BUND-LÄNDER-EBENE
- 4.1.1.1 Der ARGEBAU-Leitfaden
- 4.1.1.2 § 171e Baugesetzbuch
- 4.1.1.3 Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung
- 4.1.2 STEUERUNG AUF BERLINER LANDESEBENE
- 4.1.2.1 Der Senatsbeschluss über die Einrichtung integrierter Stadtteilverfahren
- 4.1.2.2 Der Zwischenbericht des Senats zu Erfahrungen mit dem Quartiersmanagement
- 4.1.2.3 Die Verwaltungsvorschrift Soziale Stadt (W SozStadt)
- 4.1.2.4 Die Verwaltungsvorschrift Zukunftsinitiative Stadtteil (VV ZIS)
- 4.1.3 STEUERUNG AUF BEZIRKSEBENE BERLIN-MITTE
- 4.1.3.1 Aussagen zu Handlungskonzepten in der Kooperationsvereinbarung
- 4.1.3.2 Formales Steuerungsverfahren der Handlungskonzeptfortschreibung
- 4.1.1 STEUERUNG AUF BUND-LÄNDER-EBENE
- 4.2 ZUSAMMENFASSUNG: ALLGEMEINE VORGABEN AUF BUND-LÄNDER-EBENE, KONKRETE REGELUNGEN AUF UMSETZUNGSEBENE
- 4.1 DARSTELLUNG DES STEUERUNGSVERFAHRENS SOZIALE STADT/QM UND AUSSAGEN ZU HANDLUNGSKONZEPTEN IN ZENTRALEN STEUERUNGSDOKUMENTEN
- 5 INTERAKTIONSANALYSE AM BEISPIEL DER FORTSCHREIBUNG DES INTEGRIERTEN HANDLUNGSKONZEPTES MOABIT WEST
- 5.1 GEBIETSCHARAKTERISTIK
- 5.1.1 BAULICHE UND SOZIALE STRUKTUR VON MOABIT SEIT DER INDUSTRIALISIERUNG
- 5.1.2 STADTRÄUMLICHE LAGE
- 5.1.3 STRUKTURDATEN
- 5.1.4 STRUKTUR- UND FUNKTIONSMÄNGEL
- 5.1.5 POTENZIALE
- 5.1.6 KLASSIFIKATION ALS SANIERUNGS- UND QM-GEBIET
- 5.2 STRUKTURANALYSE DER HANDLUNGSKONZEPTE 2000-2006
- 5.2.1 1999 BIS 2002 - LOCKERE FORTSCHREIBUNG
- 5.2.2 2003 BIS 2006 - VEREINHEITLICHTE, PROFESSIONALISIERTE BERICHTSFORM
- 5.2.3 AUSBLICK: NEUAUSRICHTUNG DER HANDLUNGSKONZEPTE AB 2008
- 5.3 AKTEURSANALYSE
- 5.3.1 QUARTIERSRAT
- 5.1 GEBIETSCHARAKTERISTIK
- 6 INTERAKTIONSMUSTER
- 6.1 INTERAKTIONSMUSTER IM STEUERUNGSPROZESS
- 6.2 INTERAKTIONSMUSTER IM QM-PROZESS
- 6.3 INTERAKTIONSMUSTER IM HANDLUNGSKONZEPTFORTSCHREIBUNGSPROZESS
- 7 FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
- ANHANG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Steuerung des Programms „Soziale Stadt" am Beispiel der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes für das Quartiersmanagement Berlin-Moabit West. Ziel ist es, die Interaktionen der beteiligten Akteure im Steuerungs- und Umsetzungsprozess zu analysieren und die Steuerungseffizienz des Programms zu bewerten.
- Steuerung des Programms „Soziale Stadt" und die Rolle der Akteure
- Interaktionsmuster im Steuerungs- und Umsetzungsprozess
- Bewertung der Steuerungseffizienz des Programms
- Analyse des integrierten Handlungskonzeptes für das Quartiersmanagement Berlin-Moabit West
- Bedeutung von Bürgerbeteiligung und Kooperation im Rahmen des Programms „Soziale Stadt"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Stadtentwicklung und die Entstehung des Programms „Soziale Stadt". Es werden die grundlegenden Fakten zum Programm, die Programmziele und die Bedeutung integrierter Handlungskonzepte erläutert. Anschließend wird der methodische Ansatz der Arbeit, der akteurszentrierte Institutionalismus, vorgestellt.
Im dritten Kapitel wird das innovative Steuerungsmodell der „Sozialen Stadt" analysiert. Es werden die zentralen Steuerungsziele und die Herausforderungen bei der Umsetzung des Programms beleuchtet.
Kapitel 4 befasst sich mit den Handlungskonzepten als zentrale Steuerungs- und Koordinierungsinstrumente. Es werden die Steuerungsvorgaben auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene dargestellt und die Bedeutung von Handlungskonzepten im Steuerungsverfahren erläutert.
Im fünften Kapitel erfolgt eine Interaktionsanalyse am Beispiel der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes Moabit West. Es werden die Gebietscharakteristik, die Strukturanalyse der Handlungskonzepte und die Akteure im Steuerungs- und Umsetzungsprozess vorgestellt.
Das sechste Kapitel analysiert die Interaktionsmuster im Steuerungs- und Umsetzungsprozess. Es werden die Interaktionsmuster im Steuerungs-, QM- und Handlungskonzeptfortschreibungsprozess untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die „Soziale Stadt", Quartiersmanagement, integrierte Handlungskonzepte, Steuerung, Interaktion, Akteure, Bürgerbeteiligung, Kooperation, Moabit West, Berlin, Stadtentwicklung, Governance, akteurszentrierter Institutionalismus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Programms „Soziale Stadt“?
Das Ziel ist die Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen mit besonderen sozialen und baulichen Herausforderungen, um Segregation entgegenzuwirken.
Was bedeutet „sozialräumliche Segregation“?
Es beschreibt die ungleiche Verteilung sozialer Gruppen über das Stadtgebiet, was oft zu einer Konzentration von Benachteiligten in bestimmten Quartieren führt.
Welche Rolle spielt das Quartiersmanagement?
Das Quartiersmanagement fungiert als Steuerungsinstrument vor Ort, um lokale Akteure zu vernetzen, Bürger zu beteiligen und integrierte Handlungskonzepte umzusetzen.
Wie funktioniert die Steuerung in der „Sozialen Stadt“?
Die Steuerung erfolgt kooperativ durch ein Netzwerk aus Verwaltung, Politik und Bürgern, statt durch eine rein hierarchische staatliche Lenkung (Governance-Ansatz).
Warum ist Bürgerbeteiligung in diesem Programm so wichtig?
Bürgermitwirkung sichert die Akzeptanz von Maßnahmen und nutzt das lokale Wissen der Bewohner, um nachhaltige Verbesserungen im Kiez zu erreichen.
- Citation du texte
- Sascha Walther (Auteur), 2008, Wer steuert die „Soziale Stadt“?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113930