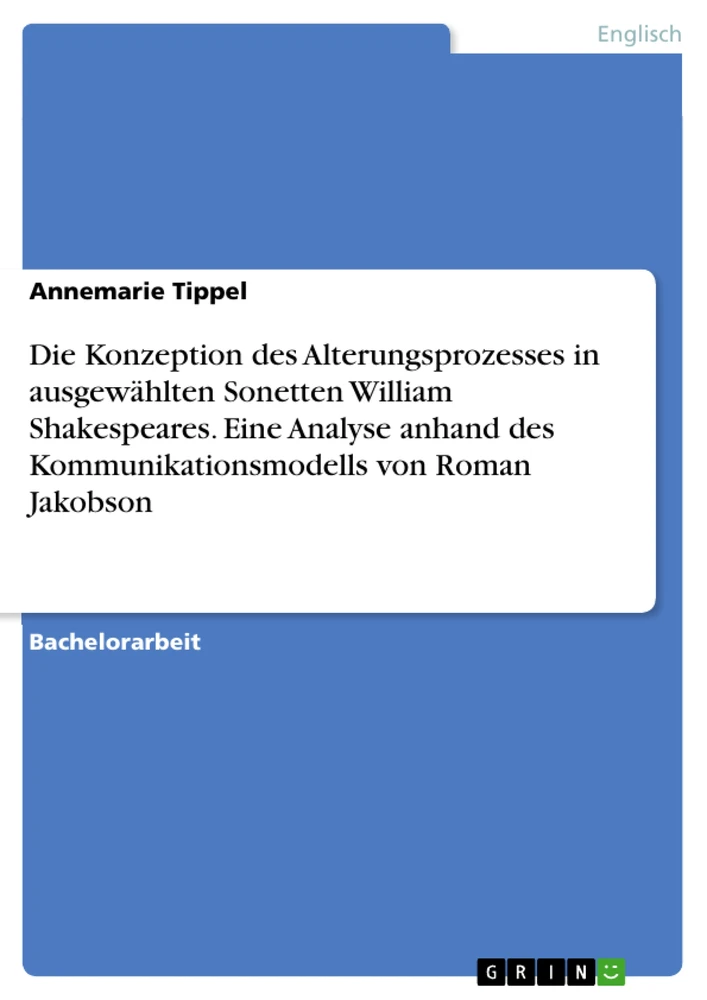Diese Arbeit beschäftigt sich mit den von William Shakespeare geschriebenen Sonetten. Eine Analyse aller Sonette wäre sehr umfangreich und würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher wurden fünf thematisch relevante Sonette für die Analyse ausgesucht. Die Sonette sind jeweils 14-zeilig, was sie zu kompakten Einzelsonetten macht. Die Feststellung, weshalb sich der Dramatiker Shakespeare nach der eigentlichen Epoche der Sonettschreiberei in England mit der Sonettdichtung befasst hat, wird im Laufe der Arbeit erläutert.
Sonette bekamen ursprünglich die Intention zugeschrieben, die dem Empfänger gewidmete Liebe in Worten zu verkünden. Daher wird in vielen Analysen der Schwerpunkt auf Liebe und Schönheit gelegt.
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Konzeption des Alterungsprozesses. Somit spielen vor allem die Vergänglichkeit und der Tod (Endlichkeit) eine wichtige Rolle in den folgenden Abschnitten. Um die Relevanz dieser Endlichkeitsgedanken in den Sonetten William Shakespeares zu rechtfertigen, wird ein kleiner Einblick in die Geschichte Englands gegeben. Das Elisabethanische Zeitalter, in dem die Sonette von Shakespeare verfasst wurden, war eben auch von einer so genannten Endzeitstimmung geprägt. Dadurch waren die Dichter* dieser Zeit mit den Leitbildern des Todes konfrontiert, umgeben und vertraut. Was genau man unter dem Tod und den damit verbundenen Emotionen versteht, wird im Weiteren erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE GESCHICHTE DES SONETTS - HISTORISCHER HINTERGRUND
- Sonette von Petrarca
- Sonette in England
- William Shakespeares Sonette
- ELISABETHANISCHES ENGLAND - ENDZEITSTIMMUNG
- DAS BILD VOM TOD
- Unsterblichkeit
- Memento mori und Carpe Diem
- Die Aufgabe von Naturmetaphern
- ROMAN JAKOBSON
- Kommunikationsmodell
- Die Faktoren
- Die Funktionen
- ANALYSE AUSGEWÄHLTER SONETTE
- Sonett 5
- Inhaltliche Analyse
- Konzeption des Alterungsprozesses
- Sonett 18
- Inhaltliche Analyse
- Konzeption des Alterungsprozesses
- Sonett 73
- Inhaltliche Analyse
- Konzeption des Alterungsprozesses
- Sonett 55
- Inhaltliche Analyse
- Konzeption des Alterungsprozesses
- Sonett 130
- Inhaltliche Analyse
- Konzeption des Alterungsprozesses
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Konzeption des Alterungsprozesses in ausgewählten Sonetten William Shakespeares, wobei das Kommunikationsmodell von Roman Jakobson als analytisches Instrument dient. Die Arbeit soll die Bedeutung von Vergänglichkeit und Tod in Shakespeares Sonetten aufzeigen und die Rolle des Elisabethanischen Zeitalters, das von einer Endzeitstimmung geprägt war, beleuchten.
- Die Konzeption des Alterungsprozesses in ausgewählten Sonetten William Shakespeares
- Der Einfluss des Elisabethanischen Zeitalters und die Endzeitstimmung auf Shakespeares Sonette
- Die Rolle von Vergänglichkeit und Tod als zentrale Motive
- Die Anwendung des Kommunikationsmodells von Roman Jakobson zur Analyse der Sonette
- Die stilistische Umsetzung der Themen in den Sonetten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die relevanten Sonette William Shakespeares vor. Kapitel 2 widmet sich der Geschichte des Sonetts, beginnend mit den Sonetten von Petrarca, der ersten Entwicklung in England und Shakespeares Sonetten. Kapitel 3 beleuchtet das Elisabethanische Zeitalter und seine Endzeitstimmung als historischer Hintergrund für Shakespeares Werk. Kapitel 4 analysiert das Bild vom Tod in Shakespeares Sonetten, einschließlich Unsterblichkeit, Memento mori und Carpe Diem. Kapitel 5 stellt das Kommunikationsmodell von Roman Jakobson vor und erläutert seine Bedeutung für die Analyse der Sonette. Die Kapitel 6.1 bis 6.5 analysieren fünf ausgewählte Sonette (Nr. 5, 18, 55, 73 und 130) hinsichtlich ihrer inhaltlichen Gestaltung und der Konzeption des Alterungsprozesses. Das Fazit zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse und fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Schlüsselwörter
William Shakespeare, Sonett, Alterungsprozess, Vergänglichkeit, Tod, Endzeitstimmung, Elisabethanisches Zeitalter, Kommunikation, Roman Jakobson, Kommunikationsmodell, Inhaltliche Analyse, Stilistische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Alterungsprozess in Shakespeares Sonetten dargestellt?
Shakespeare thematisiert das Altern als unaufhaltsamen Verfall und setzt ihm die Unsterblichkeit durch die Dichtung und die Naturmetaphorik entgegen.
Welches Analysemodell wird in der Arbeit verwendet?
Die Analyse erfolgt auf Basis des Kommunikationsmodells von Roman Jakobson, um die Funktionen und Faktoren der dichterischen Sprache zu untersuchen.
Welche Rolle spielt die "Endzeitstimmung" des Elisabethanischen Zeitalters?
Das Zeitalter war von Vergänglichkeitsgedanken und Memento-mori-Motiven geprägt, was sich in der düsteren und reflektierten Darstellung von Tod und Zeit in den Sonetten widerspiegelt.
Welche Sonette werden im Detail analysiert?
Die Arbeit untersucht die Sonette 5, 18, 55, 73 und 130 hinsichtlich ihrer inhaltlichen und stilistischen Gestaltung.
Was bedeuten "Memento mori" und "Carpe diem" in diesem Kontext?
Diese Leitbilder stehen für das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit und den Versuch, die Schönheit des Augenblicks in der Kunst festzuhalten.
- Quote paper
- Annemarie Tippel (Author), 2020, Die Konzeption des Alterungsprozesses in ausgewählten Sonetten William Shakespeares. Eine Analyse anhand des Kommunikationsmodells von Roman Jakobson, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1140009