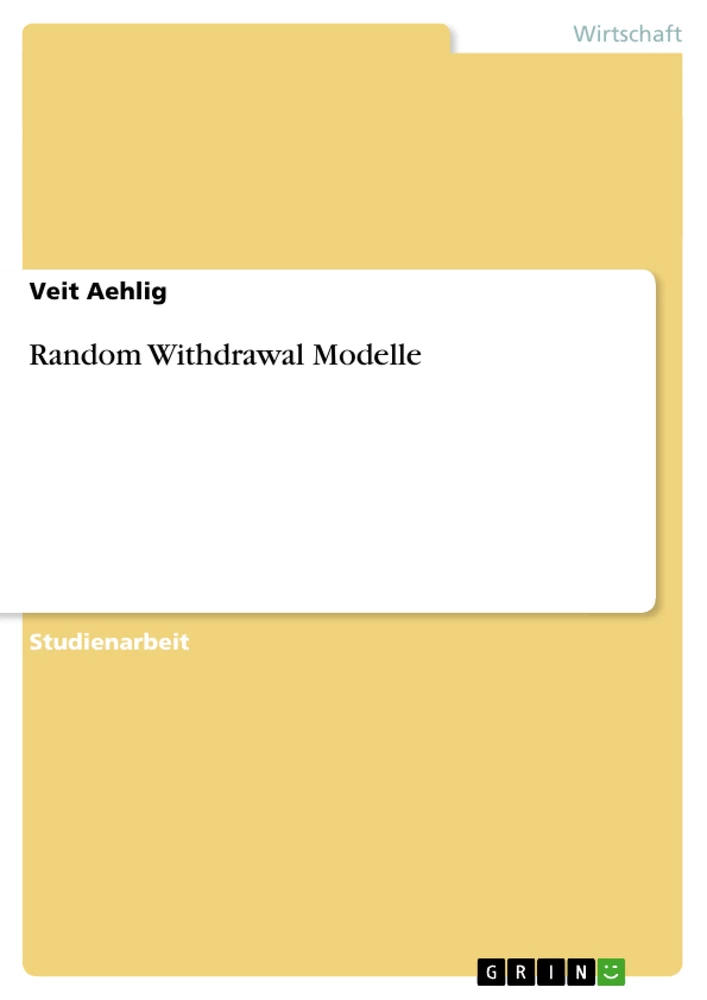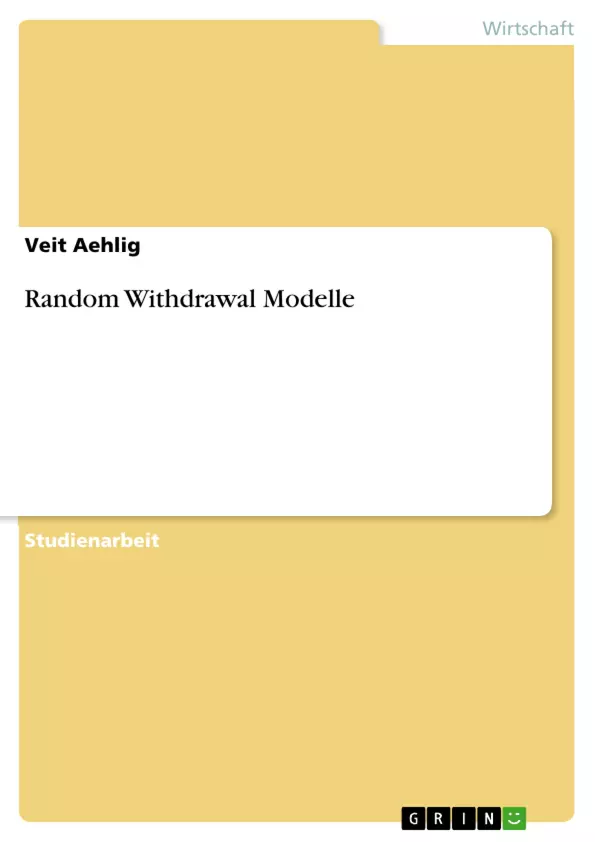Innerhalb der 1990er Jahre war eine übermäßig hohe Anzahl von Finanzkrisen rund um
den Globus zu beobachten. In mehreren regional verschiedenen Wellen, 1992/93 in
Europa, 1994/95 in Lateinamerika, 1997/98 in Asien traten Währungskrisen auf.1 Diese
starke zeitliche Konzentration, die neben den genannten Kontinenten auch Ausprägungen
einzelner Nationen waren (z.B. Bulgarien 1996/97, Ecuador 1998/99), führte zu
verstärkten wissenschaftlichen Untersuchungen der Ursachen solcher Phänomene. Da
diese meist überraschend zu beobachtenden Ereignisse nur schwer anhand vorhandener
Modelle erklärt werden konnten, wurde deren Überarbeitung und Erweiterung notwendig.
Die mittlerweile umfangreiche Literatur über die Erklärung von Finanzkrisen, spaltet sich
dabei in zwei Hauptrichtungen, die sich teilweise überschneiden. Der eine Teil beschäftigt
sich mit den Ursachen von Währungskrisen, während auf der anderen Seite die Entstehung
von Bankenkrisen im Mittelpunkt steht. Währungskrisen sind durch eine starke Abwertung
des Wechselkurses innerhalb eines kurzen Zeitraumes gekennzeichnet, die u. a. durch
spekulative Attacken ausgelöst werden können. Eine Bankenkrise beschreibt hingegen eine
Situation, in der eine beträchtliche Anzahl von Banken in Konkurs geht.2 Besonders die
Finanzkrisen in den Emerging Markets sind sowohl durch den Zusammenbruch fester
Wechselkursregime, als auch von Finanzintermediären charakterisiert, was auf Parallelen
zwischen den zwei Krisenarten schließen lässt. Beide treten auf, wenn die Regierung nicht
länger glaubwürdig ihr Vermögen für die Unterstützung einer Preisfestsetzung einsetzen
kann – entweder für den Preis zwischen in- und ausländischer Währung oder zwischen
Währung und Bankguthaben.3
Als jüngstes Beispiel brach das argentinische Bankensystem unter dem Druck der
enormen Guthabenabzüge der Bevölkerung und dem fehlenden Vertrauen in die eigene
Währung zusammen. Mit den ersten sichtbaren Verschlechterungsanzeichen der
Auslandsschuldenposition des Landes begannen die Argentinier im Sommer und Herbst
2001 ihre Peso-Guthaben abzuheben, während das Bankensystem im selben Zeitraum
einen signifikanten Anstieg an Dollar-Guthaben erfuhr. Nach dem Zusammenbruch des
Currency Boards Ende 2001 verlor der Peso 2/3 seines Wertes. Mit dem ständigen
Wertverlust des Pesos gegenüber dem Dollar verspürten die argentinischen Banken erneut einen „Run“ auf die Guthaben. [...]
1 Sachs (1999), S. 1
2 Berlemann, Hristow und Nenovsky (2002), S. 1
3 Marion (1999), S. 1
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klassifikation theoretischer Modelle
- Das Grundmodell von Diamond und Dybvig
- Die Rolle der Banken als Liquiditätsspender
- Die Wettbewerbslösung
- Der Sichtguthabenvertrag
- Gleichgewichtslösungen
- Suspension of Convertibility
- Der optimale Kontrakt bei zufälligen Guthabenabzügen
- Die staatliche Einlagenversicherung
- Würdigung
- Die Modellerweiterungen von Chang und Velasco
- Der grundlegende Rahmen
- Sichtguthaben und Bank Runs
- Ausländische Kredite
- Permanente Verschuldung
- Kurzfristige Schulden
- Die Höhe des Kapitalzuflusses
- Währungskrisen
- Currency Board
- Wechselkursfixierung
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erklärung von Finanzkrisen anhand von „Random Withdrawal Modellen“, die das zufällige Anlegerverhalten und dessen Auswirkungen auf Währung und Finanzinstitute in den Mittelpunkt stellen. Sie beleuchtet die Entstehung und Entwicklung von Bankenkrisen und Währungskrisen sowie deren Zusammenspiel in den Emerging Markets.
- Die Rolle von Banken als Liquiditätsspender
- Die Entstehung von Bank Runs und Währungskrisen
- Die Bedeutung des Anlegerverhaltens und dessen Auswirkungen auf Finanzinstitute
- Das Zusammenspiel von Währung und Finanzinstituten in Krisensituationen
- Die Analyse verschiedener Modelle zur Erklärung von Finanzkrisen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext von Finanzkrisen in den 1990er Jahren vor, insbesondere in Europa, Lateinamerika und Asien, und betont die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Untersuchung dieser Phänomene. Die Arbeit unterteilt die Literatur über Finanzkrisen in verschiedene Generationen und analysiert die Entstehung von Bankenkrisen und Währungskrisen sowie die Rolle der spekulativen Attacken. Die Einleitung betont die Relevanz der „Random Withdrawal Modelle“ für die Erklärung von Finanzkrisen.
Kapitel 2 behandelt das Grundmodell von Diamond und Dybvig, das die Rolle der Banken als Liquiditätsspender untersucht. Es analysiert den Wettbewerbsmechanismus auf dem Finanzmarkt, die Funktionsweise von Sichtguthabenverträgen und die Entstehung von Gleichgewichtslösungen. Das Kapitel beleuchtet auch die Suspension of Convertibility sowie den optimalen Kontrakt bei zufälligen Guthabenabzügen und diskutiert die Rolle der staatlichen Einlagenversicherung. Das Kapitel würdigt das Grundmodell von Diamond und Dybvig und stellt seine Bedeutung für das Verständnis von Bankenkrisen heraus.
Kapitel 3 befasst sich mit den Modellerweiterungen von Chang und Velasco. Es analysiert den grundlegenden Rahmen, der Sichtguthaben und Bank Runs, die Rolle ausländischer Kredite und die Entstehung von Währungskrisen untersucht. Das Kapitel behandelt die Themen der permanenten und kurzfristigen Verschuldung, den Einfluss der Höhe des Kapitalzuflusses und die Bedeutung des Currency Boards und der Wechselkursfixierung in der Entstehung von Währungskrisen.
Die Schlussbemerkung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und betont die Relevanz der „Random Withdrawal Modelle“ für das Verständnis und die Erklärung von Finanzkrisen.
Schlüsselwörter
Finanzkrisen, Random Withdrawal Modelle, Bankenkrisen, Währungskrisen, Emerging Markets, Anlegerverhalten, Liquidität, Sichtguthaben, Currency Board, Wechselkursfixierung, Diamond-Dybvig-Modell, Chang-Velasco-Modelle
Häufig gestellte Fragen
Was sind Random Withdrawal Modelle?
Diese theoretischen Modelle erklären Finanzkrisen durch das zufällige Abhebeverhalten von Anlegern, das zu Liquiditätsengpässen bei Banken führen kann.
Was besagt das Diamond-Dybvig-Modell?
Es beschreibt die Rolle von Banken als Liquiditätsspender und zeigt auf, wie Sichtguthabenverträge zu einem „Bank Run“ führen können, wenn das Vertrauen der Anleger schwindet.
Wie entstehen Währungskrisen laut Chang und Velasco?
Chang und Velasco erweitern das Grundmodell um Aspekte wie kurzfristige Auslandsverschuldung und Wechselkursfixierungen, die das Risiko eines Zusammenbruchs erhöhen.
Was ist ein „Bank Run“?
Ein Bank Run beschreibt eine Situation, in der eine große Anzahl von Kunden gleichzeitig versucht, ihre Einlagen abzuheben, was zur Insolvenz der Bank führen kann.
Welche Rolle spielt die staatliche Einlagenversicherung?
Die Einlagenversicherung dient dazu, das Vertrauen der Sparer zu stärken und somit die Wahrscheinlichkeit eines Bank Runs durch zufällige Abhebungen zu minimieren.
- Quote paper
- Veit Aehlig (Author), 2003, Random Withdrawal Modelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11402