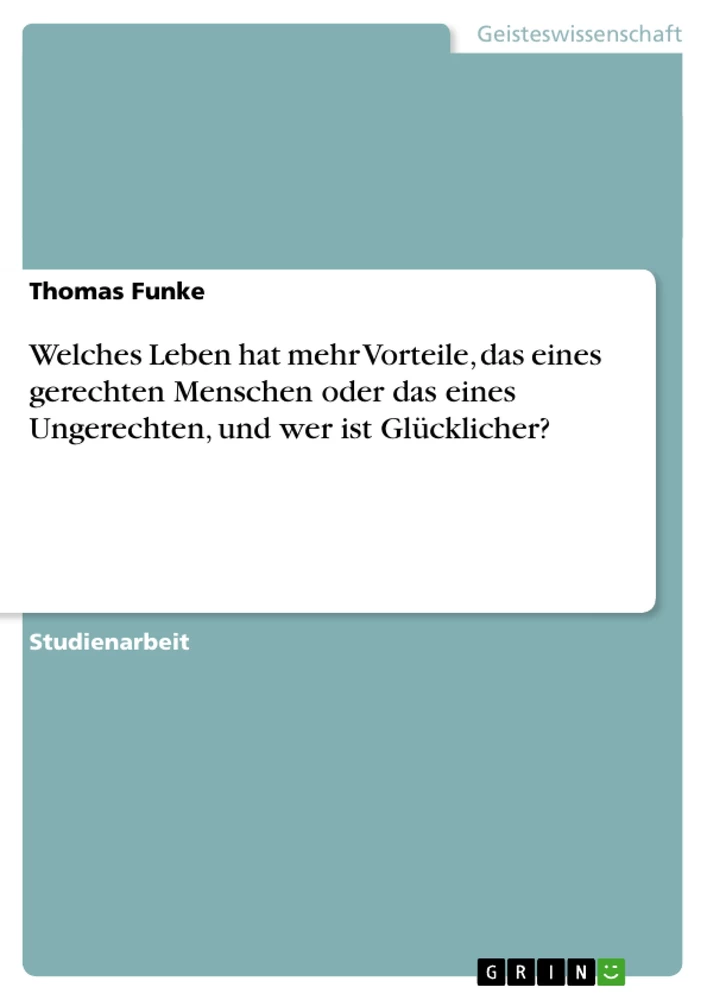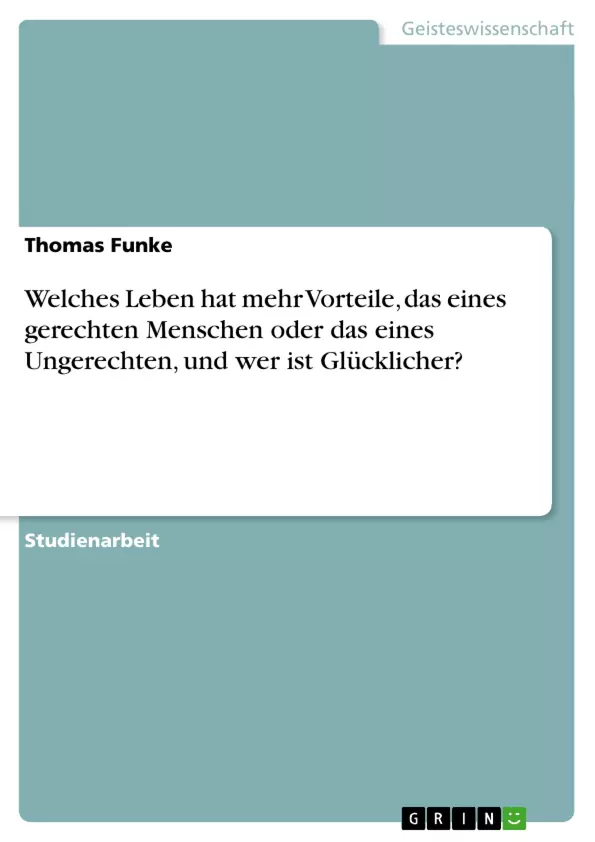Die Ausarbeitung dieses Themas wird anhand der Lektüre: „Platon: Der Staat
(Politeia)“1, vorgenommen.
Zuerst ein kleiner Überblick über das Buch und seinen Autor. Platon lebte von 427-347 vor unserer Zeitrechnung. Er war ein griechischer
Philosoph und Schüler des Sokrates. Er gründete die erste Akademie der Welt in
Athen. Sie ist in ihren Grundzügen noch immer das Vorbild der heutigen
Universitäten.
Platon war bemüht, der Auflösung ethischer, kulturell-sozialer und politischer Werte und Normen in der Verfallsperipode der griechischen Polis entgegenzuwirken. Dazu schuf er ein System, in dem er Begriffe und Ideen als das wahre Sein darstellt, die ewigen Formen und Ursachen aller materiellen Dinge.
Diesem hierarchisch geordneten System entspricht Platon´s Modell eines Staates,
an dessen Spitze er die Geistesaristokratie der Philosohpen stellt. Er versuchte, in Syrakus mit Billigung Dionysios´ II. diese in „Der Staat“ formulierte Gesellschaftstheorie zu verwirklichen, scheiterte jedoch.
Handlungsprinzip war für Platon die unsterbliche menschliche Seele, die im ewigen Widerstreit zwischen Vernunft und Gefühl verfangen ist.
Nur mit Selbstbeherrschung und nach umfassender Bildung kann man wirklich
vernünftig handeln, urteilte Platon.
Für ihn gab es nur im Bereich der Ideen gesichertes Wissen, bei den Sinnesdingen
seien nur „Meinungen“ möglich; sie repräsentieren das Allgemeine
(das Wesentliche) nicht direkt.
Diesen Problemkreis, der das Verhältnis zwischen Denken und Sein thematisiert,
behandelt Platon besonders im Dialog „Phaidon“. In Anlehnung an die
mathematisch-philosophischen Anschauungen der Pythagoreer legte er im
„Timaios“ seine naturphilosophischen Überlegungen dar.
Platons Werk beeinflußte viele Denker im weiteren Verlauf der Philosohpiegeschichte.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
1. - Überblick - Autor:
kurze Beschreibung von Platons Leben und seinem Werk
2. - Überblick - Buch:
Aufgliederung der Politeia nach Kurt Hildebrandt
II. Welches sind die unterschiedlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit?
1. - These zur Gerechtigkeit von Polemarchos
- Kommentar
2. - These zur Gerechtigkeit von Thrasymachos
- Kommentar
3. - These zur Gerechtigkeit von Glaukon
- Kommentar
III. Welches Leben birgt mehr Vorteile, das des Gerechten oder des Ungerechten?
1. - These von Glaukon:
der Weg des Gerechten und Ungerechten bei gleichen Voraussetzungen
- Kommentar
2. - These von Glaukon:
das Ungerechte Leben birgt mehr Vorteile
- Kommentar
3. - These von Thrasymachos:
kleines Unrecht wird bestraft, großes Unrecht belohnt (Tyrannis)
- Kommentar
IX. Ist der tyrannische Mensch wirklich der Glücklichere?
1. - Beweisführungsdialog zwischen Sokrates und Glaukon
- Kommentar
2. - Beweisrechnung des Sokrates
- Kommentar
X. Schluß
1. - Die Zusammenfassung von Sokrates zur Fragestellung:
Wer ist der Glücklichste?
- Kommentar
2. - Was versteht Sokrates unter Gerechtigkeit
- Kommentar
I. Einleitung
Die Ausarbeitung dieses Themas wird anhand der Lektüre: „Platon: Der Staat (Politeia)“[1], vorgenommen.
Zuerst ein kleiner Überblick über das Buch und seinen Autor.
1. Überblick - Autor
Platon lebte von 427-347 vor unserer Zeitrechnung. Er war ein griechischer Philosoph und Schüler des Sokrates. Er gründete die erste Akademie der Welt in Athen. Sie ist in ihren Grundzügen noch immer das Vorbild der heutigen Universitäten.
Platon war bemüht, der Auflösung ethischer, kulturell-sozialer und politischer Werte und Normen in der Verfallsperipode der griechischen Polis entgegenzuwirken. Dazu schuf er ein System, in dem er Begriffe und Ideen als das wahre Sein darstellt, die ewigen Formen und Ursachen aller materiellen Dinge.
Diesem hierarchisch geordneten System entspricht Platon´s Modell eines Staates, an dessen Spitze er die Geistesaristokratie der Philosohpen stellt. Er versuchte, in Syrakus mit Billigung Dionysios´ II. diese in „Der Staat“ formulierte Gesellschaftstheorie zu verwirklichen, scheiterte jedoch.
Handlungsprinzip war für Platon die unsterbliche menschliche Seele, die im ewigen Widerstreit zwischen Vernunft und Gefühl verfangen ist.
Nur mit Selbstbeherrschung und nach umfassender Bildung kann man wirklich vernünftig handeln, urteilte Platon.
Für ihn gab es nur im Bereich der Ideen gesichertes Wissen, bei den Sinnesdingen seien nur „Meinungen“ möglich; sie repräsentieren das Allgemeine
(das Wesentliche) nicht direkt.
Diesen Problemkreis, der das Verhältnis zwischen Denken und Sein thematisiert, behandelt Platon besonders im Dialog „Phaidon“. In Anlehnung an die mathematisch-philosophischen Anschauungen der Pythagoreer legte er im „Timaios“ seine naturphilosophischen Überlegungen dar.
Platons Werk beeinflußte viele Denker im weiteren Verlauf der Philosohpie-geschichte.
2. Überblick - Buch
Die Politeia ist aus 10 Büchern zusammengesetzt, die darüber hinaus in sieben übergeordnete, sich nicht an die einzelnen Bücher haltenden Grundabschnitte unterteilt sind.[2]
1. Abschnitt: Vorspiel - Gerechtigkeit der alten Generation
(1. Buch) Unsicherheit der mittleren Generation = Zustand in der
Ungerechtigkeit der Sophisten Gegenwart
2. Abschnitt: Einleitung - Ist der Gerechte glücklich?
(2. Buch)
3. Abschnitt: 1.Hauptteil - Entwicklung des Staates
(2.-4. Buch) Erziehung der Krieger
Verfassung des Staates =Aufbau des Staates
Gerechtigkeit im Staat (Gerechtigkeit)
4. Abschnitt: 2.Hauptteil - Einheit des Blutes
(5.-7. Buch) Herrschaft der Philosophen
Idee des Guten als Sonne des Staates
Erziehung der Philosohpen = Einheit und Wesen des
(Leib und Geist) Staates (Idee des Guten)
5. Abschnitt: 3.Hauptteil - Timokratie
(8. Buch) Oligarchie
Demokratie = Verfall des Staates
Tyrannis (Ungerechtigkeit)
6. Abschnitt: Schluß - der Gerechte ist der Glücklichere
(8.-9. Buch)
7. Abschnitt: Nachspiel - Verwerfung der nachahmenden Dichtung
(10. Buch) Ewige und irdische Gerechtigkeit = Dichtung und
Die neue Dichtung vom ewigen Kosmos Ewigkeit
II. Welches sind die unterschiedlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit?
1. Sokrates unterhält sich in diesem in Dialogform geschriebenen Buch mit
mehreren Menschen, die ihn zu sich eingeladen haben.
In diesem Gespräch, ausschließlich unter Männern, haben die drei Beteiligten Namens Polemarchos, Thrasymachos und Glaukon drei unterschiedliche Meinungen gegenüber Sokrates im Bezug auf die Frage: Was ist Gerechtigkeit? Sokrates erhält die Aufgabe, das Gesagte zu beweisen oder zu widerlegen.
Der erste seiner Gesprächspartner namens Polemarchos vertritt eine Vorstellung von Gerechtigkeit, die Sokrates wie folgt zusammenfaßt: „Also: den Freunden zu nützen, den Feinden zu schaden, das nennt er Gerechtigkeit?“ „Ja“ antwortet Polemarchos. (Platon 90, 332 d)
Diese Behauptung kann Sokrates schon nach kurzem Gespräch entkräften. Er behauptet: „Die Gerechtigkeit ist doch eine Eigenart des Menschen? ... Menschen erleiden also durch eine Schädigung eine Schmälerung in ihrer Gerechtigkeit?... Ist der Gerechte gut?... Dann kann seine Aufgabe nicht sein zu schaden, mein Polemarchos, weder Freund noch Feind, sondern das ist die Aufgabe seines Gegenteils, des Ungerechten!“ (Platon 95, 335 c-d)
- Kommentar:
Mit dieser für mich nicht schlüssigen Begründung widerlegt er Polemarchos These.
Aus meiner Betrachtungsweise heraus ist Sokrates Annahme, daß die Gerechtigkeit eine Eigenart des Menschen ist, nicht haltbar, da es nicht nachgewiesen werden kann, ob dies der Tatsache entspricht oder nicht. Deshalb ist der Ansatz von Sokrates Widerlegung von Polemarchos These aus meiner Sicht falsch, da sie auf einer bloßen Vermutung, beziehungsweise einer Annahme ohne Beweisbarkeit beruht.
2. Thrasymachos, der nun als zweites ein Zwiegespräch mit Sokrates beginnt, verurteilt erst einmal Sokrates Widerlegung der These von Polemarchos als: „Was für ein Geschwätz hält euch da so lange auf, Sokrates! Und wie einfältig benehmt ihr euch denn mit euren Verbeugungen! Wenn du schon wirklich das Wesen des Gerechten wissen willst, dann frage nicht nur und lege deinen Ehrgeiz nicht auf die Widerlegung der Antworten - denn wisse wohl: fragen ist leichter als antworten! -, sondern antworte auch selber und sage einmal deine eigene Meinung über das Gerechte.[d] Aber sage mir ja nicht, es sei das Verpflichtende oder das Nützliche, das Vorteilhafte oder das Gewinnbringende, das Zuträgliche, sondern sprich klar und deutlich deine Meinung aus, denn ein derartiges Geschwätz nehme ich nicht entgegen!“ (Platon 96-97, 336 c-d)
Sokrates möchte sich nicht mit ihm auf einen Streit einlassen und bittet ihn nun seine Vorstellung von Gerechtigkeit zu äußern.
Thrasymachos vertritt in Bezug auf die Gerechtigkeit eine etwas radikalere These als Polemarchos, die er zunächst mit den Worten: „Denn ich behaupte dies: Das Gerechte ist nichts anderes als der Vorteil des Stärkeren.“ (Platon 99, 338c), beschreibt.
Sokrates ist dies zu wenig und läßt sich diese These deshalb noch einmal ausführlicher erläutern. Thrasymachos beginnt mit einem Vergleich, auf den Sokrates später zurückgreifen wird: „Weißt Du denn nicht, daß von den Staaten die einen tyrannische, die anderen demokratische, die dritten aristokratische Verfassungen haben?... In jedem Staat hat der herrschende Teil die Macht? ... Jede Herrschaft gibt die Gesetze nach ihrem Vorteil, die Demokratie demokratische, die Tyrannis tyrannische usw. Nach diesen Gesetzen kündigen sie diesen ihren eigenen Vorteil als das Gerechte für die Untertanen an, und jeden, der es übertritt, bestrafen sie, weil er das Gesetz verletze und Unrecht tue. Und dies ist, mein Bester, was - so behaupte ich - in allen Staaten in gleicher Weise >gerecht< ist, nämlich der Vorteil der bestehenden Herrschaft. [339a] Diese ist an der Macht, so daß für jeden, der nur richtig überlegt, daraus folgt: Überall ist das Recht dasselbe, nämlich der Vorteil des Mächtigeren!“ (Platon 100, 338d - 339a) Sokrates beginnt auch hier sofort damit, diese These von Thrasymachos zu entkräften. Mit den folgenden Worten erzielt er kurzfristig den gewünschten Erfolg: „Damit hast du auch, glaube mir, zugegeben“, fuhr ich fort, „daß es gerecht sei, Handlungen, die für die Herrschenden und Stärkeren nachteilig sind, durchzuführen. Denn einerseits geben die Herrschenden unabsichtlich Befehle zu ihrem Nachteil, andrerseits ist es für die Untertanen - nach deiner Behauptung - gerecht, diese Befehle auszuführen. Daraus, mein weisester Thrasymachos, folgt unausweichbar, gerecht sei - das Gegenteil von dem zu machen, was du behauptet hast. Denn den Untertanen wird ja befohlen auszuführen, was dem Mächtigen nicht vorteilhaft ist.“ (Platon 101, 339e)
[...]
[1] Platon. Politeia: Übs. Karl Vretska. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co., 1982
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema von Platons "Politeia (Der Staat)"?
Die Analyse der verschiedenen Vorstellungen von Gerechtigkeit, die Diskussion über die Vorteile eines gerechten im Vergleich zu einem ungerechten Lebens und die Frage, ob ein tyrannischer Mensch glücklicher ist. Das Dokument dient als umfassende Sprachvorschau mit Inhaltsverzeichnis, Zielen, Schlüsselthemen, Kapitelsusammenfassungen und Schlüsselwörtern, die für akademische Analysen gedacht sind.
Wer sind die Hauptfiguren, die im Dialog über Gerechtigkeit in Platons "Politeia (Der Staat)" diskutieren?
Die Hauptfiguren in der Diskussion sind Sokrates, Polemarchos, Thrasymachos und Glaukon. Sie präsentieren unterschiedliche Perspektiven auf die Definition von Gerechtigkeit, die Sokrates zu widerlegen oder zu beweisen versucht.
Welche Gerechtigkeitsdefinitionen werden von Polemarchos, Thrasymachos und Glaukon vorgebracht?
Polemarchos definiert Gerechtigkeit als "Freunden zu nützen, Feinden zu schaden". Thrasymachos behauptet, dass "das Gerechte nichts anderes als der Vorteil des Stärkeren" sei. Glaukon präsentiert die These, dass das ungerechte Leben mehr Vorteile birgt.
Wie widerlegt Sokrates die These von Polemarchos?
Sokrates argumentiert, dass Gerechtigkeit eine Eigenart des Menschen sei und somit nicht dazu dienen könne, anderen zu schaden, auch nicht Feinden. Er behauptet, dass es die Aufgabe des Gerechten nicht sei, zu schaden, sondern die des Ungerechten.
Was ist Thrasymachos' Vergleich, den er zur Beschreibung seiner These verwendet?
Thrasymachos vergleicht die Gerechtigkeit in verschiedenen Staatsformen (Tyrannis, Demokratie, Aristokratie) und argumentiert, dass die herrschende Macht in jedem Staat Gesetze zu ihrem eigenen Vorteil erlässt und diese als "gerecht" für die Untertanen deklariert.
Was ist der Inhalt der Einführung in Platons "Politeia (Der Staat)"?
Die Einführung gibt einen Überblick über Platons Leben und Werk, sowie eine Aufgliederung der Politeia nach Kurt Hildebrandt. Es wird Platons Bemühung hervorgehoben, der Auflösung ethischer, kulturell-sozialer und politischer Werte entgegenzuwirken und sein hierarchisch geordnetes Staatmodell vorgestellt.
Welche übergeordneten Grundabschnitte werden in der Politeia unterschieden?
Laut Kurt Hildebrandt wird die Politeia in sieben übergeordnete Grundabschnitte unterteilt: Vorspiel (Gerechtigkeit der alten Generation), Einleitung (Ist der Gerechte glücklich?), 1. Hauptteil (Entwicklung des Staates), 2. Hauptteil (Einheit des Blutes), 3. Hauptteil (Timokratie, Oligarchie, Demokratie, Tyrannis), Schluss (der Gerechte ist der Glücklichere) und Nachspiel (Verwerfung der nachahmenden Dichtung).
- Quote paper
- Thomas Funke (Author), 1999, Welches Leben hat mehr Vorteile, das eines gerechten Menschen oder das eines Ungerechten, und wer ist Glücklicher?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114076