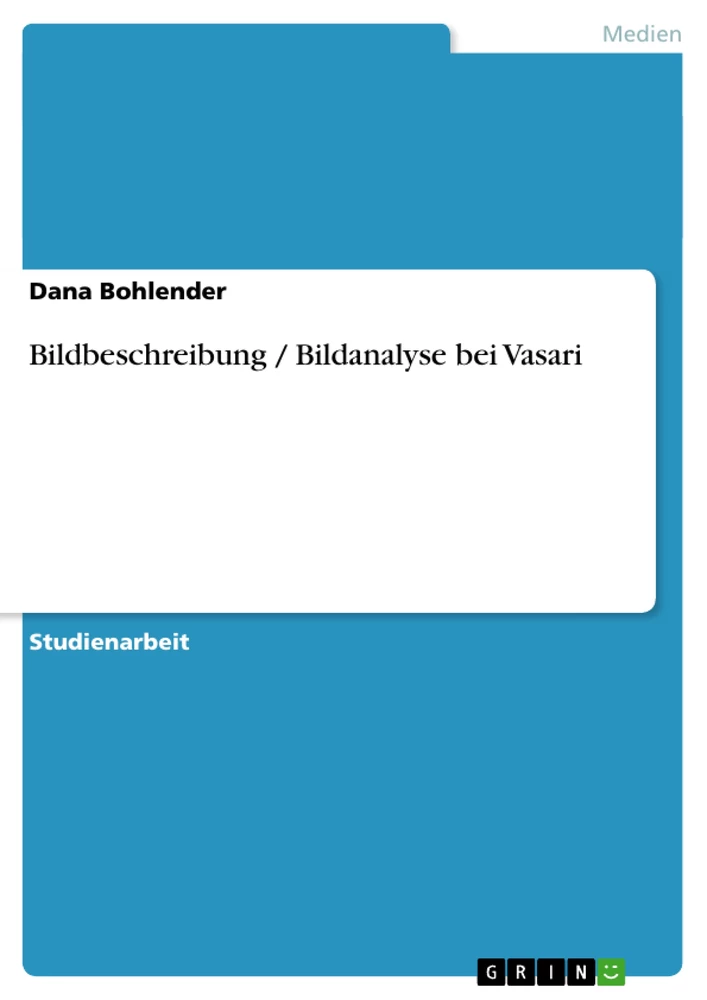Giorgio Vasari (1511-1574), ein humanistisch gebildeter Maler und Baumeister, veröffentlichte um 1550 erstmals ein Werk, welches Geschichte und Kunst verbindet und versucht deren Entwicklung darzustellen. Er gilt daher als Begründer einer neuen Gattung und wird vom Wiener Kunsthistoriker und Quellenforscher Julius von Schlosser als „Vater der Kunstgeschichte“ bezeichnet . Geschrieben ist das Werk aus seiner Sicht als Maler und richtet sich in erster Linie an Künstler. Er traf die Auswahl der „ausgezeichnetsten“ Künstler selbst und beurteilt sie ohne andere Meinungen dazu einzuholen. Insofern handelt es sich nicht um ein kunstkritisches Werk. Vasaris Viten behandeln neben dem Leben der Künstler an sich auch Informationen zu ihren Werken. Warum diese aus heutiger Sicht nicht als Bildbeschreibungen bezeichnet werden können, soll anhand ausgewählter Beispiele aus seinem Buch dargelegt werden. Darüber hinaus soll untersucht werden, wie es sich mit den Bildbeschreibungen bei den nachfolgenden kunsttheoretischen Schriften von Bellori und Félibien verhält. Schlussendlich geht es um den jeweiligen Beitrag dieser unterschiedlichen Autoren, zur heutigen wissenschaftlichen Bildbeschreibung zu gelangen. Anfangs wird sich diese Arbeit allgemein mit dem Werk Vasaris beschäftigen um den Rahmen der „Bildbeschreibungen“ darzustellen und um Vasaris Ansichten zur Kunst kennen zu lernen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die beiden Ausgaben: 1550 und 1568
- 3. Aufbau der Viten
- 4. Bildanalyse/Bildbeschreibung bei Vasari
- 4.1 Leonardo da Vinci, Mona Lisa um (1503)
- 4.2 Raffael, Schule von Athen (1509-1510)
- 4.3 Michelangelo, David (1501-1504)
- 4.4 Masaccio, Der Zinsgroschen (um 1424-1428)
- 5. Giovanni Pietro Bellori (1613-1696)
- 5.1 Domenichino, Kommunion des Heiligen Hieronymus (1614)
- 6. André Félibien (1619-1695)
- 6.1 Nicolas Poussin, Manalese (1639)
- 7. Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bildbeschreibungen bei Vasari, Bellori und Félibien, um deren Beitrag zur heutigen wissenschaftlichen Bildbeschreibung zu erforschen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Kunstgeschichte als Disziplin und der sich verändernden Perspektive auf Kunstwerke über die Jahrhunderte.
- Entwicklung der Kunstgeschichtsschreibung
- Bildbeschreibungsmethoden im Vergleich
- Die Rolle des Künstlers in der Kunstgeschichte
- Vergleichende Analyse von Vasaris Viten mit den Schriften von Bellori und Félibien
- Einfluss des Kontextes auf die Kunstinterpretation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt Giorgio Vasari als Begründer der modernen Kunstgeschichte vor. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit, nämlich die Analyse der Bildbeschreibungen bei Vasari und deren Vergleich mit den Ansätzen von Bellori und Félibien. Es wird betont, dass Vasaris Werk nicht als rein kunstkritisch, sondern als aus der Perspektive eines Malers verfasst gilt, was die Interpretation seiner Beschreibungen beeinflusst.
2. Die beiden Ausgaben: 1550 und 1568: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Ausgaben von Vasaris "Lebensbeschreibungen". Es analysiert die Veränderungen im Titel, der Erweiterung um Künstlerporträts und die Aufnahme zeitgenössischer Künstler in der zweiten Ausgabe. Die Diskussion umfasst auch die veränderte Sichtweise Vasaris auf die Kunstentwicklung zwischen den beiden Auflagen und wie diese im Text sichtbar wird. Die unterschiedlichen Verleger und die daraus resultierenden Bezeichnungen "Torrentiniana" und "Giuntina" werden ebenfalls erläutert.
3. Aufbau der Viten: Das Kapitel beleuchtet den Aufbau von Vasaris "Lebensbeschreibungen", beginnend mit der Widmung an Cosimo I. und der Auseinandersetzung mit der Debatte um den Vergleich von Malerei und Bildhauerei. Vasaris Ziel, den Ruhm der Künstler zu bewahren und die Bedeutung der Zeichnung als gemeinsame Grundlage beider Künste hervorzuheben, wird analysiert. Der Text unterstreicht Vasaris Bemühungen, die Geschichte der Kunst als eine Entwicklung zu präsentieren, und wie dieser Aspekt in den "Viten" umgesetzt wurde.
Schlüsselwörter
Giorgio Vasari, Bildbeschreibung, Bildanalyse, Kunstgeschichte, Giovanni Pietro Bellori, André Félibien, italienische Renaissance, Kunsttheorie, Viten, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Bildbeschreibungen bei Vasari, Bellori und Félibien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bildbeschreibungen von Giorgio Vasari, Giovanni Pietro Bellori und André Félibien, um deren Beitrag zur modernen wissenschaftlichen Bildbeschreibung zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Kunstgeschichte als Disziplin und der sich verändernden Perspektive auf Kunstwerke im Laufe der Jahrhunderte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Kunstgeschichtsschreibung, vergleicht verschiedene Bildbeschreibungsmethoden, untersucht die Rolle des Künstlers in der Kunstgeschichte, vergleicht Vasaris "Viten" mit den Schriften von Bellori und Félibien und analysiert den Einfluss des Kontextes auf die Kunstinterpretation.
Welche Künstler und Werke werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert detailliert Vasaris Beschreibungen von Werken wie Leonardos Mona Lisa, Raffaels Schule von Athen, Michelangelos David und Masaccios Zinsgroschen. Zusätzlich werden Belloris Beschreibung der Kommunion des Heiligen Hieronymus von Domenichino und Félibien's Beschreibung von Poussins Manalese betrachtet.
Wie werden Vasaris "Viten" behandelt?
Die Arbeit vergleicht die beiden Ausgaben von Vasaris "Lebensbeschreibungen" (1550 und 1568), analysiert deren Aufbau, die Veränderungen zwischen den Ausgaben (z.B. Künstlerporträts, Aufnahme neuer Künstler) und die sich verändernde Sichtweise Vasaris auf die Kunstentwicklung. Der Unterschied zwischen den Ausgaben "Torrentiniana" und "Giuntina" wird ebenfalls erläutert. Der Aufbau der einzelnen Viten, Vasaris Ziel, den Ruhm der Künstler zu bewahren und die Bedeutung der Zeichnung, sowie seine Darstellung der Kunstgeschichte als Entwicklung werden ebenfalls untersucht.
Wie werden Bellori und Félibien in die Analyse einbezogen?
Bellori und Félibien werden als Vergleichspunkte zu Vasari herangezogen, um die Entwicklung der Bildbeschreibung und der Kunstgeschichtsschreibung über die Zeit zu beleuchten. Ihre Ansätze werden mit denen Vasaris verglichen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Giorgio Vasari, Bildbeschreibung, Bildanalyse, Kunstgeschichte, Giovanni Pietro Bellori, André Félibien, italienische Renaissance, Kunsttheorie, Viten, Quellenkritik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zur Einleitung, zu den beiden Ausgaben von Vasaris Viten (1550 und 1568), zum Aufbau der Viten, zur Bildanalyse bei Vasari (mit Beispielen), sowie Kapitel zu Bellori und Félibien (mit Beispielen) und ein abschließendes Résumé.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit Kunstgeschichte, Bildanalyse und der Entwicklung der Kunstgeschichtsschreibung auseinandersetzt.
- Quote paper
- Dana Bohlender (Author), 2002, Bildbeschreibung / Bildanalyse bei Vasari, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11408