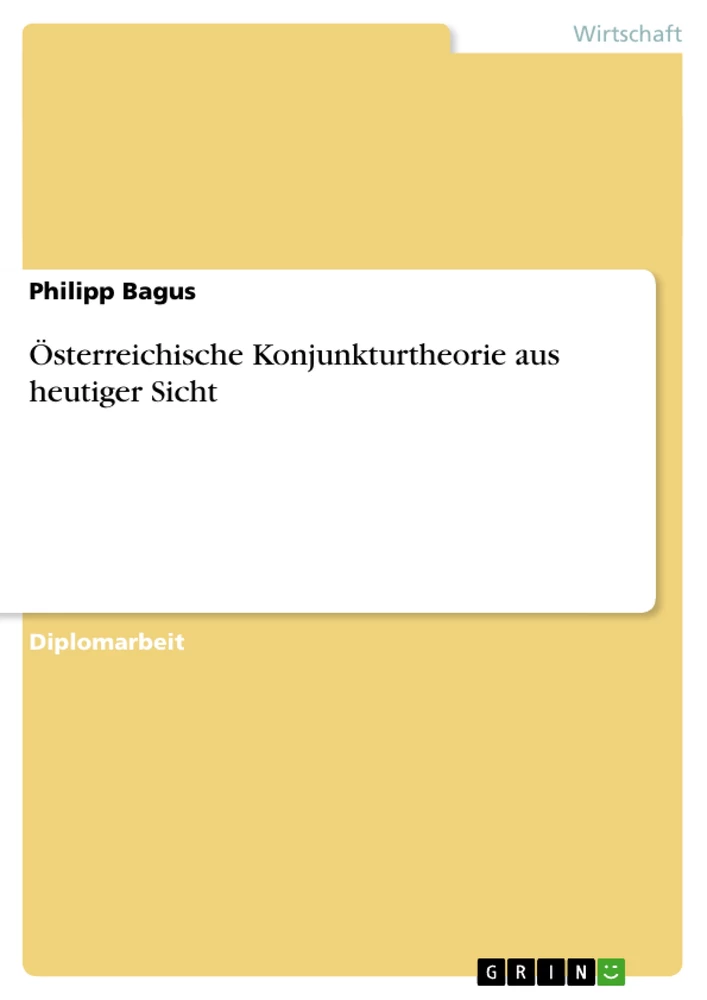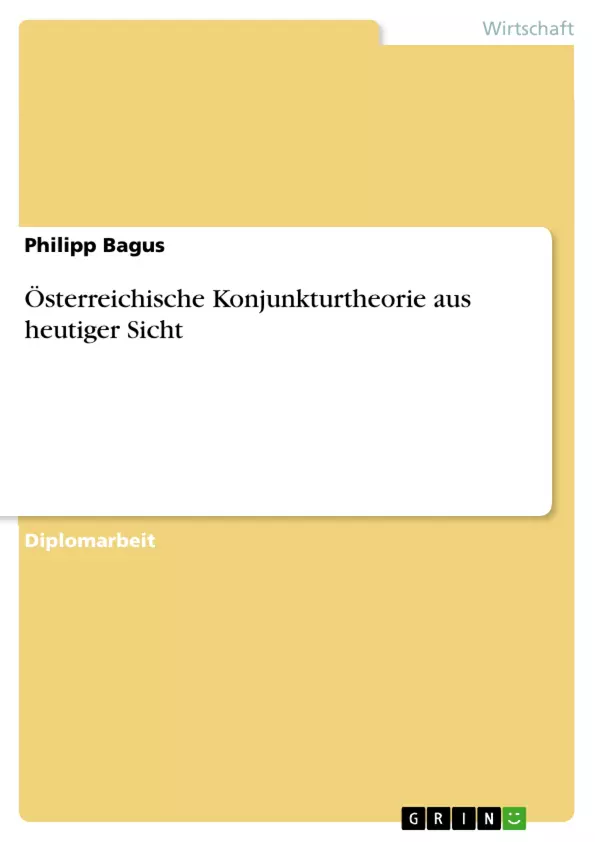Die Österreichische Konjunkturtheorie (ÖKT) kann auf eine lange und wechselreiche Geschichte zurückblicken. Die Geburtsstunde der Österreichischen Konjunkturtheorie ist das Erscheinen von Ludwig von Mises bedeutendem Werk „Die Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel“ im Jahre 1912. In den darauf folgenden Jahren erfreute sich die ÖKT zunehmender Akzeptanz und Verbreitung. So konnte Ludwig von Mises 1928 mit Genugtuung feststellen, dass die Zirkulationskredittheorie, wie er die ÖKT damals bezeichnete, nachdem sie 1912 „verlacht“ worden sei, „heute allgemein anerkannt“ werde. Zu dieser Entwicklung hat neben der theoretischen Konsistenz der ÖKT sicherlich auch beigetragen, dass die Österreicher unter den wenigen Ökonomen waren, die dank ihrer theoretischen Kenntnisse die Große Depression vorhergesagt hatten.
Noch in der theoretischen Diskussion der 1930er Jahre, die von der Auseinan-dersetzung zwischen Keynes und Hayek geprägt war, standen die ÖKT und ihre Grundlagen im Mittelpunkt des ökonomischen Interesses. Im Verlaufe der Auseinandersetzung wendete sich jedoch das Blatt gegen Hayek und die Österreicher. Die Keynessche Theorie gewann die Oberhand. Für den Keynesschen Siegeszug erscheinen zwei Begründungen plausibel. Zum einen ist die ÖKT nicht einfach zu verstehen, bisweilen nicht intuitiv und scheinbar paradox. Sie baut auf einem komplexen Theoriefundament auf, u.a. einer umfassenden Kapitaltheorie.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen und Vorläufer der ÖKT
- 2.1 Vorläufer der ÖKT
- 2.2 Theoretische Grundlagen zum Verständnis der ÖKT
- 2.2.1 Österreichische Methodologie
- 2.2.2 Grundlagen der Kapitaltheorie
- 2.2.3 Sparen und die Produktionsstruktur
- 3 Darstellung der ÖKT
- 3.1 Vorbemerkungen
- 3.1.1 Zyklen versus Schwankungen
- 3.1.2 Problem der Fehlerhäufung
- 3.2 Positive Theorie des Zyklus
- 3.2.1 Wirkungen der Kreditexpansion auf die Produktionsstruktur
- 3.2.2 Marktreaktion auf die Kreditexpansion
- 3.3 Folgen des Zyklus
- 3.3.1 Verlust von Kapital
- 3.3.2 Sekundäre Depression
- 3.3.3 Brachliegende Ressourcen
- 3.3.4 Demoralisierung
- 3.1 Vorbemerkungen
- 4 Ergänzungen zur ÖKT
- 4.1 Rolle der Banken
- 4.2 Rolle der Börse
- 4.3 Preisniveaustabilisierung und ÖKT
- 4.4 Über- versus Fehlinvestitionen
- 4.5 Erholung und Rezession
- 4.6 BIP als unzureichende Erfassung der Vorgänge
- 5 Kritik an der ÖKT
- 5.1 Vorbemerkung
- 5.2 Empirische Relevanz
- 5.3 Rolle ungenutzter Ressourcen
- 5.4 Beendigung der Produktionsprozesse durch weitere Kreditexpansion
- 5.5 Zwangsläufiges unternehmerisches Versagen
- 6 Heutige Bedeutung der ÖKT
- 6.1 ÖKT und moderne Konjunkturtheorien
- 6.1.1 Gemeinsamkeiten
- 6.1.2 Unterschiede
- 6.1.3 Synthese
- 6.2 ÖKT als Hilfe für die heutige Geld- und Konjunkturpolitik
- 6.2.1 Allgemeine Empfehlungen
- 6.2.2 Reformvorschläge monetärer Institutionen
- 6.2.3 Probleme einer hundertprozentigen Goldwährung
- 6.2.4 ÖKT als Hilfe für Zentralbanken
- 6.1 ÖKT und moderne Konjunkturtheorien
- 7 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Österreichische Konjunkturtheorie (ÖKT) aus heutiger Sicht. Ziel ist es, die Grundlagen der ÖKT darzustellen, ihre zentralen Aussagen zu analysieren und ihre heutige Relevanz im Kontext moderner Konjunkturtheorien zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Stärken als auch die Schwächen der Theorie.
- Grundlagen und Vorläufer der ÖKT
- Positive und normative Aussagen der ÖKT
- Kritikpunkte an der ÖKT und deren empirische Relevanz
- Vergleich der ÖKT mit modernen Konjunkturtheorien
- Die Bedeutung der ÖKT für die heutige Geld- und Konjunkturpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie skizziert kurz den historischen Kontext der Österreichischen Konjunkturtheorie und deren anhaltende Relevanz für die wirtschaftswissenschaftliche Diskussion. Es wird die Forschungsfrage formuliert und die Methodik der Arbeit erläutert.
2 Grundlagen und Vorläufer der ÖKT: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Österreichischen Konjunkturtheorie dar. Es beleuchtet die wichtigsten Vorläufer der Theorie und beschreibt die österreichische Methodologie, die sich von den neoklassischen Ansätzen unterscheidet. Besondere Aufmerksamkeit wird den Konzepten der Kapitaltheorie und der Bedeutung von Sparen für die Produktionsstruktur gewidmet. Der Abschnitt unterstreicht die Bedeutung der heterogenen Kapitalgüter und deren unterschiedliche Produktionszeiträume für das Verständnis von Konjunkturzyklen.
3 Darstellung der ÖKT: Dieses Kapitel präsentiert die positive Theorie der ÖKT, die die Entstehung und den Verlauf von Konjunkturzyklen erklärt. Es analysiert die Auswirkungen einer Kreditexpansion auf die Produktionsstruktur und die Reaktion des Marktes darauf. Die Kapitel erläutern, wie Fehlinvestitionen entstehen und zu einer späteren Krise führen. Weiterhin werden die Folgen des Konjunkturzyklus detailliert beschrieben, darunter der Verlust von Kapital, sekundäre Depressionen, brachliegende Ressourcen und die Demoralisierung der Wirtschaftssubjekte. Es wird der Fokus auf die Mikrofundierung der Theorie gelegt, im Gegensatz zu makroökonomischen Modellen.
4 Ergänzungen zur ÖKT: Dieses Kapitel erweitert die Darstellung der ÖKT um Aspekte wie die Rolle der Banken und der Börse im Konjunkturverlauf. Es beleuchtet die Herausforderungen der Preisniveaustabilisierung im Kontext der ÖKT und unterscheidet zwischen Über- und Fehlinvestitionen. Die Bedeutung der Erholungsphasen und Rezessionen wird im Detail erläutert. Kritisch hinterfragt wird die Verwendung des BIP als alleiniges Maß für wirtschaftliche Entwicklung.
5 Kritik an der ÖKT: Dieses Kapitel widmet sich kritischen Auseinandersetzungen mit der ÖKT. Es hinterfragt die empirische Relevanz der Theorie und diskutiert die Rolle ungenutzter Ressourcen im Konjunkturverlauf. Die Möglichkeit einer Beendigung von Produktionsprozessen durch weitere Kreditexpansion wird kritisch bewertet. Schließlich wird die Frage des zwangsläufigen unternehmerischen Versagens im Kontext der ÖKT diskutiert.
6 Heutige Bedeutung der ÖKT: Das Kapitel untersucht die heutige Bedeutung der ÖKT im Vergleich zu modernen Konjunkturtheorien. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden herausgestellt, eine mögliche Synthese wird diskutiert. Ein Schwerpunkt liegt auf der Anwendung der ÖKT für die aktuelle Geld- und Konjunkturpolitik, einschließlich konkreter Empfehlungen und Reformvorschläge für monetäre Institutionen. Die Schwierigkeiten einer hundertprozentigen Goldwährung und die Rolle der ÖKT für Zentralbanken werden detailliert analysiert.
Schlüsselwörter
Österreichische Konjunkturtheorie (ÖKT), Konjunkturzyklen, Kreditexpansion, Kapitaltheorie, Fehlinvestitionen, Geldpolitik, moderne Konjunkturtheorien, Preisniveaustabilisierung, empirische Relevanz, Banken, Börse, Mikrofundierung.
Häufig gestellte Fragen zur Österreichischen Konjunkturtheorie (ÖKT)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit über die Österreichische Konjunkturtheorie?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Österreichische Konjunkturtheorie (ÖKT). Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Die Arbeit analysiert die Grundlagen der ÖKT, ihre zentralen Aussagen, ihre Kritikpunkte und ihre heutige Relevanz im Kontext moderner Konjunkturtheorien. Sie beleuchtet sowohl Stärken als auch Schwächen der Theorie.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Grundlagen und Vorläufer der ÖKT, positive und normative Aussagen der ÖKT, Kritikpunkte und deren empirische Relevanz, Vergleich mit modernen Konjunkturtheorien und die Bedeutung der ÖKT für die heutige Geld- und Konjunkturpolitik. Die Rolle von Banken, der Börse, Fehlinvestitionen und die Problematik des BIP als alleiniges Maß für wirtschaftliche Entwicklung werden ebenfalls diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Grundlagen und Vorläufer der ÖKT, Darstellung der ÖKT, Ergänzungen zur ÖKT, Kritik an der ÖKT, Heutige Bedeutung der ÖKT und Zusammenfassung und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der ÖKT, von ihren historischen Wurzeln und theoretischen Grundlagen bis hin zu ihrer aktuellen Relevanz und Kritikpunkten.
Welche sind die wichtigsten Grundlagen und Vorläufer der ÖKT?
Das Kapitel zu den Grundlagen beleuchtet die österreichische Methodologie, die sich von neoklassischen Ansätzen unterscheidet. Es beschreibt wichtige Vorläufer der Theorie und widmet sich Konzepten der Kapitaltheorie und der Bedeutung des Sparens für die Produktionsstruktur. Die heterogenen Kapitalgüter und deren unterschiedliche Produktionszeiträume spielen eine zentrale Rolle im Verständnis von Konjunkturzyklen.
Wie erklärt die ÖKT Konjunkturzyklen?
Die positive Theorie der ÖKT erklärt Konjunkturzyklen durch die Auswirkungen von Kreditexpansionen auf die Produktionsstruktur und die Reaktion des Marktes darauf. Fehlinvestitionen, die daraus resultieren, führen zu späteren Krisen. Die Folgen des Konjunkturzyklus (Kapitalverlust, sekundäre Depressionen, brachliegende Ressourcen, Demoralisierung) werden detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf der Mikrofundierung der Theorie.
Welche Kritikpunkte werden an der ÖKT geübt?
Die Kritik an der ÖKT umfasst die empirische Relevanz, die Rolle ungenutzter Ressourcen, die Möglichkeit der Beendigung von Produktionsprozessen durch weitere Kreditexpansion und die Frage des zwangsläufigen unternehmerischen Versagens. Diese Aspekte werden kritisch diskutiert und bewertet.
Welche Bedeutung hat die ÖKT heute?
Das Kapitel zur heutigen Bedeutung der ÖKT vergleicht sie mit modernen Konjunkturtheorien. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden herausgearbeitet und eine mögliche Synthese diskutiert. Es werden konkrete Empfehlungen und Reformvorschläge für die Geld- und Konjunkturpolitik gegeben, einschließlich der Herausforderungen einer hundertprozentigen Goldwährung und der Rolle der ÖKT für Zentralbanken.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Österreichische Konjunkturtheorie (ÖKT), Konjunkturzyklen, Kreditexpansion, Kapitaltheorie, Fehlinvestitionen, Geldpolitik, moderne Konjunkturtheorien, Preisniveaustabilisierung, empirische Relevanz, Banken, Börse und Mikrofundierung.
- Quote paper
- Dr. Philipp Bagus (Author), 2006, Österreichische Konjunkturtheorie aus heutiger Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114108