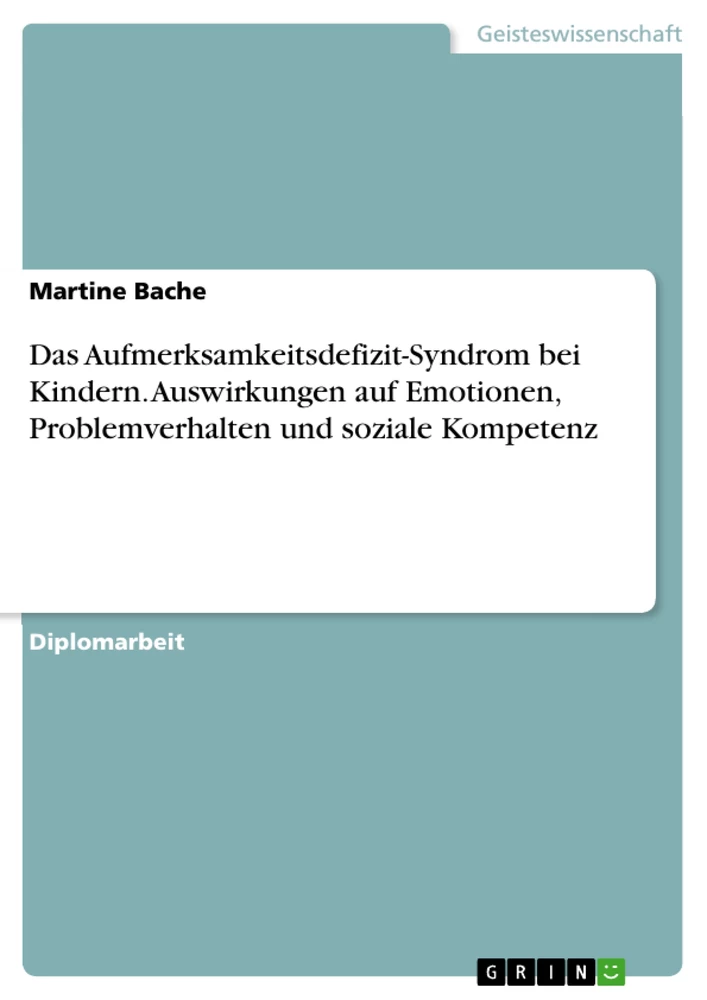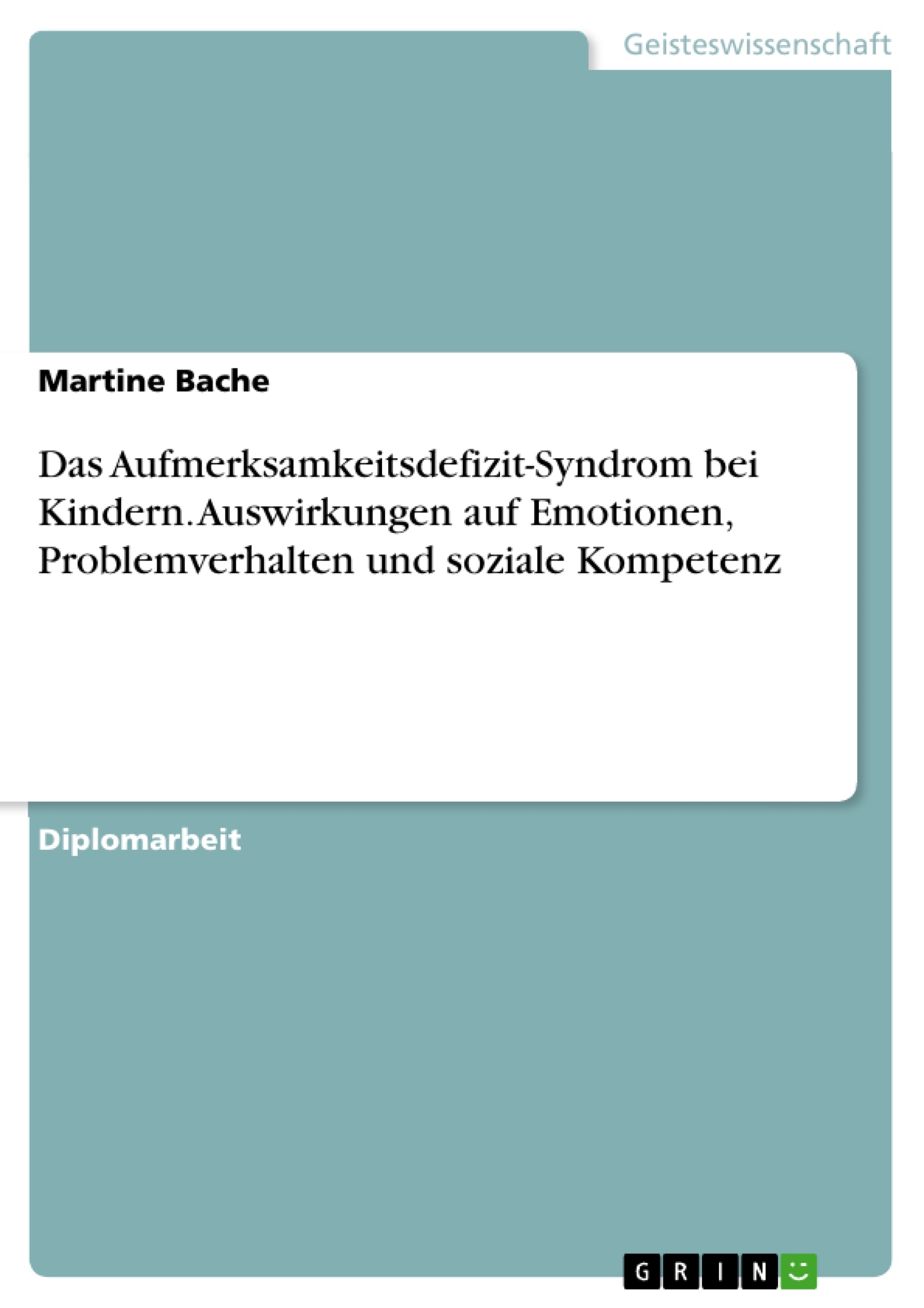Hat nicht jeder von uns schon einmal eine Szene erlebt, in der eine hilflos, am Ende ihrer Kräfte, erscheinende Mutter im „Kampfe“ mit ihrem tobenden Kind um ein neues Spielzeug als eine unautoritäre Person erlebt wurde, die es nicht einmal schafft ihr Kind für fünf Minuten ruhig zu halten? Bei einer solchen Szene denkt ein jeder womöglich zuerst an eine misslungene Erziehung oder eine schlechte Familienbeziehung, wahrscheinlich aber nicht an ein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (AD(H)S), das es dem Kind praktisch unmöglich macht, sich in einer solchen Situation angemessen zu verhalten. Seine mangelnde Impuls- und Selbststeuerungskontrolle zwingt es sozusagen zum Ausrasten, wenn es dieses gewünschte Spielzeug nicht bekommt. Aber nicht nur die Impulsivität, sondern auch die Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität, sowie soziale und emotionale Inkompetenzen gehören zu einer solchen Störung hinzu. Heutzutage sind diese Störungsmerkmale gut bekannt und zählen zu den meist diagnostizierten im Kindesalter. So werden beispielsweise in Kinder- und Jugendpsychiatrischen Einrichtungen Häufigkeitsraten von bis zu 20 % angegeben, wobei die Symptome bei 60-70 % der Betroffenen auch noch im Erwachsenenalter fortbestehen bleiben. Wie man sieht, kann es also von großer Bedeutung sein schon früh im Leben eines betroffenen Kindes mit Hilfe anzusetzen, um ihm sein Leben als AD(H)S Erwachsenen leichter und unkomplizierter zu gestalten und Verständnis von Seiten anderer zu ermöglichen. Dies kann aber nur durch hinreichende Aufklärung der Bevölkerung geschehen, weshalb es für mich wichtig erschien, mich mit dem Thema AD(H)S auseinanderzusetzen und möglicherweise ein bisschen zu dieser Aufklärung beitragen zu können. Bestärkt in meinem Denken wurde ich durch zahlreiche Eltern betroffener Kinder, die einerseits, genau wie ich, der Meinung waren, dass es noch vieler Informationen und Recherchen bedarf, bis die Störung AD(H)S als solche von der Gesellschaft anerkannt und nicht weiterhin als eine Modeerkrankung abgestempelt wird, und die andererseits dankbar erschienen, dass es doch noch Menschen gibt, die sich für die Probleme ihrer Kinder interessieren, sie ernst nehmen und sich für diese „Zappelkinder“ (so eine Mutter) einsetzen und dabei nicht nur ihre Schwächen, sondern auch ihre zahlreichen Stärken erkennen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Zusammenfassung
- 2. Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom
- 2.1 Historischer Hintergrund und Definitionsversuche
- 2.2 Diagnostik
- 2.2.1 Klassifikation nach DSM-IV
- 2.2.2 Drei Hauptsymptome
- 2.2.2.1 Unaufmerksamkeit
- 2.2.2.2 Impulsivität
- 2.2.2.3 Hyperaktivität
- 2.2.2.4 Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom ohne Hyperaktivität
- 2.2.3 Komorbiditäten
- 2.2.4 Differentialdiagnose
- 2.2.5 Diagnostischer Prozess
- 2.3 Mögliche Ursachen
- 2.3.1 Genetische Faktoren
- 2.3.2 Schädigung von Hirnregionen
- 2.3.3 Neurologische Befunde
- 2.3.4 Prä- und perinatale Einflüsse
- 2.3.5 Schadstoffe und Nahrungsmittelallergien
- 2.3.6 Psychosoziale Bedingungen
- 2.4 Epidemiologie
- 2.5 Verlauf
- 2.5.1 Säuglingsalter und Kleinkindalter
- 2.5.2 Vorschulalter
- 2.5.3 Grundschulalter
- 2.5.4 Jugendalter
- 2.5.5 Erwachsenenalter
- 2.6 Therapiemöglichkeiten
- 2.6.1 Medikamentöse Behandlung
- 2.6.2 Homöopathie
- 2.6.3 Verhaltenstherapie
- 2.6.4 Familientherapie
- 2.6.5 Spieltherapie
- 2.6.6 Ergotherapie und Psychomotorik
- 2.6.7 Sprachtherapie, LRS-Training, Konzentrationstraining
- 2.6.8 Entspannungstraining
- 2.7 Positive Aspekte des ADHS
- 3. Emotionen
- 3.1 Definitionsversuche
- 3.2 Basisemotionen und selbstbezogene Emotionen
- 4. Emotionale Kompetenz und Emotionswissen
- 4.1 Definition
- 4.2 Emotionswissen
- 4.3 Emotionswissen als Wissen über die expressive Komponente von Emotionen - Emotionserkennung
- 4.3.1 Säuglingsalter
- 4.3.2 Kleinkind- und Schulalter
- 4.4 Emotionswissen als Wissen über emotionsauslösende Situationen - Situationsbeschreibung für Emotionen
- 4.5 Zusammenhang zwischen Emotionswissen und AD(H)S
- 4.6 Zusammenhang zwischen emotionalen und sozialen Fähigkeiten
- 5. Soziale Kompetenz und Problemverhalten
- 5.1 Definitionsversuche
- 5.2 Entwicklung des Sozialverhaltens
- 5.3 Problemverhalten bei Kindern
- 5.3.1 Verhaltensauffälligkeiten
- 5.3.2 Emotionale Auffälligkeiten
- 5.3.3 Umschriebene Auffälligkeiten
- 5.4 Zusammenhang zwischen Problemverhalten und AD(H)S
- 6. Fragestellungen und Hypothesen
- 6.1 Fragestellungen und Hypothesen zur Fähigkeit der Emotionsbenennung, Emotionserkennung und Situationserklärung
- 6.2 Fragestellungen und Hypothesen zu Problemverhalten und sozialer Kompetenz
- 6.3 Fragen zum Zusammenhang zwischen Problemverhalten und sozialer Kompetenz und der Fähigkeit zur Emotionsbenennung, Emotionserkennung und Situationserklärung
- 7. Datenerhebung und Datenauswertung
- 7.1 Untersuchungsdesign
- 7.2 Soziodemographisches Datenblatt
- 7.3 Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
- 7.4 ADHD Rating Scale IV
- 7.5 Emotionserkennungstest
- 7.6 Operationalisierung
- 7.7 Datenauswertung und statistische Verfahren
- 8. Ergebnisse
- 9. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen des Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndroms (ADHS) bei Kindern auf ihre emotionalen und sozialen Kompetenzen. Im Fokus stehen die Fähigkeiten zur Emotionsbenennung, Emotionserkennung und Situationserklärung für Emotionen, sowie das Problemverhalten und die soziale Kompetenz der betroffenen Kinder.
- Auswirkungen von ADHS auf die Emotionsverarbeitung
- Zusammenhang zwischen ADHS und sozialer Kompetenz
- Analyse von Problemverhalten bei Kindern mit ADHS
- Differenzierung der ADHS-Subtypen bezüglich emotionaler und sozialer Fähigkeiten
- Einfluss soziodemografischer Faktoren auf die emotionalen und sozialen Fähigkeiten von Kindern mit ADHS
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Zusammenfassung: Die Einleitung beschreibt die Relevanz des Themas ADHS, insbesondere im Hinblick auf die emotionalen und sozialen Schwierigkeiten betroffener Kinder. Sie betont die Notwendigkeit von Aufklärung und Verständnis für ADHS und skizziert den Aufbau der Arbeit, die sich mit den emotionalen und sozialen Fähigkeiten betroffener Kinder und deren Problemverhalten auseinandersetzt. Der theoretische Teil wird in vier Kapiteln behandelt und der empirische Teil umfasst Kapitel sechs bis elf.
2. Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADHS): Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über ADHS. Es beginnt mit einem historischen Rückblick auf die unterschiedlichen Bezeichnungen und Definitionsversuche des Syndroms, geht dann auf die Diagnostik (inklusive DSM-IV und ICD-10 Kriterien), mögliche Ursachen (genetische Faktoren, Hirnschädigungen, neurologische Befunde, prä- und perinatale Einflüsse, Schadstoffe und psychosoziale Bedingungen), Epidemiologie, den Verlauf über die Lebensspanne und schließlich Therapiemöglichkeiten (medikamentös, verhaltenstherapeutisch, etc.) ein. Abschließend werden auch die positiven Aspekte des ADHS hervorgehoben.
3. Emotionen: Das Kapitel beleuchtet verschiedene Definitionsansätze zum Thema Emotionen und identifiziert die zentralen Komponenten (Gefühl, physiologischer Zustand und Ausdruck). Es differenziert zwischen Basisemotionen (angeboren, universell) und selbstbezogenen Emotionen (entwickeln sich später, kulturell beeinflusst) und beschreibt die Entwicklung dieser Emotionen im Kindesalter.
4. Emotionale Kompetenz und Emotionswissen: Dieses Kapitel definiert emotionale Kompetenz und Emotionswissen und beschreibt deren Entwicklung. Es beleuchtet den Zusammenhang zwischen Emotionswissen und ADHS, sowie den Einfluss emotionaler Fähigkeiten auf die soziale Kompetenz. Untersuchungen zeigen, dass Kinder mit ADHS Defizite im Erkennen und Benennen von Emotionen aufweisen können.
5. Soziale Kompetenz und Problemverhalten: Das Kapitel befasst sich mit verschiedenen Definitionen sozialer Kompetenz und deren Entwicklung im Kindesalter. Es beschreibt verschiedene Arten von Problemverhalten bei Kindern (Verhaltensauffälligkeiten, emotionale Auffälligkeiten, umschriebene Auffälligkeiten) und den Zusammenhang zwischen Problemverhalten und ADHS. Kinder mit ADHS zeigen häufig soziale Schwierigkeiten und Problemverhalten.
6. Fragestellungen und Hypothesen: Dieses Kapitel formuliert die Forschungsfragen und Hypothesen der Studie. Es werden Hypothesen zu den Unterschieden in der Emotionsverarbeitung, im Problemverhalten und in der sozialen Kompetenz zwischen Kindern mit und ohne ADHS aufgestellt. Zusätzlich werden Fragestellungen zu den Einflüssen soziodemografischer Faktoren und dem Zusammenhang zwischen emotionalen, sozialen und verhaltensbezogenen Aspekten formuliert.
7. Datenerhebung und Datenauswertung: Dieses Kapitel beschreibt das Untersuchungsdesign, die Stichproben (Untersuchungs- und Kontrollgruppe), die verwendeten Messinstrumente (Soziodemographisches Datenblatt, SDQ, ADHD Rating Scale IV, Emotionserkennungstest) und die statistischen Auswertungsmethoden (Chi-Quadrat-Test, exakter Fisher-Test, Mann-Whitney-U-Test, Kruskal-Wallis-H-Test, Cramer-V-Test).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Auswirkungen von ADHS auf emotionale und soziale Kompetenzen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen des Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndroms (ADHS) bei Kindern auf ihre emotionalen und sozialen Kompetenzen. Im Fokus stehen die Fähigkeiten zur Emotionsbenennung, Emotionserkennung und Situationserklärung für Emotionen, sowie das Problemverhalten und die soziale Kompetenz der betroffenen Kinder.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themengebiete: Definition und Diagnostik von ADHS, verschiedene Theorien zu Emotionen und deren Entwicklung, das Konzept der emotionalen Kompetenz und des Emotionswissens, soziale Kompetenz und Problemverhalten bei Kindern, sowie der Zusammenhang dieser Aspekte mit ADHS. Ein empirischer Teil untersucht diese Zusammenhänge anhand von erhobenen Daten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil umfasst Kapitel 1 bis 5 und behandelt die Grundlagen zu ADHS, Emotionen, emotionaler und sozialer Kompetenz sowie Problemverhalten. Kapitel 6 formuliert die Forschungsfragen und Hypothesen. Der empirische Teil (Kapitel 7 bis 9) beschreibt die Datenerhebung, -auswertung und die Ergebnisse der Studie.
Welche Methoden wurden zur Datenerhebung und -auswertung verwendet?
Zur Datenerhebung wurden folgende Instrumente eingesetzt: ein soziodemografisches Datenblatt, der Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), die ADHD Rating Scale IV und ein Emotionserkennungstest. Die statistische Auswertung umfasste Methoden wie den Chi-Quadrat-Test, den exakten Fisher-Test, den Mann-Whitney-U-Test, den Kruskal-Wallis-H-Test und den Cramer-V-Test.
Welche Forschungsfragen und Hypothesen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Unterschiede in der Emotionsverarbeitung, im Problemverhalten und in der sozialen Kompetenz zwischen Kindern mit und ohne ADHS. Es werden Hypothesen zu den Einflüssen soziodemografischer Faktoren und dem Zusammenhang zwischen emotionalen, sozialen und verhaltensbezogenen Aspekten aufgestellt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die konkreten Ergebnisse der Studie werden in Kapitel 8 der Arbeit detailliert dargestellt und in Kapitel 9 diskutiert. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich in der Einleitung und Zusammenfassung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit basieren auf den empirischen Ergebnissen und beleuchten die Zusammenhänge zwischen ADHS, emotionalen und sozialen Kompetenzen sowie Problemverhalten. Die Diskussion der Ergebnisse (Kapitel 9) bewertet die Ergebnisse im Kontext des aktuellen Forschungsstands und gibt Hinweise für zukünftige Forschung.
Welche Bedeutung hat die Arbeit?
Die Arbeit trägt zum Verständnis der emotionalen und sozialen Schwierigkeiten bei Kindern mit ADHS bei. Die Ergebnisse können dazu beitragen, frühzeitige Interventionen und Therapien zu entwickeln und zu optimieren, um die Lebensqualität betroffener Kinder zu verbessern.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, Pädagogen, Therapeuten, Ärzte und Wissenschaftler, die sich mit ADHS und den damit verbundenen Herausforderungen auseinandersetzen.
Wo kann ich die vollständige Arbeit einsehen?
Die vollständige Arbeit ist [hier den Zugriffsort einfügen, z.B. in einer Universitätsbibliothek einsehbar].
- Arbeit zitieren
- Magister Martine Bache (Autor:in), 2008, Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom bei Kindern. Auswirkungen auf Emotionen, Problemverhalten und soziale Kompetenz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114112