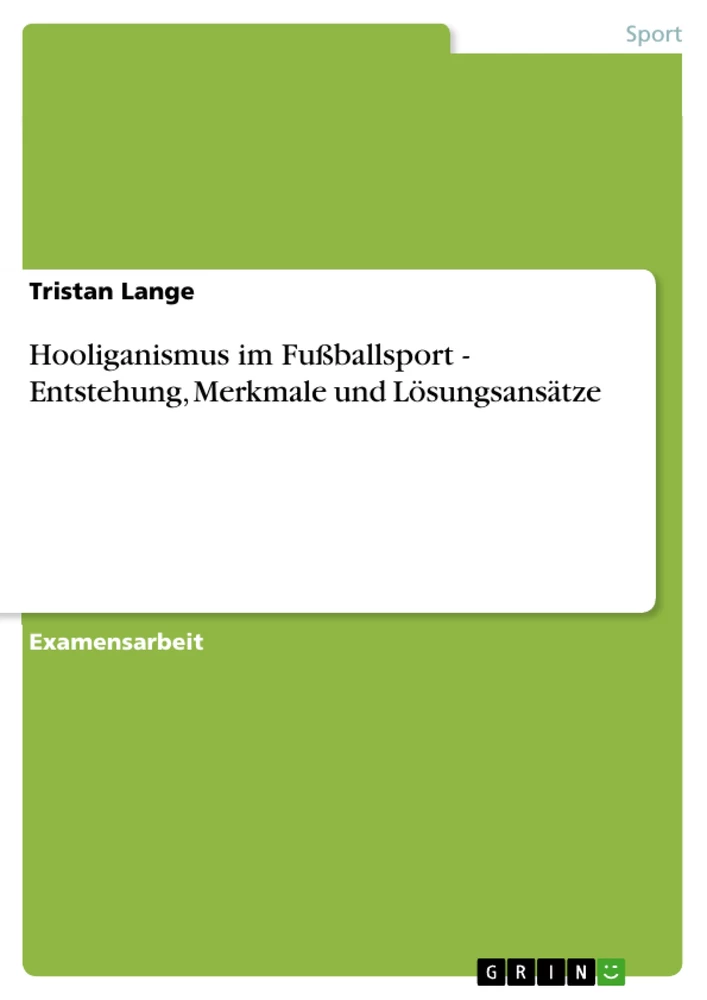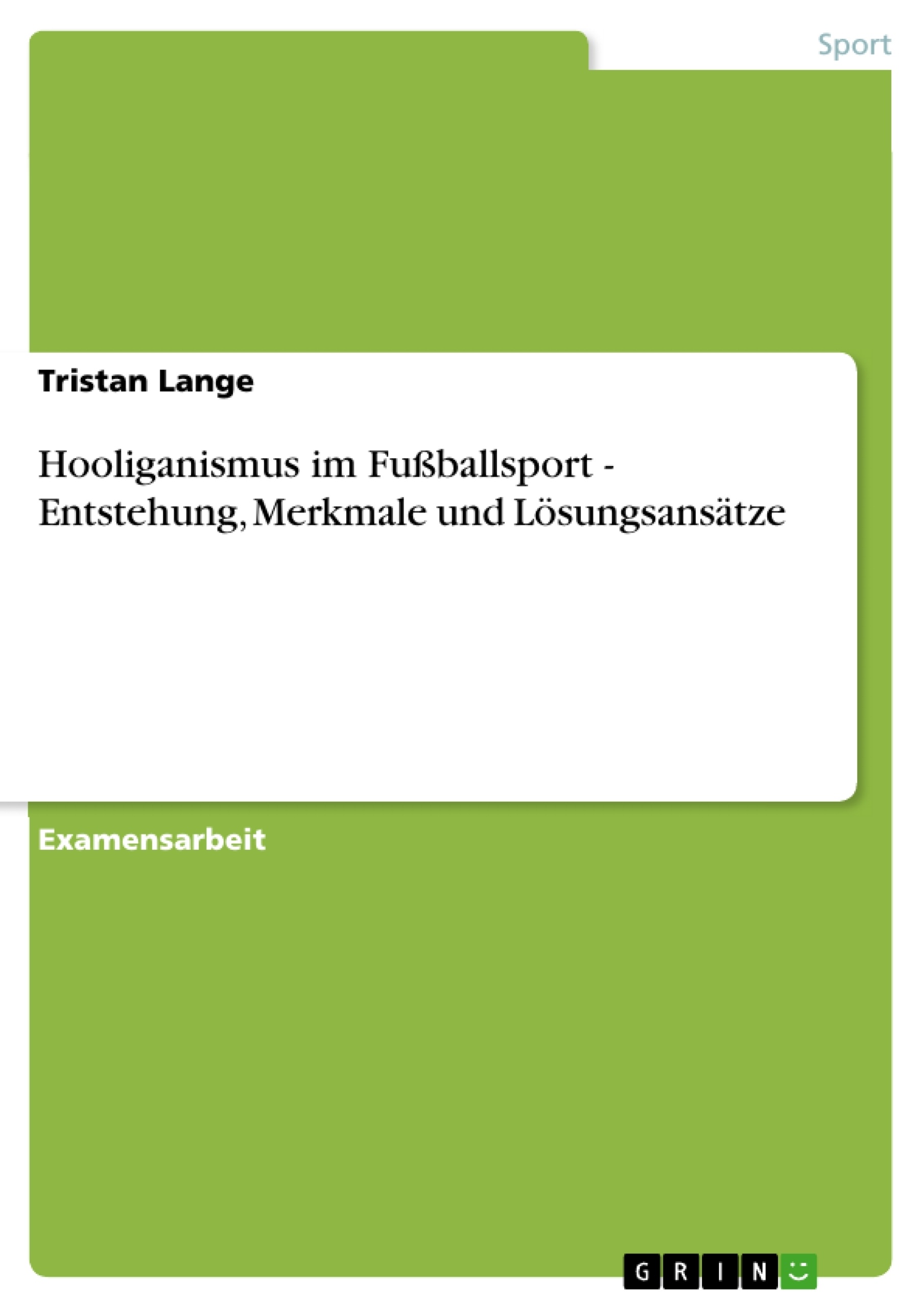Spätestens seit den Ereignissen von Lens 1998, während der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich, dürfte ein Großteil der deutschen Bevölkerung wissen, dass es Hooligans gibt. Die Ereignisse rund um Daniel Nivel, einen französischen Gendarmen und die folgenden Prozesse in der Bundesrepublik und Frankreich waren in den Medien stark vertreten und lösten Betroffenheit in der Öffentlichkeit aus. Sie werden von der Öffentlichkeit als brutale Schläger, zurückgebliebene Jugendliche mit schlechter Kindheit, Neonazis und nur als vermeintliche Fußballfans angesehen. Hier sind sich die Offiziellen von den Vereinen, dem DFB und die Medien weitgehend einig. Hooligans wurden und werden gemeinhin als Gefahr für die Gesellschaft angesehen. Gerade die Gewaltdebatte ist in der Öffentlichkeit immer wieder zu einem zentralen Thema geworden, wobei die Frage nach den Ursachen nur selten gestellt und noch seltener beantwortet wird. Mit dieser Arbeit will ich die Hintergründe und die Motivation dieser gewaltbereiten Jugendlichen und jungen Männer darstellen und aufzeigen das man nicht einfach ein derart einfach gestricktes Raster über sie legen kann. Ich will die Subkultur der Hooligans gründlich analysieren, um dabei die Vorurteile von den wirklich empirisch nachgewiesenen Gegebenheiten zu trennen. Konzentrieren werde ich mich dabei auf die Beschreibung und Erklärung der Erscheinungsformen und Strukturen der jugendlichen Subkultur der Hooligans, die seit Mitte der achtziger Jahre die aktivste und aggressivste Gruppierung in deutschen Fußballstadien darstellt. Schwerpunkt der Darlegungen wird die Entwicklung der aktuellen Lage des Hooliganismus in der Bundesrepublik Deutschland sein. Dies geschieht natürlich unter Beachtung der Veränderungen, die sich in den neuen Bundesländern seit der Wiedervereinigung ergeben haben.
Um sowohl die historischen Wurzeln als auch die internationalen Dimensionen des Phänomens erkennen zu können, bleibt die Arbeit jedoch nicht auf die Situation in Deutschland beschränkt, sondern beschreibt vergleichend auch den Hooliganismus in Großbritannien.
Hooligans finden Spaß an körperlicher Auseinandersetzung, und sie treffen sich, um gegenseitig innersubkulturell körperlich gewalttätig zu werden. Sie nehmen aus diesem Grund eine Sonderstellung innerhalb der gewaltbereiten Subkulturen unserer Gesellschaft ein, die ihre gewalttätigen Handlungen nach außen richten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Geschichte des Fußballs wie wir ihn kennen
- Die Geburtsstunde des Fußballs
- Die Entwicklung des Fußballs
- Die Bedeutung des Fußballs
- Fußball und Medien
- Fußball und Ökonomie
- Die Fans in Deutschland
- Hooliganismus als Subkultur
- Die Entstehung des Hooliganismus
- Die Entwicklung des Hooliganismus
- Die Strukturen des Hooliganismus
- Hooligans und die rechte Szene
- Theorien zum Hooliganismus
- Präventionsmaßnahmen
- Ausblick
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen des Hooliganismus im Fußballsport. Ziel ist es, die Entstehung, Merkmale und Lösungsansätze dieser Subkultur zu analysieren und zu verstehen. Die Arbeit beleuchtet die historischen Wurzeln des Hooliganismus, seine Entwicklung in Deutschland und Großbritannien sowie die Rolle der Medien und der Ökonomie im Kontext des Fußballs.
- Entstehung und Entwicklung des Hooliganismus
- Rolle der Medien und der Ökonomie im Fußball
- Strukturen und Merkmale der Hooligan-Subkultur
- Präventionsmaßnahmen und Lösungsansätze
- Zusammenhang zwischen Hooliganismus und rechter Szene
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Hooliganismus ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Sie stellt die Forschungsfrage und die Vorgehensweise der Arbeit dar.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Geschichte des modernen Fußballs, beginnend mit seiner Entstehung im 19. Jahrhundert. Es beschreibt die Entwicklung des Fußballs von seinen Anfängen bis zur heutigen Zeit und beleuchtet die Bedeutung des Fußballs für die Gesellschaft.
Das dritte Kapitel analysiert die Rolle der Medien im Fußball. Es zeigt auf, wie die Medien den Fußball beeinflussen und wie der Fußball wiederum die Medien prägt.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den ökonomischen Aspekten des Fußballs. Es untersucht die wirtschaftlichen Strukturen des Fußballs und die Rolle des Fußballs als Wirtschaftsfaktor.
Das fünfte Kapitel gibt einen Überblick über die Fanszene in Deutschland. Es zeigt die Heterogenität der Fanszene auf und beleuchtet die Rolle der „Ultras“ als relativ neue Fangruppe.
Das sechste Kapitel widmet sich der Subkultur des Hooliganismus. Es analysiert die Entstehung und Entwicklung des Hooliganismus in Großbritannien und Deutschland, wobei die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der West- und Ostdeutschen Szene herausgearbeitet werden.
Das siebte Kapitel untersucht das Vorurteil, dass Hooligans rechte Schläger sind. Es zeigt auf, dass diese Annahme nicht immer den Fakten entspricht.
Das achte Kapitel beschäftigt sich mit den wissenschaftlichen Theorien zum Hooliganismus. Es analysiert die verschiedenen Theorien und überprüft ihren Erklärungswert für das Hooliganismusphänomen.
Das neunte Kapitel beleuchtet die Präventionsmaßnahmen zum Thema Hooliganismus. Es zeigt die verschiedenen Ansätze der Präventionsarbeit auf und diskutiert deren Wirksamkeit.
Das zehnte Kapitel gibt einen Ausblick auf die Situation des Hooliganismus heute.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Hooliganismus, Fußball, Subkultur, Gewalt, Medien, Ökonomie, Fanszene, Prävention, Deutschland, Großbritannien, rechte Szene. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung, Entwicklung und Strukturen des Hooliganismus, die Rolle der Medien und der Ökonomie im Fußball sowie die Präventionsmaßnahmen und Lösungsansätze für das Phänomen.
- Quote paper
- Tristan Lange (Author), 2007, Hooliganismus im Fußballsport - Entstehung, Merkmale und Lösungsansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114130