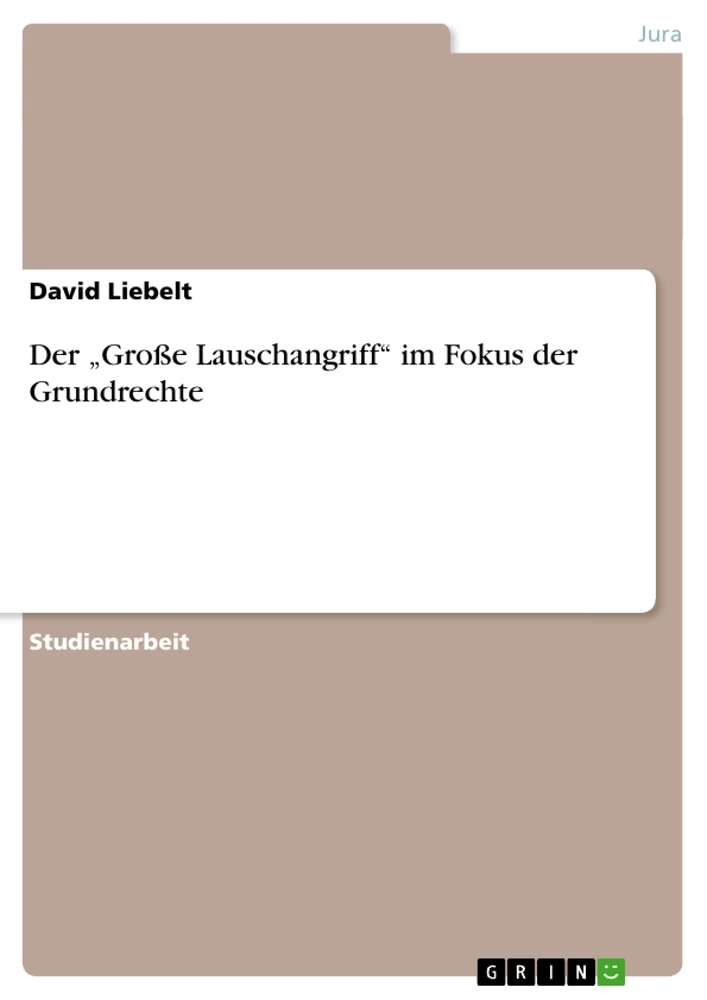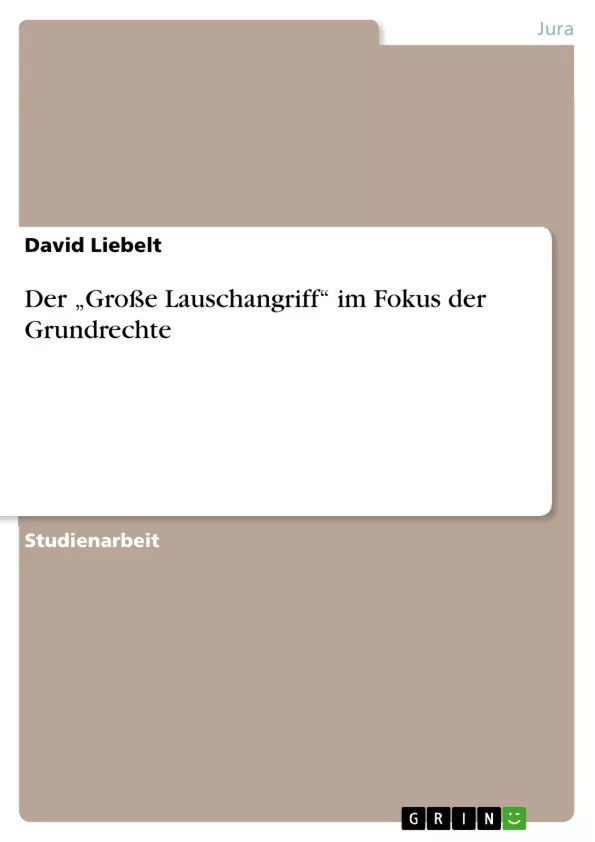Heutzutage hat die organisierte Kriminalität ein neues Gesicht und einen neuen Charakter. Sie kennt keine nationalstaatlichen Grenzen mehr und hat vielfältige neue Betätigungsfelder gefunden: Menschenhandel, Organhandel, Drogen- und Waffenschmuggel. Es handelt sich um ein sehr effektives und gut eingespieltes System, das grenzüberschreitend in verschiedensten Staaten operiert, selbst in Ländern mit hoch entwickelten Rechtssystemen. Dabei nutzen die Kriminellen alle möglichen Mittel, von modernster Technik bis zum menschlichen Genie. Die alten Methoden der Strafverfolgung sind häufig unzureichend, um diese Bedrohung effektiv zu bekämpfen.
Jetzt stellt sich der Politik die Frage, ob nicht auch die Ermittler die neuesten Techniken einsetzen sollten, um die öffentliche Sicherheit zu schützen. Zu diesen modernen Techniken zählen insbesondere Einrichtungen zum Abhören von Wohnungen. Diese Einrichtungen sind nicht besonders teuer und lassen sich ohne viel Aufmerksamkeit zu erzeugen installieren. Dabei sind sie sehr effektiv, um entscheidende Informationen für die Strafverfolgung und die Prävention vor weiteren Straftaten zu bekommen. Der Preis scheint gering und der Gewinn enorm.
Geleitet von diesen Überlegungen beschloss die Bundesregierung 1998 den Ermittlern den Einsatz dieser Mittel zu ermöglichen. Fraglich war, ob die geforderten Eingriffsbefugnisse allein durch eine Änderung und Ergänzung des einfachen Rechts - insbesondere der Strafprozessordnung - eingeführt werden konnten oder ob dafür auch eine Änderung des Grundrechts auf die Unverletzlichkeit der Wohnung in Artikel 13 des Grundgesetzes erforderlich war. Schließlich gelangte man zu dem Ergebnis, dass derartige repressiv motivierte Maßnahmen nicht ohne Grundgesetzänderung eingeführt werden konnten. Das von zwei Dritteln des Bundestags und Bundesrats beschlossene Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes trat am 26. April 1998 in Kraft. Die Strafprozessordnung wurde am 4. Mai 1998 durch das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität entsprechend geändert...
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hintergrund
- 1. Hintergrund zur Menschwürdegarantie in Art. 1 I GG
- 2. Hintergrund zu der Ewigkeitsklausel in Art. 79 III GG
- 3. Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts bei der Auslegung
- 4. Hintergrund zum Grundrecht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung in Art. 13 GG
- III. Der so genannte "Große Lauschangriff"
- 1. Die Änderung des Art. 13 GG
- 2. Diskussion um die Verfassungsmäßigkeit der Änderung
- a) Die Argumente der Kritiker
- b) Die Argumente der Befürworter
- IV. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
- 1. Sachverhalt
- 2. Verfassungsmäßigkeit von Art. 13 III GG n. F.
- a) Die Entscheidung vom Senat
- b) Die abweichende Meinung
- 3. Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften der StPO
- a) Welche Grundgesetzartikel sind Prüfungsmaßstab?
- b) Schutzbereich von Art. 13 GG
- c) Eingriffe
- d) Materielle Eingriffsvoraussetzungen
- e) Formelle Eingriffsvoraussetzungen
- V. Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum "Großen Lauschangriff" von 2004. Sie untersucht die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesänderung bezüglich Artikel 13 GG und die damit verbundenen Fragen des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung im Kontext des Menschenwürdegrundsatzes (Art. 1 I GG) und der Ewigkeitsklausel (Art. 79 III GG).
- Die Auslegung des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG).
- Die Bedeutung des Menschenwürdegrundsatzes (Art. 1 I GG) im Kontext von Überwachungsmaßnahmen.
- Die Reichweite der Ewigkeitsklausel (Art. 79 III GG) und ihre Grenzen.
- Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts bei der Abwägung von Grundrechten und Sicherheitsinteressen.
- Die Auswirkungen der Entscheidung auf die Praxis der Strafverfolgung.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der organisierten Kriminalität und die Notwendigkeit moderner Ermittlungsmethoden dar. Sie führt in die Thematik des "Großen Lauschangriffs" ein, beschreibt die Gesetzgebung von 1998 zur Änderung des Art. 13 GG und der StPO, und die darauf folgende heftige Kritik an der Verfassungsmäßigkeit dieser Maßnahmen. Der Fokus liegt auf der Frage nach dem Verhältnis von Sicherheitsinteressen und Grundrechten, insbesondere der Menschenwürde und der Unverletzlichkeit der Wohnung.
II. Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die relevanten Rechtsgrundlagen. Es analysiert den Menschenwürdegrundsatz in Art. 1 I GG als oberstes Verfassungsprinzip und dessen besondere Bedeutung in der deutschen Rechtsordnung nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus. Des Weiteren wird die Ewigkeitsklausel in Art. 79 III GG erörtert, die Änderungen des Grundgesetzes beschränkt, welche die in Art. 1 und 20 GG niedergelegten Grundsätze berühren. Der Abschnitt behandelt die Rolle des Bundesverfassungsgerichts bei der Auslegung dieser Bestimmungen und den Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 GG.
III. Der so genannte "Große Lauschangriff": Dieser Abschnitt beschreibt die Gesetzesänderung von 1998, die den Einsatz akustischer Wohnraumüberwachung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität ermöglichte. Er präsentiert die gegensätzlichen Argumente der Kritiker und Befürworter der Verfassungsänderung. Kritiker argumentierten mit einer Verletzung des Menschenwürdegrundsatzes und der Ewigkeitsklausel. Befürworter betonten die Notwendigkeit effektiver Mittel zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität.
IV. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts: Dieses Kapitel präsentiert die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2004. Es wird der Sachverhalt dargestellt, die Entscheidung des Senats zur Verfassungsmäßigkeit der Grundgesetzänderung analysiert und die abweichende Meinung erörtert. Im Detail wird die Verfassungsmäßigkeit der betreffenden Paragraphen der StPO untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf die Prüfungsmaßstäbe, den Schutzbereich des Art. 13 GG, die Art der Eingriffe, die materiellen und formellen Eingriffsvoraussetzungen.
Schlüsselwörter
Menschenwürde, Ewigkeitsklausel, Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, Art. 1 I GG, Art. 13 GG, Art. 79 III GG, Bundesverfassungsgericht, Überwachung, organisierte Kriminalität, Abwägung von Grundrechten, Datenschutz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum "Großen Lauschangriff"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum „Großen Lauschangriff“ von 2004. Im Fokus steht die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesänderung bezüglich Artikel 13 GG und die damit verbundenen Fragen des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung im Kontext des Menschenwürdegrundsatzes (Art. 1 I GG) und der Ewigkeitsklausel (Art. 79 III GG).
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Auslegung des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG), die Bedeutung des Menschenwürdegrundsatzes (Art. 1 I GG) im Kontext von Überwachungsmaßnahmen, die Reichweite der Ewigkeitsklausel (Art. 79 III GG) und ihre Grenzen, die Rolle des Bundesverfassungsgerichts bei der Abwägung von Grundrechten und Sicherheitsinteressen sowie die Auswirkungen der Entscheidung auf die Praxis der Strafverfolgung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Hintergrund, Der „Große Lauschangriff“, Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und Würdigung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, beginnend mit der Einführung des Problems und den relevanten Rechtsgrundlagen, über die Beschreibung der Gesetzesänderung und die Argumentation der Beteiligten bis hin zur Analyse der Gerichtsentscheidung und deren Auswirkungen.
Welche Gesetzesänderungen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Gesetzesänderung von 1998, die den Einsatz akustischer Wohnraumüberwachung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität ermöglichte (der „Große Lauschangriff“), und deren Auswirkungen auf Art. 13 GG und die Strafprozessordnung (StPO).
Welche Rolle spielt das Bundesverfassungsgericht?
Das Bundesverfassungsgericht spielt eine zentrale Rolle, da es die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesänderung beurteilt und die Abwägung zwischen Sicherheitsinteressen und Grundrechten vornimmt. Die Arbeit analysiert die Entscheidung des Gerichts, inklusive der Begründung und abweichenden Meinungen.
Welche Grundrechte werden besonders betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG), den Menschenwürdegrundsatz (Art. 1 I GG) und die Relevanz der Ewigkeitsklausel (Art. 79 III GG).
Welche Argumente der Befürworter und Gegner der Gesetzesänderung werden dargestellt?
Die Arbeit präsentiert die gegensätzlichen Argumente der Kritiker und Befürworter der Gesetzesänderung. Kritiker argumentierten mit einer Verletzung des Menschenwürdegrundsatzes und der Ewigkeitsklausel, während Befürworter die Notwendigkeit effektiver Mittel zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität betonten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Menschenwürde, Ewigkeitsklausel, Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, Art. 1 I GG, Art. 13 GG, Art. 79 III GG, Bundesverfassungsgericht, Überwachung, organisierte Kriminalität, Abwägung von Grundrechten, Datenschutz.
- Quote paper
- David Liebelt (Author), 2008, Der „Große Lauschangriff“ im Fokus der Grundrechte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114179