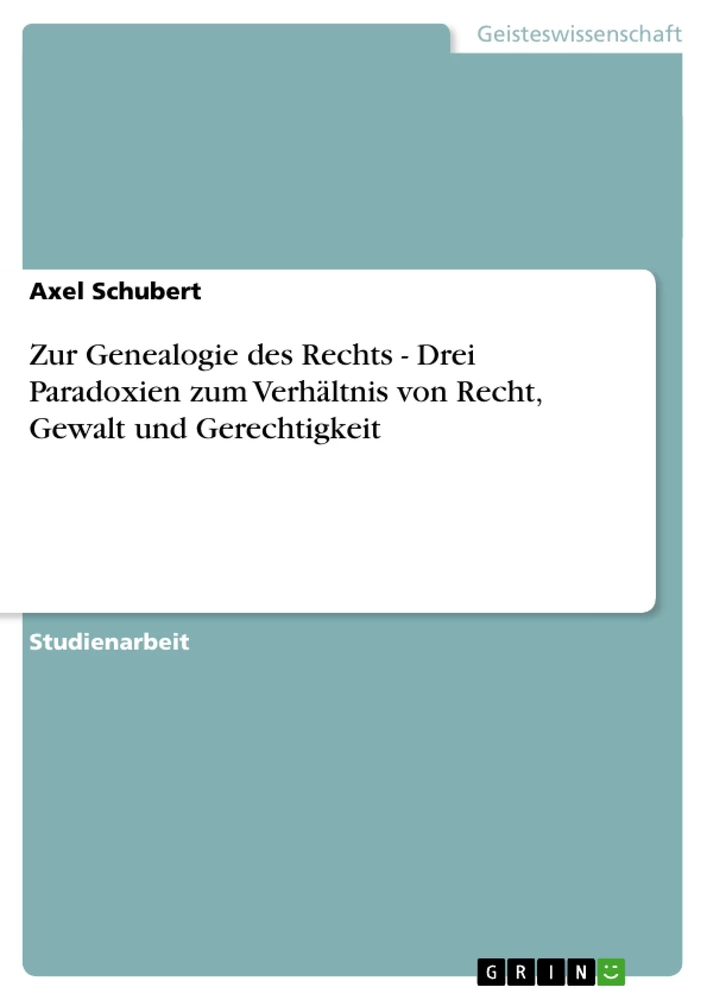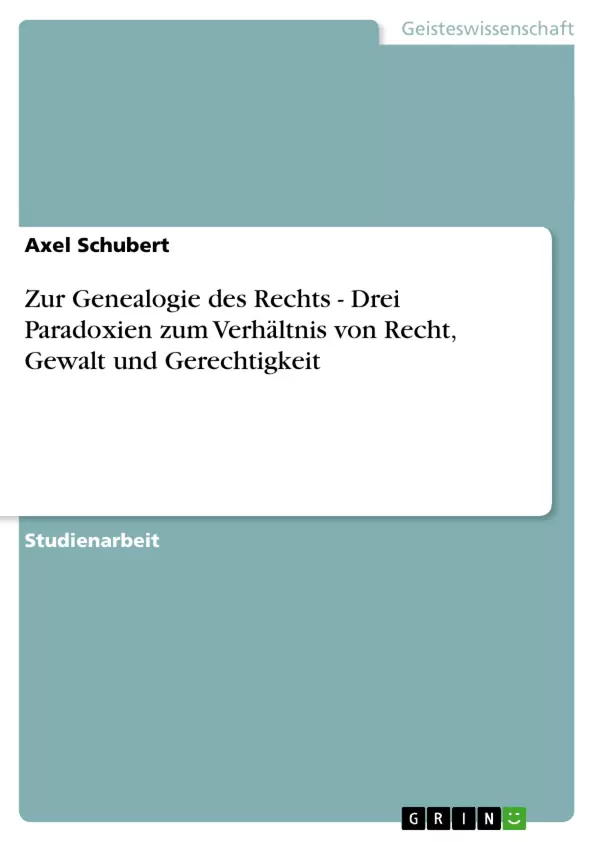Das Motto dieser Arbeit kann auf eine einfache Formel gebracht werden: drei Autoren – drei Paradoxien. Ausgehend von Kants Definition des Rechtsbegriffs werden drei Autoren behandelt, die gemeinsam eine kanonische Rezeptionsgeschichte schreiben: Jacques Derrida liest Walter Benjamin, Giorgio Agamben liest Jacques Derrida. Genau genommen rekurrieren aber Derrida und Agamben zuforderst auf Benjamin. Dessen Aufsatz Zur Kritik der Gewalt (1921) ist die Grundlage für Überlegungen zu dem Verhältnis von Recht, Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida widmet diesem Aufsatz mit Gesetzeskraft. Der „mystische Grund der Autorität“ (1990) zwei ausführliche Vorträge, in denen er ihn einer dekonstruktivistischen Lektüre unterzieht. Für Agambens Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben (1995) hat er katalytische Wirkung. Er droht zwar, in der Fülle der referierten Textquellen unterzugehen. Es ist aber nicht zu übersehen, dass Agamben vor allem diesem, aber auch anderen Texten Benjamins viel verdankt.
In dieser Arbeit werden drei Paradoxien formuliert: die Paradoxie der Gewalt (Benjamin), die Paradoxie des Ursprungs (Derrida) und die Paradoxie der Souveränität (Agamben). Während Agamben seine Paradoxie explizit benennt und zum Titel der systematischen Vorüberlegungen seines Buches Homo sacer macht, formulieren Benjamin und Derrida lediglich, was ich jeweils als Paradoxie bezeichne. Die Lektüre der drei Autoren und der drei Kerntexte wird weitgehend unabhängig und in autonomen Blöcken stattfinden. Erst in der Schlussbetrachtung wird es zu übergreifenden Interpretationen kommen. Zunächst wird Benjamins Kritik der Gewalt insbesondere in Bezug auf die Unterscheidungen von rechtsetzender und rechterhaltender Gewalt dargelegt und interpretiert. Daran schließt sich Derridas Gesetzeskraft an. Es wird in groben Zügen in die Terminologie der Dekonstruktion eingeführt, um die Lektüre vor diesem Hintergrund verständlich zu machen. Schließlich wird Agambens Schlüsselfigur des homo sacer im Zusammenhang mit der Carl Schmitt entlehnten Souveränitätstheorie vorgestellt. Es werden vor allem Agambens strukturtheoretische Überlegungen dazu und die Auflösung dieser beiden Konzeptionen in der der „Lebens-Form“ referiert. Am Schluss der Arbeit stehen schließlich einige vergleichende Überlegungen zu dem Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit bei den drei Autoren und zu der Position, in der sie jeweils zu ihrem theoretischen Gegenstand stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Recht?
- Walter Benjamin: Die Paradoxie der Gewalt
- Gewalt als Mittel und Bedrohung des Rechts
- Rechtsetzende und rechtserhaltende Gewalt
- Göttliche Gewalt
- Jacques Derrida: Das Paradox des Ursprungs
- Différance und Dekonstruktion
- Die Dekonstruktion ist die Gerechtigkeit
- Recht und Gerechtigkeit
- Giorgio Agamben: Das Paradox der Souveränität
- Der Ausnahmezustand
- Ausnahme und Regel
- Ausnahmezustand und „Lebens-Form"
- Schlussbetrachtung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Verhältnis von Recht, Gewalt und Gerechtigkeit anhand der Werke von Walter Benjamin, Jacques Derrida und Giorgio Agamben. Sie untersucht drei Paradoxien, die von diesen Autoren formuliert werden: die Paradoxie der Gewalt (Benjamin), die Paradoxie des Ursprungs (Derrida) und die Paradoxie der Souveränität (Agamben). Die Arbeit verfolgt das Ziel, die jeweiligen Paradoxien zu erläutern und ihre Bedeutung für das Verständnis von Recht, Gewalt und Gerechtigkeit aufzuzeigen.
- Die Paradoxie der Gewalt: Benjamin untersucht die Ambivalenz von Gewalt als Mittel zur Durchsetzung des Rechts und als Bedrohung desselben.
- Das Paradox des Ursprungs: Derrida dekonstruiert den Ursprung des Rechts und zeigt, dass er nicht in einem festen, ursprünglichen Moment zu finden ist, sondern in einem Prozess der ständigen Differenzierung.
- Die Paradoxie der Souveränität: Agamben analysiert die Beziehung zwischen Souveränität und Ausnahmezustand und zeigt, wie der Ausnahmezustand die Grenzen des Rechts auflöst und das nackte Leben in den Vordergrund stellt.
- Recht und Gerechtigkeit: Die Arbeit untersucht, wie die drei Autoren das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit begreifen und welche Rolle die Gewalt in diesem Verhältnis spielt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die drei Autoren und ihre Paradoxien vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition des Rechtsbegriffs bei Kant und zeigt die Schwierigkeiten auf, die mit der Beantwortung der Frage nach dem Wesen des Rechts verbunden sind. Das dritte Kapitel analysiert Benjamins Kritik der Gewalt und seine Unterscheidung zwischen rechtsetzender und rechtserhaltender Gewalt. Das vierte Kapitel widmet sich Derridas Dekonstruktion des Rechts und seiner Kritik an der Idee eines festen Ursprungs. Das fünfte Kapitel untersucht Agambens Theorie des Ausnahmezustands und seine Analyse der Souveränität. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt die jeweiligen Positionen der drei Autoren zum Verhältnis von Recht, Gewalt und Gerechtigkeit gegenüber.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Recht, Gewalt, Gerechtigkeit, Paradoxie, Walter Benjamin, Jacques Derrida, Giorgio Agamben, Dekonstruktion, Ausnahmezustand, Souveränität, Lebens-Form, Rechtsphilosophie, Kritik der Gewalt, Homo sacer, Différance.
Häufig gestellte Fragen
Welche drei Paradoxien des Rechts werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit behandelt die Paradoxie der Gewalt (Walter Benjamin), die Paradoxie des Ursprungs (Jacques Derrida) und die Paradoxie der Souveränität (Giorgio Agamben).
Was versteht Walter Benjamin unter rechtsetzender und rechtserhaltender Gewalt?
Rechtsetzende Gewalt begründet neues Recht (oft durch Gewalt), während rechtserhaltende Gewalt dazu dient, das bestehende Recht vor Bedrohungen zu schützen.
Wie definiert Giorgio Agamben die Paradoxie der Souveränität?
Agamben zeigt auf, dass der Souverän gleichzeitig innerhalb und außerhalb der Rechtsordnung steht, da er die Macht hat, den Ausnahmezustand auszurufen und damit das Recht zu suspendieren.
Was ist Jacques Derridas Beitrag zur Debatte um Gerechtigkeit?
Derrida dekonstruiert das Recht und stellt fest, dass Gerechtigkeit zwar unmöglich vollständig im Gesetz fassbar ist, aber gerade durch die Dekonstruktion des Rechts angestrebt wird.
Was bedeutet der Begriff „Homo Sacer“ bei Agamben?
Der Homo Sacer ist eine Figur des antiken Rechts, die ausgestoßen ist und getötet werden darf, ohne dass dies als Mord gilt. Er repräsentiert das „nackte Leben“ im Ausnahmezustand.
- Arbeit zitieren
- Axel Schubert (Autor:in), 2003, Zur Genealogie des Rechts - Drei Paradoxien zum Verhältnis von Recht, Gewalt und Gerechtigkeit , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114292