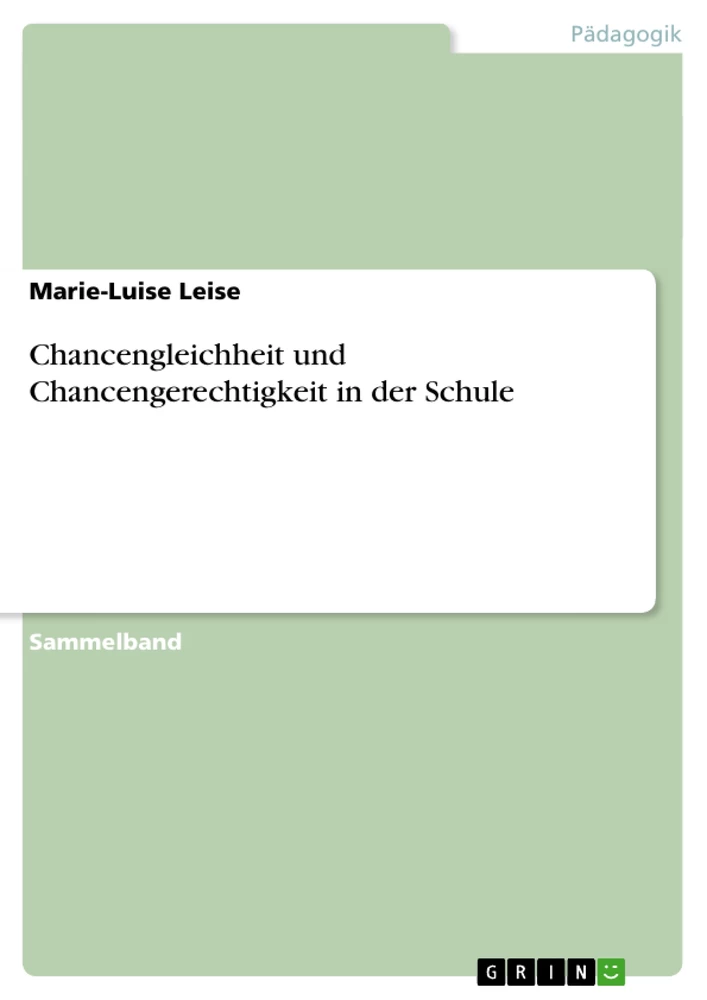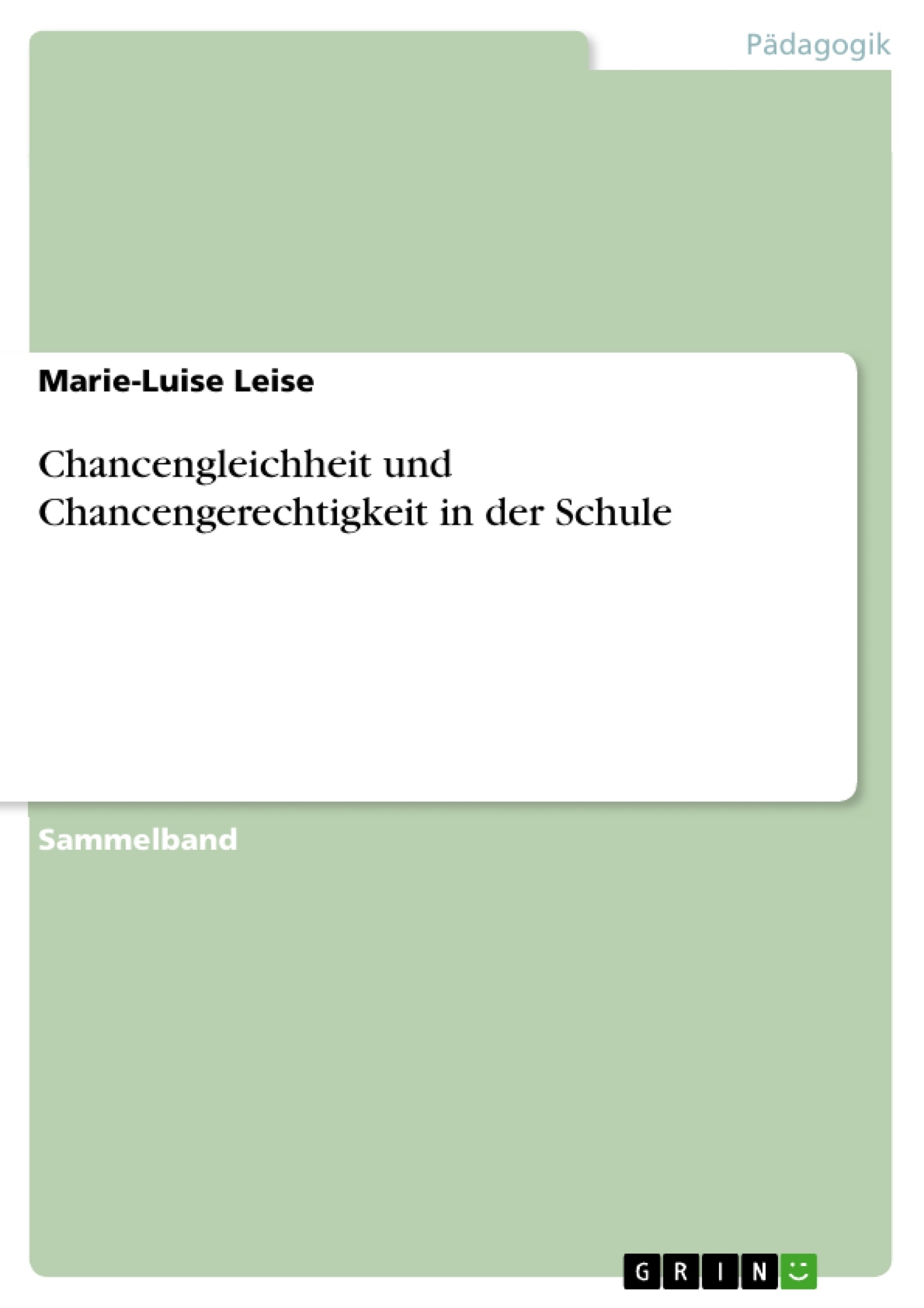Laut einer Umfrage, so kann man unter anderem auf Spiegel-Online lesen, schneidet im Urteil der Bundesbürger die Schulpolitik schlecht ab, was man an den Ergebnissen deutlich erkennen kann: Fast die Hälfte der Bevölkerung beurteilt das deutsche Bildungssystem als ungerecht. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Hierbei nannten fünfundvierzig Prozent der befragten Bürger das deutsche Bildungssystem ungerecht. Besonders negativ beurteilten Ostdeutsche das Schulsystem: sechzig Prozent bezeichneten es als eher oder sogar völlig ungerecht. Auffällig dabei ist, dass etwas mehr als die Hälfte der Eltern von Haupt- oder Gesamtschülern das deutsche Bildungssystem mehrheitlich als nicht gerecht bewerten, die geringste Ablehnung zeigten Eltern von Gymnasiasten und Realschülern mit jeweils etwa fünfundvierzig Prozent.
Eine deutliche Mehrheit ist dafür, Kinder erst später auf unterschiedliche Bildungswege zu schicken, "Nach der sechsten Klasse" als richtigen Zeitpunkt nannte knapp die Hälfte. Immerhin gut jeder Fünfte würde Schüler sogar bis zur neunten Klasse gemeinsam unterrichten lassen, wofür auch Finnland und Canada als internationaler Vergleich stehen.
Gar drei Viertel der Bundesbürger bezweifeln, dass Jugendliche aller Schichten und aus allen Kulturkreisen nach der Schule die gleichen Berufschancen haben. Eltern schulpflichtiger Kinder sind auch hier deutlich skeptischer als der Bevölkerungsdurchschnitt: sechsundachtzig Prozent glauben nicht an Chancengleichheit für sozial Schwächere und für Migrantenkinder auf dem Arbeitsmarkt. Fast neunzig Prozent der Befragten forderten, Kinder aus sozial schwachen Familien stärker individuell zu fördern, weshalb sich gut drei Viertel der Bevölkerung für den Ausbau von Ganztagsschulen aussprechen.
Seit Deutschland erstmals 2001 durch schlechte Ergebnisse bei PISA einen Schock erlebte, ist die Zukunft des Bildungssystems umstritten - vor allem die Fragen, wie es mit den Hauptschulen weitergehen soll, ob es wirklich sinnvoll ist, die Schüler bereits nach vier Jahren auf unterschiedliche Schultypen zu schicken, wie man zum traditionellen Dreigliedrigkeit des Schulsystems weiterhin stehen soll oder ob die Gesamtschule tatsächlich eine bessere Alternative sein könnte, wie viele andere Punkte, die damit zusammenhängen, gilt es zu diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitende Worte
- II. Hauptteil/Reflexionen
- 1. Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2003 und 2006: Die vier Bildungsschwellen
- 2. Schule und soziale Ungleichheit: Zum Umgang mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in Deutschland und anderen OECD-Ländern
- 3. Theoretische Klärung:
- a) Was ist Chancengleichheit?
- b) Bourdieu: Ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital
- c) Ist Chancengleichheit eine Illusion?
- 4. PISA 2000: Familiäre Lebensverhältnisse, Bildungsbeteiligung und Kompetenzerwerb im nationalen und im internationalen Vergleich
- 5. Geschlechterunterschiede in Bildungsbeteiligung, Kompetenzerwerb und Schulleistung: Sind die Mädchen oder die Jungen das benachteiligte Geschlecht?
- 6. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund: Multiple Benachteiligungen in Bildungsbeteiligung, Kompetenzerwerb und Schulleistung
- 7. Übergänge im Bildungssystem: Benachteiligungen beim Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I
- 8. Der Beitrag von Schule und Lehrern zur Reproduktion von Bildungsungleichheit
- 9. Zur doppelten Benachteiligung von Hauptschülern und Schülern aus unterprivilegierten Schichten
- 10. Offene Experteninterviews mit Lehrkräften der verschiedenen Schulformen: Präsentation der Ergebnisse
- 10. Fortsetzung: Offene Experteninterviews mit Lehrkräften Diskussion: Eine Schwellen-Konzeption der Bildungsgerechtigkeit als Lösung für das Problem der Chancengleichheit?
- 11. Versuche, der Benachteiligung durch die soziale Herkunft entgegen zu wirken: Gesamtschule, Niedersächsische Orientierungsstufe, Berufliche Gymnasien
- III. Abschließende Betrachtungen mit internationalem Vergleich (Finnland und Canada)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Portfolio untersucht die Chancengleichheit und -gerechtigkeit im deutschen Bildungssystem. Es analysiert die sozialen und ökonomischen Faktoren, die den Bildungserfolg beeinflussen, und beleuchtet die Rolle von Schule und Lehrkräften bei der Reproduktion von Bildungsungleichheit. Der internationale Vergleich mit Finnland und Kanada dient als Referenz.
- Soziale und ökonomische Ungleichheiten im Bildungssystem
- Der Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg
- Die Rolle von Schule und Lehrkräften bei der Reproduktion von Bildungsungleichheit
- Übergänge im Bildungssystem und damit verbundene Benachteiligungen
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2003 und 2006: Die vier Bildungsschwellen: Dieses Kapitel analysiert die wirtschaftliche und soziale Lage von Studierenden in Deutschland, basierend auf Sozialerhebungen von 2003 und 2006. Es identifiziert vier zentrale Bildungsschwellen – den Übergang von der Grundschule, den Übergang in die Sekundarstufe II, die Studienberechtigung und die Hochschulzulassung – und zeigt, wie soziale Herkunft diese Übergänge beeinflusst. Die Analyse verdeutlicht den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Hochschulzugang, wobei Studierende aus höherer sozialer Herkunft im Vorteil sind. Die Kapitel beleuchtet auch die finanzielle Situation von Studierenden, die oft auf mehrere Finanzierungsquellen angewiesen sind, und wie die finanzielle Situation mit der sozialen Herkunft zusammenhängt.
Schule und soziale Ungleichheit: Zum Umgang mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in Deutschland und anderen OECD-Ländern: Das Kapitel befasst sich mit der Frage, wie Schulen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen von Schülern umgehen, und vergleicht den deutschen Ansatz mit dem anderer OECD-Länder. Es wird analysiert, inwiefern das deutsche Schulsystem soziale Ungleichheiten reproduziert oder abmildert. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und Lösungsansätzen im Umgang mit sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit im Bildungskontext.
Theoretische Klärung: a) Was ist Chancengleichheit? b) Bourdieu: Ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital c) Ist Chancengleichheit eine Illusion?: Dieses Kapitel liefert eine theoretische Fundierung des Themas Chancengleichheit. Es definiert den Begriff Chancengleichheit und diskutiert Bourdieus Kapitaltheorie (ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) im Kontext von Bildung. Kritisch wird hinterfragt, ob Chancengleichheit im Bildungssystem überhaupt realisierbar ist, oder ob es sich um eine Illusion handelt.
PISA 2000: Familiäre Lebensverhältnisse, Bildungsbeteiligung und Kompetenzerwerb im nationalen und im internationalen Vergleich: Der Fokus liegt hier auf den Ergebnissen der PISA-Studie 2000, die den Einfluss familiärer Lebensverhältnisse auf Bildungsbeteiligung und Kompetenzerwerb beleuchtet. Das Kapitel analysiert die Ergebnisse im nationalen und internationalen Vergleich und zeigt auf, wie familiäre Faktoren Bildungsungleichheit verstärken können.
Geschlechterunterschiede in Bildungsbeteiligung, Kompetenzerwerb und Schulleistung: Sind die Mädchen oder die Jungen das benachteiligte Geschlecht?: In diesem Kapitel werden die Geschlechterunterschiede im Bildungssystem analysiert. Es wird untersucht, ob und inwiefern Mädchen oder Jungen benachteiligt sind, und welche Faktoren zu diesen Unterschieden beitragen. Die Analyse umfasst Bildungsbeteiligung, Kompetenzerwerb und Schulleistung.
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund: Multiple Benachteiligungen in Bildungsbeteiligung, Kompetenzerwerb und Schulleistung: Das Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem. Es werden multiple Benachteiligungen in Bildungsbeteiligung, Kompetenzerwerb und Schulleistung analysiert und die Ursachen dieser Benachteiligungen beleuchtet.
Übergänge im Bildungssystem: Benachteiligungen beim Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I: Dieser Abschnitt untersucht die Übergänge im Bildungssystem und die damit verbundenen Benachteiligungen, insbesondere den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I. Es wird analysiert, wie Entscheidungen in diesem Übergang soziale Ungleichheiten reproduzieren und welche Faktoren die Chancen der Schüler beeinflussen.
Der Beitrag von Schule und Lehrern zur Reproduktion von Bildungsungleichheit: Hier wird die Rolle von Schule und Lehrkräften bei der Reproduktion von Bildungsungleichheit untersucht. Es werden Mechanismen und Prozesse analysiert, durch die das Schulsystem soziale Ungleichheiten verstärkt oder aufrechterhält.
Zur doppelten Benachteiligung von Hauptschülern und Schülern aus unterprivilegierten Schichten: Das Kapitel behandelt die spezifischen Herausforderungen und Benachteiligungen von Hauptschülern und Schülern aus unterprivilegierten Schichten. Es beleuchtet die Ursachen der doppelten Benachteiligung und deren Auswirkungen auf den weiteren Bildungsweg.
Offene Experteninterviews mit Lehrkräften der verschiedenen Schulformen: Präsentation der Ergebnisse / Fortsetzung: Offene Experteninterviews mit Lehrkräften Diskussion: Eine Schwellen-Konzeption der Bildungsgerechtigkeit als Lösung für das Problem der Chancengleichheit?: Diese Kapitel präsentieren die Ergebnisse offener Experteninterviews mit Lehrkräften verschiedener Schulformen. Die Interviews untersuchen die Perspektiven der Lehrkräfte zur Chancengleichheit und -gerechtigkeit im Bildungssystem und diskutieren eine mögliche Schwellen-Konzeption der Bildungsgerechtigkeit.
Versuche, der Benachteiligung durch die soziale Herkunft entgegen zu wirken: Gesamtschule, Niedersächsische Orientierungsstufe, Berufliche Gymnasien: Das Kapitel analysiert verschiedene Ansätze zur Bekämpfung der Benachteiligung durch soziale Herkunft, wie z.B. Gesamtschulen, die niedersächsische Orientierungsstufe und berufliche Gymnasien, und evaluiert deren Effektivität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Chancengleichheit und -gerechtigkeit im deutschen Bildungssystem. Sie analysiert soziale und ökonomische Faktoren, die den Bildungserfolg beeinflussen, und beleuchtet die Rolle von Schule und Lehrkräften bei der Reproduktion von Bildungsungleichheit. Ein internationaler Vergleich mit Finnland und Kanada dient als Referenz.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf soziale und ökonomische Ungleichheiten im Bildungssystem, den Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg, die Rolle von Schule und Lehrkräften bei der Reproduktion von Bildungsungleichheit, Übergänge im Bildungssystem und damit verbundene Benachteiligungen sowie Möglichkeiten zur Verbesserung der Chancengleichheit.
Welche Daten und Methoden werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Daten aus Sozialerhebungen (z.B. zu Studierenden 2003 und 2006), die PISA-Studie 2000 und offene Experteninterviews mit Lehrkräften verschiedener Schulformen. Die Analysemethoden umfassen quantitative und qualitative Ansätze.
Wie wird die soziale Herkunft im Bildungssystem berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht, wie soziale Herkunft den Bildungserfolg beeinflusst, indem sie die vier Bildungsschwellen (Grundschule, Sekundarstufe II, Studienberechtigung, Hochschulzulassung) analysiert und den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Hochschulzugang beleuchtet. Die finanzielle Situation von Studierenden und deren Zusammenhang mit der sozialen Herkunft wird ebenfalls betrachtet.
Welche Rolle spielen Schule und Lehrer bei der Bildungsungleichheit?
Die Arbeit analysiert, wie Schule und Lehrkräfte zur Reproduktion von Bildungsungleichheit beitragen. Sie untersucht Mechanismen und Prozesse, durch die das Schulsystem soziale Ungleichheiten verstärkt oder aufrechterhält. Die Experteninterviews mit Lehrkräften liefern Einblicke in deren Perspektiven zur Chancengleichheit.
Wie werden Geschlechterunterschiede im Bildungssystem berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert Geschlechterunterschiede in Bildungsbeteiligung, Kompetenzerwerb und Schulleistung und untersucht, ob und inwiefern Mädchen oder Jungen benachteiligt sind und welche Faktoren zu diesen Unterschieden beitragen.
Wie werden die Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die spezifischen Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem und analysiert multiple Benachteiligungen in Bildungsbeteiligung, Kompetenzerwerb und Schulleistung.
Welche Lösungsansätze zur Verbesserung der Chancengleichheit werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Ansätze zur Bekämpfung der Benachteiligung durch soziale Herkunft, wie Gesamtschulen, die niedersächsische Orientierungsstufe und berufliche Gymnasien, und evaluiert deren Effektivität. Die Diskussion einer Schwellen-Konzeption der Bildungsgerechtigkeit wird ebenfalls einbezogen.
Welchen internationalen Vergleich bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet einen internationalen Vergleich mit Finnland und Kanada, um die Situation im deutschen Bildungssystem zu kontextualisieren und alternative Ansätze zu beleuchten.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit verwendet Bourdieus Kapitaltheorie (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital) als theoretische Grundlage und diskutiert kritisch die Frage, ob Chancengleichheit im Bildungssystem überhaupt realisierbar ist.
- Quote paper
- Marie-Luise Leise (Author), 2008, Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114329