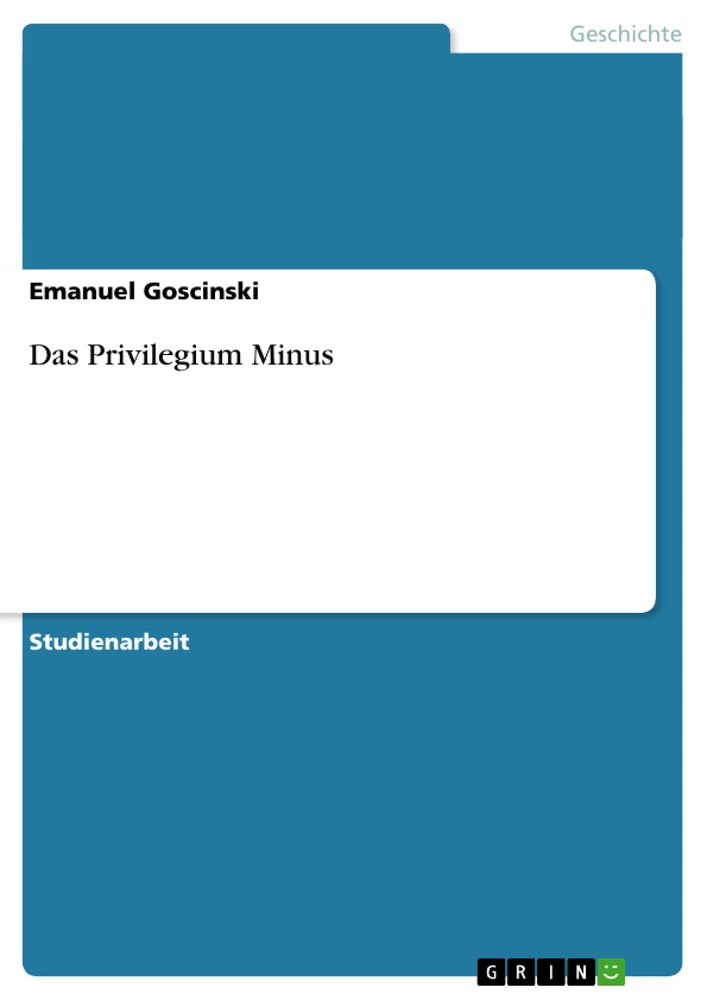(...) Bis 1944 befasste sich die Forschung hauptsächlich mit den Fragen der Echtheit, vor allem die Interpolationsthese von Erben wurde heiß diskutiert: Es wurd vermutet, dass der Passus von der Heeres- und Hoffahrtsfolge und die sogenannte libertas affectandi nachträglich in die Urkunde eingefügt wurden. 1944 erschien ein Aufsatz von Heilig, der die Echtheit des Privilegium minus endgültig bewies, der aber, nach Meinung von Heinrich Appelt, die Bestimmungen der Urkunde zu sehr auf byzantinische Rechtsanschauungen zurückführt. Wobei erwähnt werden muss, dass die Echtheit der Urkunde eigentlich schon fast hundert Jahre früher durch die Forschung Julius Fickers1 bewiesen wurde, der in seinem Aufsatz Argumente zeigt, die auch heute noch gültig sind. Leider konnte er seine Zeitgenossen damit nicht vollends überzeugen.
Neuere Projekte beschäftigten sich mit der verfassungsrechtlichen und vandesgeschichtlichen Bedeutung des Privilegium minus, wie zum Beispiel die Forschung von Theodor Mayer oder Karl Lechner. Aber auch die Bemühungen Erich Zöllners über die genealogischen Hintergründe brachten interessante Ergebnisse ans Licht. Die Arbeit von Heinrich Fichtenau über die Überlieferungsgeschichte der Urkunde wird höchstens gestreift werden, da sie die hier angestrebte Interpretation der Urkunde und ihrer Entstehungsumstände nur tangiert.
Diese Arbeit wird vor allem zeigen, dass das Privilegium minus in dem Umfang seiner Privilegien und den Bestimmungen selbst eine sehr außergewöhnliche Urkunde ist, was sich jedoch vollständig durch die besondere Situation erklärt, in der sie entstanden ist. Außerdem wird aufgezeigt werden, dass sämtliche Bestimmungen nicht etwa für diese Urkunde erfunden werden mussten, sondern dass es für alle Vorläufer gab, die sich sogar im engsten Umfeld der Beteiligten fanden.
Es gilt zunächst festzustellen, welche Umstände zur Ausstellung dieser Urkunde geführt haben. Sowohl die Situation im deutschen Reich als auch in Österreich war eine besondere.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte der Urkunde
- Der Streit um Bayern
- Der Hoftag zu Regensburg und der Bericht Ottos von Freising
- Die Bestimmungen des Privilegium minus
- Herzogwürde
- Die Erbfolgebestimmungen
- Weibliche Erbfolge und Doppelbelehnung
- Libertas affectandi
- Heeres- und Hoftagsfolge
- Gerichtsbarkeit
- Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
- Quellen
- Wissenschaftliche Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Privilegium minus, einem Freiheitsbrief für Österreich aus dem Jahr 1156. Ziel ist es, die Entstehung und Bedeutung des Privilegium minus im Kontext des staufisch-welfischen Thronstreits zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Bestimmungen des Privilegium minus und untersucht deren verfassungsrechtliche und vandesgeschichtliche Bedeutung.
- Der staufisch-welfische Thronstreit und die Rolle des Privilegium minus
- Die Bestimmungen des Privilegium minus und deren verfassungsrechtliche Bedeutung
- Die vandesgeschichtliche Bedeutung des Privilegium minus für Österreich
- Die Echtheit des Privilegium minus und die Forschung dazu
- Die Entstehungsumstände des Privilegium minus im Kontext der politischen Situation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung des Privilegium minus für die Forschung. Sie beleuchtet die Geschichte der Forschung und die verschiedenen Thesen zur Echtheit des Dokuments. Die Vorgeschichte der Urkunde wird im zweiten Kapitel behandelt, wobei der Streit um Bayern zwischen den Welfen und Staufern im Vordergrund steht. Das dritte Kapitel analysiert die Bestimmungen des Privilegium minus, darunter die Herzogwürde, die Erbfolgebestimmungen, die Heeres- und Hoftagsfolge sowie die Gerichtsbarkeit. Die Ergebnisse der Arbeit werden im vierten Kapitel zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Privilegium minus, den staufisch-welfischen Thronstreit, die Geschichte Österreichs, die Verfassungsgeschichte, die vandesgeschichtliche Bedeutung, die Echtheit der Urkunde, die Bestimmungen des Privilegium minus, die Erbfolgebestimmungen, die Heeres- und Hoftagsfolge, die Gerichtsbarkeit, die Forschung zum Privilegium minus, die Entstehungsumstände des Privilegium minus, die politische Situation im 12. Jahrhundert.
- Arbeit zitieren
- Emanuel Goscinski (Autor:in), 2005, Das Privilegium Minus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114368