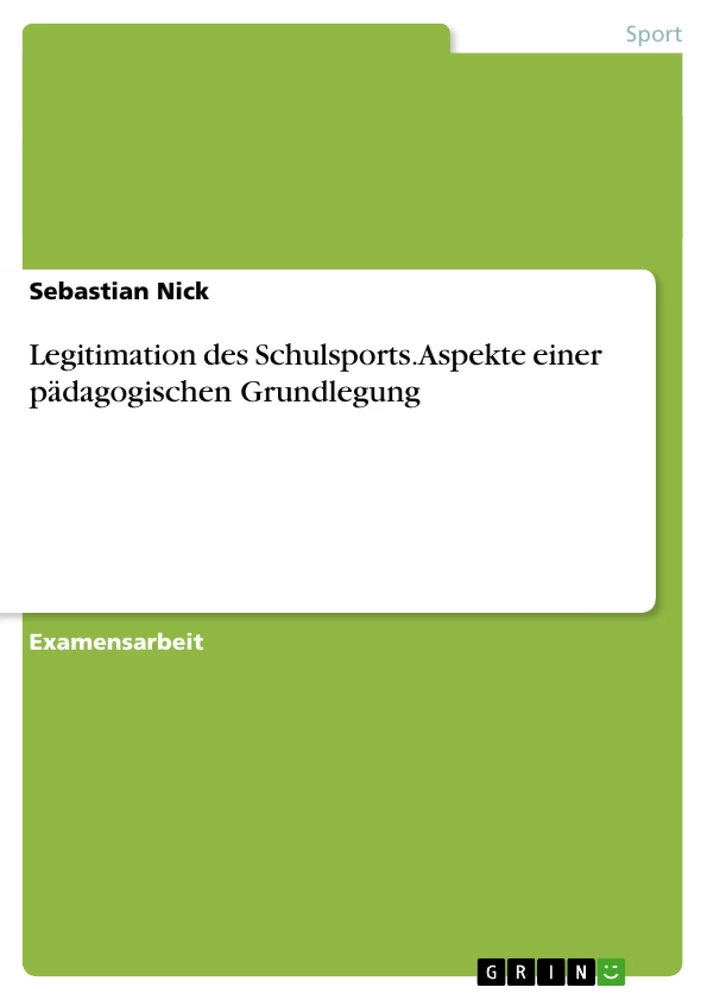Schulen sind staatliche oder zumindest staatlich kontrollierte Erziehungsinstitutionen, deren Besuch für Jugendliche im Alter von ca. 6-18 Jahren Pflicht ist.
Die vorherrschende Form der Erziehung in der Schule ist die des Unterrichts, welcher in Fächern erteilt wird. Ein Fach unter vielen ist der Sport. Sowohl die Einbindung des Faches Sport in den Fächerkanon der Schule, als auch der curriculare Umfang stehen derzeit infrage. Trotz vielfacher Proteste von Seiten der Sportlehrerschaft, der Sportpädagogik, der Sportwissenschaft und des organisierten Sports, wurde in zahlreichen Bundesländern die Flexibilisierung der Stundentafeln eingefordert und die dritte Pflichtstunde Sport, beispielsweise im Saarland und in Bayern, abgeschafft.
Sämtliche Fragen, Bemühungen und Vorgänge der letzten Jahrzehnte, die den Sport betreffen und diesen hinterfragen, haben eines gemeinsam: Sie fragen nach der Legitimation des Sports. Doch wie lässt sich das Unterrichtsfach Sport im aktuellen Fächerkanon und auch für die Zukunft hinreichend begründen? Welchen Formen sportlicher Erziehung sehen wir uns heute gegenüber? Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. Dabei wird versucht, den Sport nicht nur um seiner selbst willen zu begründen, sondern vielmehr seine Bedeutung für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen herauszuarbeiten. Mit den Mitteln der Textforschung werden bildungspolitische und (sport)didaktische Argumente gesammelt, die eine Legitimation des Schulsports hinsichtlich einer zeitgemäßen pädagogischen Grundlegung ermöglichen sollen. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt im Bereich erziehungstheoretischer und didaktischer Aussagen. Diese Aussagen beziehen sich im Wesentlichen auf die Bedingungen und Möglichkeiten der erzieherischen Gestaltung des Sports in der Schule, also auf den pädagogischen Auftrag des Faches und nicht auf die konkrete methodische Umsetzung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Terminus „Legitimation“
- Bildungspolitische Initiativen und ihre Forderungen
- Rahmenkonzepte für den Schulsport
- Lehrplan Hessen und Nordrhein-Westfalen - Rahmenvorgaben für das Unterrichtsfach Sport in den Jahrgangsstufen 5-10
- Die Instrumentalisierungsdebatte
- Der Instrumentalisierungsvorwurf
- Der Widerspruch
- Anforderungen an einen zeitgemäßen Sport
- Fachdidaktische Entwicklungen
- Vorschlag für ein zeitgemäßes Konzept - Aufwertung des erzieherischen Anspruchs
- Die Bedeutung der pädagogischen Perspektiven
- Das Konzept eines erziehenden Sportunterrichts (nach Neumann)
- Grundlagen und Perspektiven
- Die Bedeutungsvielfalt eines erziehenden Unterrichts
- Erziehender Unterricht aus sportdidaktischer Sicht
- Die Mehrperspektivität als didaktisches Prinzip eines erziehenden Sportunterrichts
- Zur Genese und Bedeutung eines mehrperspektivischen Unterrichts
- Die Bedeutung der Mehrperspektivität nach Ehni
- Die Bedeutung der Mehrperspektivität nach Kurz
- Zur näheren Konturierung eines perspektivischen Zugangs zum Sportunterricht
- Sportunterricht und sein Beitrag zum Schulleben
- Der außerunterrichtliche Schulsport
- Die Idee einer bewegten Schule
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Fazit
- Ausblick
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Legitimation des Schulsports und untersucht die pädagogischen Grundlagen, die eine zeitgemäße Begründung für das Unterrichtsfach Sport ermöglichen. Die Arbeit analysiert aktuelle bildungspolitische Initiativen und Lehrpläne, um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen des Schulsports zu beleuchten.
- Die Instrumentalisierungsdebatte im Schulsport
- Die Entwicklung eines zeitgemäßen Sportunterrichtskonzepts
- Die Bedeutung erziehungstheoretischer und didaktischer Perspektiven im Sportunterricht
- Das Konzept eines erziehenden Sportunterrichts nach Neumann
- Der Beitrag des Sportunterrichts zum Schulleben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Legitimation des Schulsports ein und stellt die Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die aktuelle Situation des Sportunterrichts in Deutschland und die Notwendigkeit einer pädagogischen Grundlegung.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Begriffsbestimmung des Terminus „Legitimation“. Es werden verschiedene Perspektiven auf den Begriff beleuchtet und die Relevanz für die Legitimation des Schulsports herausgestellt.
Kapitel drei analysiert aktuelle bildungspolitische Initiativen und Lehrpläne, die sich mit dem Schulsport befassen. Es werden die Rahmenkonzepte für den Schulsport sowie die Lehrpläne von Hessen und Nordrhein-Westfalen im Detail betrachtet.
Kapitel vier widmet sich der Instrumentalisierungsdebatte im Schulsport. Es werden der Instrumentalisierungsvorwurf und die Gegenargumente diskutiert.
Kapitel fünf beschäftigt sich mit den Anforderungen an einen zeitgemäßen Sportunterricht. Es werden fachdidaktische Entwicklungen und ein Vorschlag für ein zeitgemäßes Konzept vorgestellt, das den erzieherischen Anspruch des Sportunterrichts stärkt.
Kapitel sechs stellt das Konzept eines erziehenden Sportunterrichts nach Neumann vor. Es werden die Grundlagen und Perspektiven dieses Konzepts sowie die Bedeutung der Mehrperspektivität als didaktisches Prinzip erläutert.
Kapitel sieben untersucht den Beitrag des Sportunterrichts zum Schulleben. Es werden der außerunterrichtliche Schulsport und die Idee einer bewegten Schule beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Legitimation des Schulsports, die pädagogische Grundlegung, die Instrumentalisierungsdebatte, die Entwicklung eines zeitgemäßen Sportunterrichtskonzepts, die Bedeutung erziehungstheoretischer und didaktischer Perspektiven im Sportunterricht, das Konzept eines erziehenden Sportunterrichts nach Neumann, der Beitrag des Sportunterrichts zum Schulleben, die Idee einer bewegten Schule und der außerunterrichtliche Schulsport.
Häufig gestellte Fragen
Warum steht die Legitimation des Schulsports derzeit in der Kritik?
In vielen Bundesländern wurde die Stundentafel flexibilisiert und Pflichtstunden gekürzt, was die Frage aufwirft, welchen bildungstheoretischen Stellenwert Sport im Vergleich zu anderen Fächern hat.
Was ist der Kern der „Instrumentalisierungsdebatte“?
Es wird diskutiert, ob Sport im Schulsport nur als Mittel zum Zweck (z.B. für Gesundheit oder Disziplin) instrumentalisiert wird oder ob er einen eigenständigen pädagogischen Wert besitzt.
Was bedeutet „Mehrperspektivität“ im Sportunterricht?
Es ist ein didaktisches Prinzip (nach Ehni und Kurz), bei dem Sport unter verschiedenen Gesichtspunkten wie Leistung, Gesundheit, Kooperation oder Körpererfahrung vermittelt wird.
Was beinhaltet das Konzept des „erziehenden Sportunterrichts“ nach Neumann?
Das Konzept betont den pädagogischen Auftrag des Faches, Kinder und Jugendliche durch Sport in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Bildung zu fördern.
Was versteht man unter einer „bewegten Schule“?
Dies ist die Idee, Bewegung nicht nur auf das Fach Sport zu beschränken, sondern als festen Bestandteil in das gesamte Schulleben und den außerunterrichtlichen Bereich zu integrieren.
- Quote paper
- Sebastian Nick (Author), 2008, Legitimation des Schulsports. Aspekte einer pädagogischen Grundlegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114434