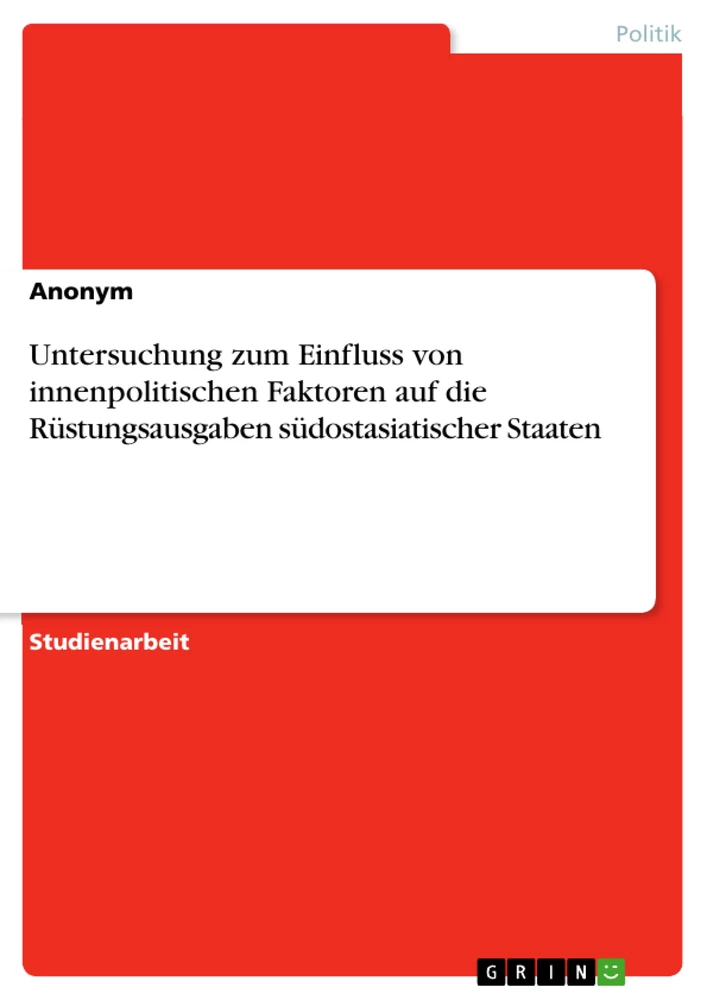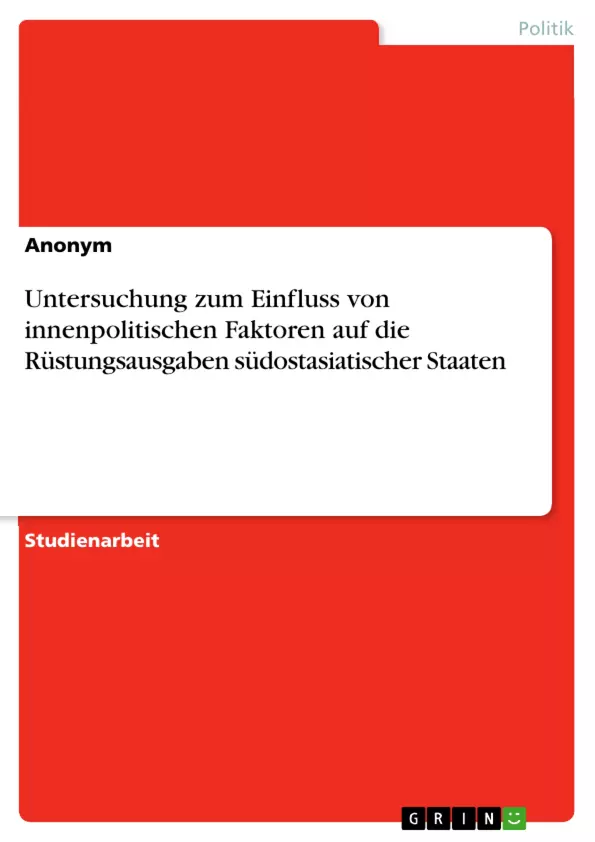Inwiefern haben innenpolitische Faktoren Einfluss auf die Rüstungsausgaben unterschiedlicher Staaten?
Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden im Rahmen einer Sekundäranalyse die Daten von acht südostasiatischen Staaten (hier: Indonesien, Malaysia, Kambodscha, Philippinen, Myanmar, Vietnam, Thailand und Singapur) analysiert und ausgewertet. Mit der Vielzahl der ausgewählten Fälle soll einerseits sichergestellt werden, dass eine Verzerrung der Ergebnisse ausgeschlossen werden kann, andererseits die Heterogenität in Südostasien angemessen abgebildet wird. Der mögliche Einfluss von innenpolitischen Faktoren auf die Rüstungsausgaben der genannten Staaten wird auf Basis zuvor formulierter Hypothesen mit dem Ziel untersucht, ob eine Beeinflussung vorliegt und wenn ja, wie diese ausgeprägt ist. Das Ergebnis der Analyse ist, dass innenpolitische Faktoren zur Erhöhung bzw. Minderung der Rüstungsausgaben in den untersuchten Staaten führen können.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abstract
- Theoretischer Hintergrund der Begrifflichkeiten
- Stand der Forschung
- Herleitung der Hypothesen
- Methodisches Vorgehen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss innenpolitischer Faktoren auf die Rüstungsausgaben südostasiatischer Staaten. Die steigenden Rüstungsausgaben in der Region, trotz Fokus auf außenpolitische Erklärungen, motivieren die Untersuchung. Die Forschungsfrage lautet: Inwiefern beeinflussen innenpolitische Faktoren die Rüstungsausgaben verschiedener Staaten?
- Analyse des Begriffs „Rüstungsausgaben“ und dessen unterschiedliche Definitionen.
- Untersuchung des Einflusses innenpolitischer Faktoren auf die Rüstungsausgaben.
- Sekundäranalyse von Daten aus acht südostasiatischen Staaten.
- Bewertung der Heterogenität in Südostasien und Vermeidung von Ergebnisverzerrungen.
- Formulierung und Überprüfung von Hypothesen zur Beeinflussung der Rüstungsausgaben.
Zusammenfassung der Kapitel
Abstract: Der Abstract beschreibt den stetigen Anstieg der weltweiten, insbesondere der südostasiatischen Rüstungsausgaben und benennt die Forschungsfrage nach dem Einfluss innenpolitischer Faktoren auf diese. Er skizziert die Methodik der Sekundäranalyse von Daten aus acht südostasiatischen Staaten und kündigt das Ergebnis an, dass innenpolitische Faktoren sowohl zur Erhöhung als auch zur Minderung der Ausgaben führen können. Die hohe Relevanz der Thematik wird durch den Hinweis auf den starken Anstieg der Rüstungsausgaben in der Region in den letzten zehn Jahren unterstrichen.
Theoretischer Hintergrund der Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel analysiert den mehrdeutigen Begriff „Rüstungsausgaben“ und vergleicht verschiedene Definitionen, etwa von SIPRI und der NATO. Es zeigt die unterschiedliche Breite der Begriffsbestimmungen auf, die von „Militärausgaben“ (SIPRI) bis zu den umfassenderen „Verteidigungsausgaben“ (NATO) reichen. Die Uneinheitlichkeit wird durch die Analyse der Definition von „Rüstungsgütern“ durch das BMWi verdeutlicht, welche eine detaillierte Auflistung verschiedener Waffensysteme und militärischer Technologien beinhaltet. Die Kapitel verdeutlicht die Herausforderungen bei der vergleichenden Analyse von Rüstungsausgaben aufgrund der unterschiedlichen Definitionen und legt den Grundstein für die einheitliche Anwendung des Begriffs in der Studie.
Schlüsselwörter
Rüstungsausgaben, Südostasien, Innenpolitik, Militärausgaben, Verteidigungsausgaben, Sekundäranalyse, SIPRI, NATO, BMWi, Hypothesenprüfung, Heterogenität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss innenpolitischer Faktoren auf die Rüstungsausgaben südostasiatischer Staaten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss innenpolitischer Faktoren auf die Rüstungsausgaben südostasiatischer Staaten. Die steigenden Rüstungsausgaben in der Region, trotz des Fokus auf außenpolitische Erklärungen in bisherigen Studien, bilden die Motivation für diese Forschungsarbeit.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern beeinflussen innenpolitische Faktoren die Rüstungsausgaben verschiedener Staaten in Südostasien?
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit beinhaltet eine Analyse des Begriffs "Rüstungsausgaben" und seiner verschiedenen Definitionen, die Untersuchung des Einflusses innenpolitischer Faktoren auf die Rüstungsausgaben, eine Sekundäranalyse von Daten aus acht südostasiatischen Staaten, die Bewertung der Heterogenität in Südostasien zur Vermeidung von Ergebnisverzerrungen und die Formulierung und Überprüfung von Hypothesen zur Beeinflussung der Rüstungsausgaben.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Sekundäranalyse von Daten aus acht südostasiatischen Staaten. Die Auswahl der Staaten und die Datenquellen werden im Kapitel "Methodisches Vorgehen" detailliert beschrieben.
Wie wird der Begriff "Rüstungsausgaben" definiert?
Das Kapitel "Theoretischer Hintergrund der Begrifflichkeiten" analysiert den mehrdeutigen Begriff "Rüstungsausgaben" und vergleicht verschiedene Definitionen von Organisationen wie SIPRI, NATO und dem BMWi. Es werden die Unterschiede zwischen "Militärausgaben" und "Verteidigungsausgaben" herausgearbeitet und die Herausforderungen bei der vergleichenden Analyse aufgrund dieser unterschiedlichen Definitionen beleuchtet.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Sekundäranalyse von Daten. Die genauen Datenquellen und -sätze werden im Literaturverzeichnis und im Kapitel "Methodisches Vorgehen" spezifiziert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rüstungsausgaben, Südostasien, Innenpolitik, Militärausgaben, Verteidigungsausgaben, Sekundäranalyse, SIPRI, NATO, BMWi, Hypothesenprüfung, Heterogenität.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit (laut Abstract)?
Der Abstract deutet an, dass innenpolitische Faktoren sowohl zur Erhöhung als auch zur Minderung der Rüstungsausgaben in Südostasien beitragen können. Der stetige Anstieg der Rüstungsausgaben in der Region in den letzten zehn Jahren unterstreicht die Relevanz der Thematik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu: Abkürzungsverzeichnis, Abstract, Theoretischer Hintergrund der Begrifflichkeiten, Stand der Forschung, Herleitung der Hypothesen, Methodisches Vorgehen und Literaturverzeichnis.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Untersuchung zum Einfluss von innenpolitischen Faktoren auf die Rüstungsausgaben südostasiatischer Staaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1144698