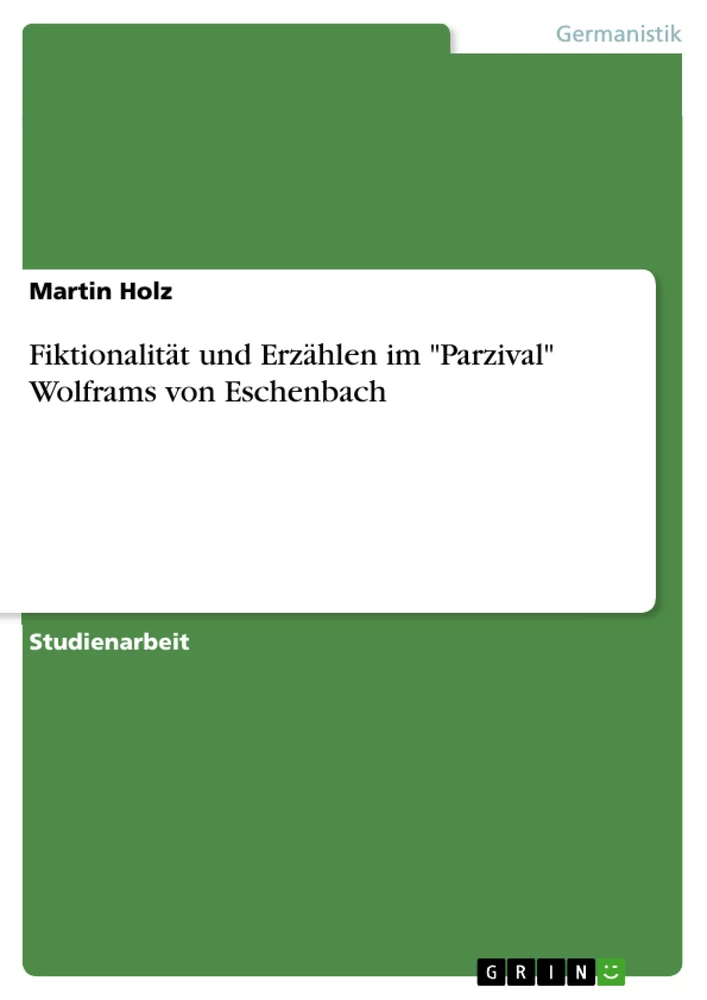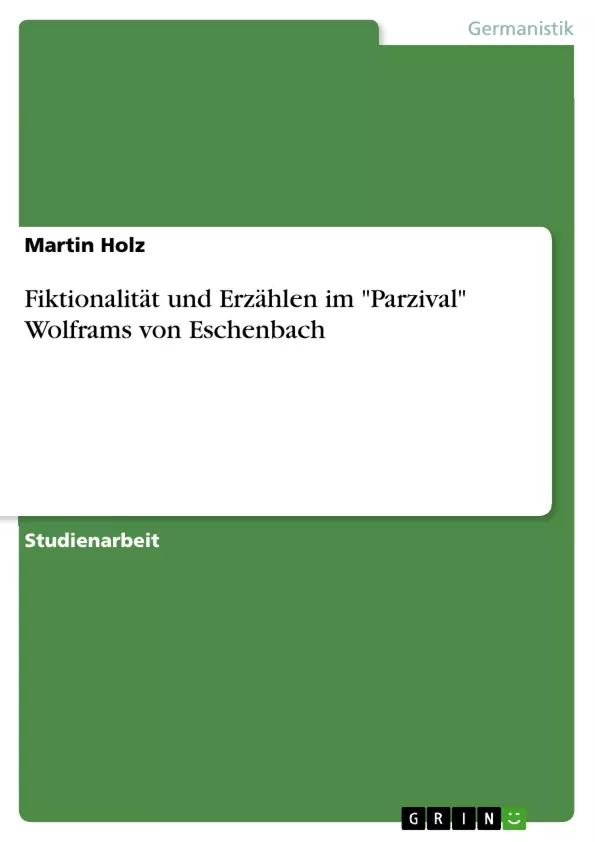Dem Roman der Moderne und Postmoderne sind als ihm exklusiv
zukommende Merkmale Metafiktionalität, Autoreflexivität und
Intertextualität attestiert worden. Bereits eine kursorische Lektüre von
Wolframs Parzival genügt, um diese Phänomene auch für einen
mittelalterlichen Text - man mag ihn nun als Artusroman, als höfischen
Roman oder als höfisches Epos bezeichnen - in einem Grade
nachzuweisen, der frappiert und insofern einer Erklärung bedarf. Dabei
fallen insbesondere diverse Kommunikationsprozesse ins Auge: Der Erzähler
adressiert mehrfach das Publikum, spricht andere Autoren an,
unterhält sich mit allegorischen Figuren (vrou minne, vrou witze und vrou
âventiure), stellt poetologische Reflexionen an, die er en passant oder auch
engagiert dem Rezipienten mitteilt, und inszeniert fortwährend sowohl
diesen Kommunikationskomplex als auch sich selbst und sein Erzählen.1
Dadurch verändert er den Fiktionalitätsgehalt des Werks, irritiert den
Leser bzw. Hörer kontinuierlich, posiert, kokettiert mit seiner
vermeintlichen Inkompetenz und relativiert etliche Aussagen.2 Die
Komponente des Spiels ist evident, jedoch kommen ein taktischer und ein
epistemischer Aspekt hinzu. Das "Koordinatensystem aus Erzählmaske
und Erzählhaltung"3 dient, so meine erste These, weniger einer
Etablierung der Epik gegenüber dem Minnesang4 als vielmehr dazu, das
Publikum in einen intellektuellen Agon zu verwickeln und zugleich eine
Reflexion zu initiieren, die das Problem der Wahrheit und potentiell auch
das der Autorkonstitution zum Gegenstand hat.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- A. Wolfram und die fiktionale Inszenierung von Kommunikationsprozessen
- B. Die erzählerische Modellierung des maere
- I. Die Identität des Erzähler-Ichs
- II. Die Dichotomie von ordo naturalis und ordo artificialis
- III. Die rezeptionsästhetische Dimension von Dramaturgie und Erzählstil
- 1. Der implizite Rezipient
- 2. Reflexion, Erkenntnis und Desillusionierung
- C. Fiktion vs. Wahrheit und das Problem der Lüge
- I. Instanzen der Wahrheit
- 1. vrou Âventiure
- 2. Kyot
- 3. Das Publikum
- II. Dimensionen der Intertextualität
- III. res factae, res fictae und das integumentum
- I. Instanzen der Wahrheit
- D. "Den Vorhang zu und alle Fragen offen"
- âventiure meine'
- was ist der
- âventiure meine'
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die fiktionalen Aspekte von Wolframs Parzival, insbesondere die Inszenierung von Kommunikationsprozessen, die Modellierung des Erzählens und die Frage nach Wahrheit und Lüge im Text. Sie untersucht, wie Wolfram die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verwischt und den Leser in einen intellektuellen Dialog verwickelt.
- Die Rolle des Erzählers und seine Beziehung zum Publikum
- Die Konstruktion von Wahrheit und Lüge im Text
- Die Bedeutung von Intertextualität und Quellenberufungen
- Die ästhetische Dimension von Dramaturgie und Erzählstil
- Die Rezeption des Textes und die Rolle des impliziten Rezipienten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel A beleuchtet die fiktionale Inszenierung von Kommunikationsprozessen in Wolframs Parzival. Der Erzähler tritt als eigenständige Figur auf, die mit dem Publikum interagiert, andere Autoren anspricht und poetologische Reflexionen anstellt. Diese Kommunikationsprozesse irritieren den Leser und relativieren die Aussagen des Textes. Die Arbeit argumentiert, dass diese Inszenierung nicht nur der Etablierung der Epik gegenüber dem Minnesang dient, sondern auch dazu, das Publikum in einen intellektuellen Agon zu verwickeln und eine Reflexion über Wahrheit und Autorkonstitution zu initiieren.
Kapitel B untersucht die erzählerische Modellierung des maere. Der Erzähler entzieht sich jeder kohärenten Charakterisierung und ist weder eine Figur auf der Handlungsebene noch der Autor Wolfram. Die Arbeit analysiert die Identität des Erzählers, seine Beziehung zum Publikum und die Bedeutung von Quellenberufungen. Sie argumentiert, dass der Erzähler eine eigenständige Figur ist, die vom Autor konstruiert wurde, um die Grenzen zwischen Fiktion und Realität zu verwischen und den Leser in den Text zu integrieren.
Kapitel C befasst sich mit dem Problem der Wahrheit und Lüge im Parzival. Die Arbeit analysiert verschiedene Instanzen der Wahrheit im Text, wie z.B. die vrou Âventiure, Kyot und das Publikum. Sie untersucht die Dimensionen der Intertextualität und die Rolle von res factae, res fictae und dem integumentum. Die Arbeit argumentiert, dass Wolfram die Frage nach Wahrheit und Lüge bewusst offen lässt und den Leser dazu anregt, selbstständig zu interpretieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Fiktionalität, Erzählen, Parzival, Wolfram von Eschenbach, Kommunikation, Wahrheit, Lüge, Intertextualität, Rezeption, Dramaturgie, Erzählstil, Autor, Erzähler, Publikum, integumentum, ordo naturalis, ordo artificialis.
Häufig gestellte Fragen
Was macht Wolframs „Parzival“ in Bezug auf Fiktionalität so besonders?
Schon im Mittelalter nutzt Wolfram Techniken wie Metafiktionalität und Autoreflexivität, die man sonst eher aus der Moderne kennt. Er spricht das Publikum direkt an und unterhält sich mit allegorischen Figuren.
Welche Rolle nimmt der Erzähler im „Parzival“ ein?
Der Erzähler tritt als eigenständige Maske auf, die kokettiert, Irritation stiftet und das Publikum in einen intellektuellen Dialog verwickelt, statt nur eine lineare Geschichte zu erzählen.
Wie wird das Thema Wahrheit und Lüge im Text behandelt?
Wolfram verwischt die Grenzen zwischen Fiktion (res fictae) und Wahrheit (res factae). Durch fiktive Quellenberufungen (z.B. Kyot) fordert er den Leser heraus, den Wahrheitsgehalt selbst zu reflektieren.
Wer ist „vrou Âventiure“?
Sie ist eine allegorische Figur, mit der der Erzähler kommuniziert. Sie steht für die Personifizierung der Erzählung selbst und dient als Instanz der Wahrheit innerhalb des fiktionalen Raums.
Was bedeutet Intertextualität im Kontext dieser Arbeit?
Intertextualität bezeichnet die Bezüge Wolframs zu anderen Autoren und Werken seiner Zeit, wodurch er seinen eigenen Text in ein Netzwerk aus literarischen Traditionen einbettet.
- Quote paper
- Dr. Martin Holz (Author), 1999, Fiktionalität und Erzählen im "Parzival" Wolframs von Eschenbach, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114555