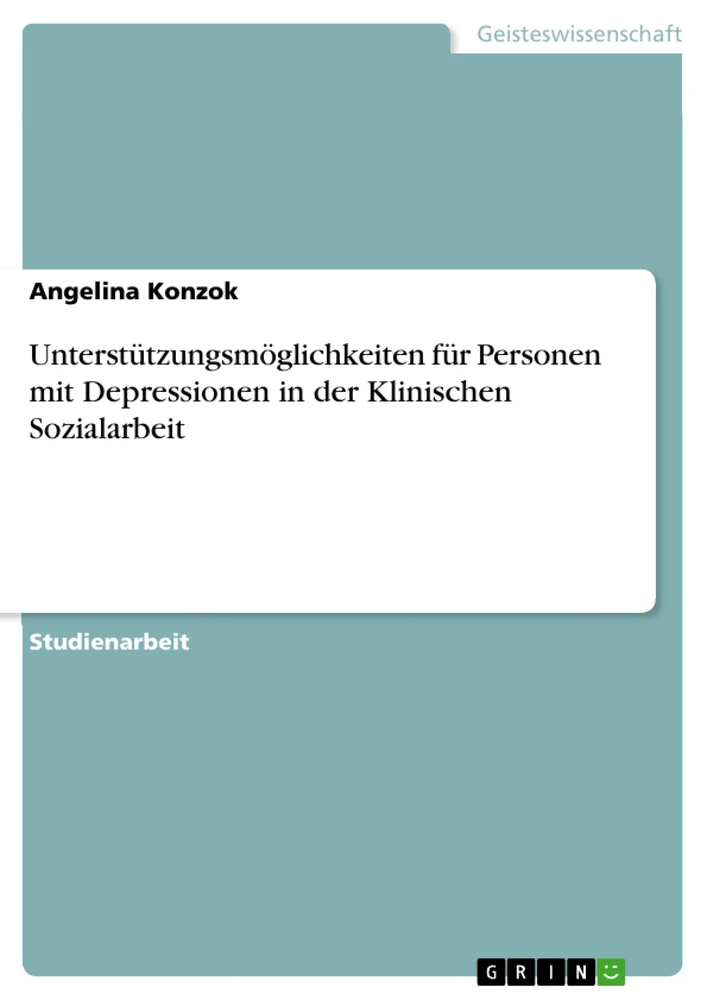In dieser Hausarbeit soll insbesondere auf die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten in der Klinischen Sozialarbeit im Zusammenhang mit Klienten*innen, die an einer Depression leiden, eingegangen werden. Oftmals werden Depressionen unmittelbar mit einer Psychotherapie assoziiert. Daher ist es die Absicht dieser Hausarbeit, aufzuzeigen, dass Sozialarbeiter*innen einen Großteil ähnlicher Unterstützungsmöglichkeiten anbieten und so eine mögliche Alternative zu einem Psychologen*in darstellen können. Da in der heutigen Zeit immer wieder auf den Mangel von Psychologen*innen und das gleichzeitige Ansteigen von psychischen Erkrankungen hingewiesen wird, ist das Ziel dieser Hausarbeit, alternative Unterstützungsangebote durch klinische Sozialarbeiter*innen im therapeutischen und beratenden Umgang mit psychisch erkrankten Menschen zu erläutern und ebenso die damit einhergehenden Ziele und Schwierigkeiten darzulegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klinische Sozialarbeit
- Definition
- Geschichte in Deutschland
- Depressionen
- Definition
- Differenzierung zwischen den verschiedenen Krankheitsbildern
- Symptome und Verlauf
- Umgang Klinischer Sozialarbeit mit depressiven Personen
- Aufgaben
- Angebote
- Ziele
- Schwierigkeiten
- Klinische Sozialarbeit und psychotherapeutische Behandlung im Vergleich
- Zusammenfassung/ Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Unterstützungsmöglichkeiten der Klinischen Sozialarbeit für Klient*innen mit Depressionen. Sie beleuchtet die Rolle der Klinischen Sozialarbeit als alternative Unterstützungsform zur Psychotherapie, insbesondere vor dem Hintergrund des wachsenden Mangels an Psychologen*innen und der steigenden Anzahl psychischer Erkrankungen. Die Arbeit zielt darauf ab, alternative Unterstützungsangebote im therapeutischen und beratenden Umgang mit psychisch erkrankten Menschen durch Klinische Sozialarbeiter*innen zu erläutern, sowie die damit verbundenen Ziele und Herausforderungen aufzuzeigen.
- Definition und Aufgaben der Klinischen Sozialarbeit
- Die Entwicklung und Geschichte der Klinischen Sozialarbeit in Deutschland
- Das Krankheitsbild der Depression: Definition, Symptome und Verlauf
- Unterstützungsmöglichkeiten in der Klinischen Sozialarbeit bei Depressionen
- Vergleich zwischen klinisch-sozialem und psychotherapeutischem Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung und die Zielsetzung der Hausarbeit vor, wobei der Fokus auf die Unterstützungsmöglichkeiten in der Klinischen Sozialarbeit für Klient*innen mit Depressionen liegt. Kapitel 2 definiert den Begriff der Klinischen Sozialarbeit und beschreibt ihre Entwicklung in Deutschland, während Kapitel 3 einen Überblick über die Definition, Differenzierung zu anderen Krankheitsbildern sowie Symptome und Verlauf von Depressionen bietet. Das Kapitel 4 widmet sich den Unterstützungsmöglichkeiten der Klinischen Sozialarbeit bei Depressionen, inklusive der Darstellung der Aufgaben, Angebote, Ziele und Schwierigkeiten. Schließlich beleuchtet Kapitel 4.5 den Vergleich zwischen einem psychotherapeutischen und einem psychosozialen Beratungsansatz eines Sozialarbeiters*in.
Schlüsselwörter
Klinische Sozialarbeit, Depression, psychische Erkrankungen, Unterstützungsmöglichkeiten, psychotherapeutische Behandlung, sozial-psychiatrische Rehabilitation, Case Management, Person-in-Environment, psychosoziale Beratung.
- Citation du texte
- Angelina Konzok (Auteur), 2021, Unterstützungsmöglichkeiten für Personen mit Depressionen in der Klinischen Sozialarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1145917