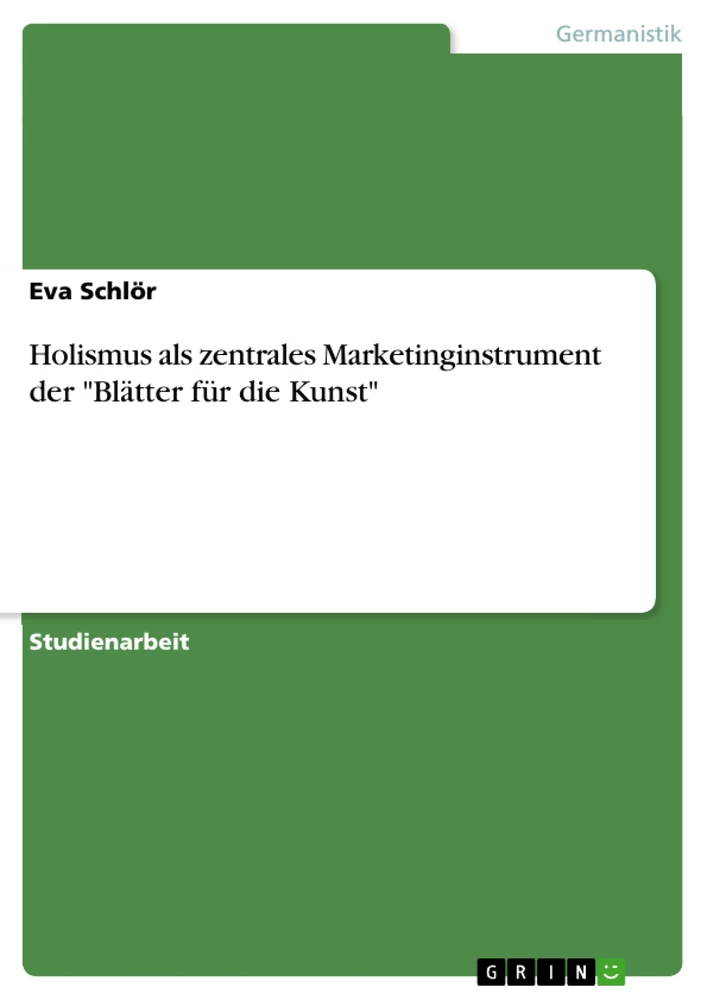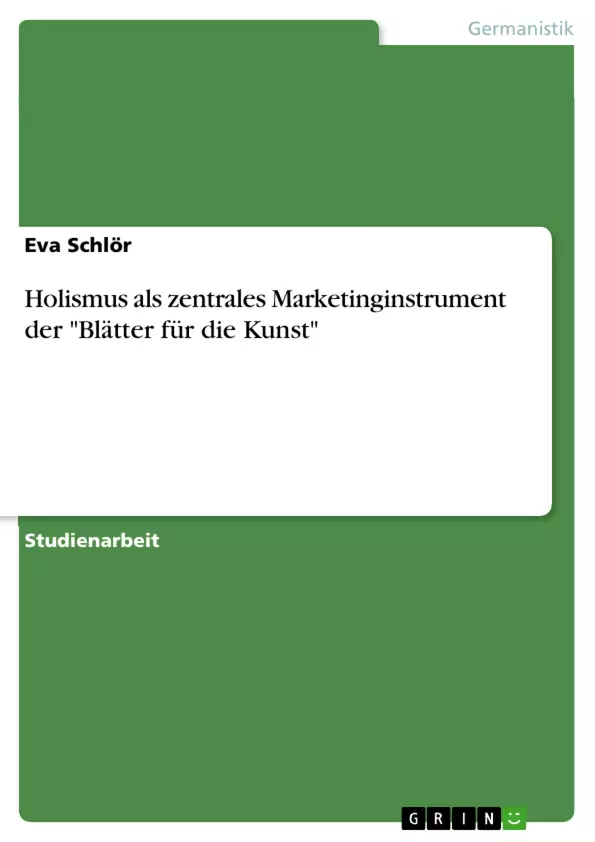„Von Marketing verstand dieser Verächter des Marktes einiges“
(Breuer 1995: S. 135)
Seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre erfreut sich sowohl das Werk
als auch die Person Stefan Georges eines nie da gewesenen Interesses.
Gerade die Widersprüche, die sich dabei auftun (wie der anfangs
zitierte von Breuer), machen die Angelegenheit spannend. Höhepunkt
des Interesses war vorerst die 2007 erschienene erste umfassende
Biographie von Thomas Karlauf. Auch wenn daran etliches zu
kritisieren ist – wie beispielsweise die Überbewertung der
Homosexualität als Motivation für Georges Beziehung zu Hugo von
Hofmannsthal – so darf sie doch als Meilenstein gewertet werden.
Trotz der zunehmenden Anzahl an Publikationen sehen wir uns mit
einer schwierigen Quellenlage konfrontiert, da es immer wieder
dieselben wenigen Quellen sind, die als Basistexte verwendet werden.
Sie zitieren einander gegenseitig und dadurch geht notwendigerweise
Transparenz verloren. Unser Wissen über Stefan George und den
Kreis um die Blätter für die Kunst (BfdK/Blätter) speist sich vielfach
nur aus autobiographischen Texten oder Mitteilungen des Kreises.
Aussagen Dritter, die dokumentarischen Wert hätten, sind rar. Auch
ich muss mich in dieser Arbeit häufig auf diese Quellen berufen.
Da mein Fokus jedoch auf der Interpretation des Schaffens des
Kreises im Zeichen des Holismus liegt und der Unterschied zwischen
Medium und Botschaft ohnehin verschwimmt (wie ich noch zeigen
werde) darf die problematische Quellenlage zwar nicht verschwiegen
werden, aber sie macht eine glaubhafte Arbeit unter diesen
Vorzeichen nicht unmöglich, im Gegenteil, sie stärkt meine These,
dass Holismus das entscheidende Gestaltungsprinzip und
Marketinginstruments Georges und seines Kreises war.
Gliederung:
1. Einleitung
2. Holismus als zentrales Marketinginstrument der Blätter für die Kunst
2.1. Corporate Identity
2.1.1. Corporate Profile und Corporate als Kommunikationsbasis
2.1.2. Corporate Culture
2.1.3. Corporate Design
2.1.4. Corporate ?
2.2. Werte
2.2.1. Exklusivität
2.2.2. Sublimierung
2.2.3. Strukturelle Offenheit / Tauglichkeit zur Projektion
2.3. Weitere ‘moderne’ Aspekte der Operationsweise der Blätter für die Kunst
2.3.1. Internationalität
2.3.2. Netzwerkgedanke
2.3.3. Marke/Branding
3. Schluss
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Von Marketing verstand dieser Verächter des Marktes einiges“
(Breuer 1995: S. 135)
Seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre erfreut sich sowohl das Werk als auch die Person Stefan Georges eines nie da gewesenen Interesses. Gerade die Widersprüche, die sich dabei auftun (wie der anfangs zitierte von Breuer), machen die Angelegenheit spannend. Höhepunkt des Interesses war vorerst die 2007 erschienene erste umfassende Biographie von Thomas Karlauf. Auch wenn daran etliches zu kritisieren ist – wie beispielsweise die Überbewertung der Homosexualität als Motivation für Georges Beziehung zu Hugo von Hofmannsthal – so darf sie doch als Meilenstein gewertet werden.
Trotz der zunehmenden Anzahl an Publikationen sehen wir uns mit einer schwierigen Quellenlage konfrontiert, da es immer wieder dieselben wenigen Quellen sind, die als Basistexte verwendet werden. Sie zitieren einander gegenseitig und dadurch geht notwendigerweise Transparenz verloren. Unser Wissen über Stefan George und den Kreis um die Blätter für die Kunst (BfdK/Blätter) speist sich vielfach nur aus autobiographischen Texten oder Mitteilungen des Kreises. Aussagen Dritter, die dokumentarischen Wert hätten, sind rar. Auch ich muss mich in dieser Arbeit häufig auf diese Quellen berufen.
Da mein Fokus jedoch auf der Interpretation des Schaffens des Kreises im Zeichen des Holismus liegt und der Unterschied zwischen Medium und Botschaft ohnehin verschwimmt (wie ich noch zeigen werde) darf die problematische Quellenlage zwar nicht verschwiegen werden, aber sie macht eine glaubhafte Arbeit unter diesen Vorzeichen nicht unmöglich, im Gegenteil, sie stärkt meine These, dass Holismus das entscheidende Gestaltungsprinzip und Marketinginstruments Georges und seines Kreises war.
2. Holismus als entscheidendes Marketinginstrument der Blätter für die Kunst
Grundsätze wurden mit Sorgfalt und Strenge bis ins kleinste Detail eingehalten, selbst wenn es sich „nur“ um Broschüren oder Buchverzeichnisse handelte. Auch im Kontakt zu Personen die (noch) außerhalb des Kreises um die Blätter standen, wurde nichts dem Zufall oder fremder Initiative überlassen. (vgl. Winkler 2000, S. 232) Alles wurde aufeinander abgestimmt: Produktion, Ausstattung, die Kriterien für die Auswahl der Texte, der Preis, die Auflagenhöhe, die Vertriebswege und Werbung und nicht zuletzt die Auswahl der Leser. (vgl. Mettler 1979, S. 11) Dies war leicht möglich, da nur wenige Personen, nämlich George, der als Herausgeber fungierende C.A. Klein und der Buchkünstler Melchior Lechter, am Herausgabeprozess beteiligt waren. Das Maß, in dem dieselben Prinzipien aber auf alle Prozesse (und nicht nur die, die in direktem Zusammenhang mit den BfdK standen) angewendet wurde, suggeriert jedoch eine bewusste Anwendung. Dass sich George durchaus dem Effekt von Werbung bewusst war, darauf lässt seine Reaktion auf ein Pamphlet gegen seine Person schließen:
„Besseres ist als Propaganda gar nicht denkbar. Das würde ich bezahlen, wenn’s die Leute nicht umsonst täten.“ (Landmann 1963: S. 94)
(…) lässt Georges Absicht erkennen, einen Mittelweg zwischen ästhetischem Niveau (dem ‘wie’) und dem Schreiben für eine Öffentlichkeit finden zu wollen. Auch wenn er vorgab, keinen Erfolg nötig zu haben, suchte er ihn. Er entwickelte deswegen Publikationsstrategien, die die Vorgehensweise des zeitgenössischen Literaturbetriebs an Subtilität letztlich übertrafen. (Roos 2000: S. 71)
Begünstigend wirkte die Tatsache, dass der Symbolismus – dem Stefan George neben Vertretern wie Albert Verwey, Gabriele d’Annunzio und William Butler Yeats zugerechnet wird – an sich eine alle Ebenen durchdringende, holistische Kunstrichtung ist. Stefan George orientierte sich stark an den französischen Vorbildern. Klussmann und andere vermuten, dass er auch den Namen „Blätter für die Kunst“ den „Écrits pour l’Art“ von René Ghil nachempfunden hat. Im Symbolismus ist die Kunst nicht mehr nur Ausdrucksmittel, sondern nun auch Thema. Beliebte Stoffe sind der Akt des Schaffens, das Wesen der Kunst sowie die Mittel des Handwerks. Nicht nur das „Was“ zählte, sondern mehr und mehr das „Wie“ und manche Symbolisten hinterließen mehr kritische und ästhetische Schriften als poetische. (vgl. Kayser 1981, S. 49f.)
Andere sehen die Vorbilder der BfdK in der englischen Art-and- Crafts-Bewegung. Auch diese zeichnet sich durch Holismus aus: In dieser Tradition war der Buchkünstler beispielsweise nicht nur für die Gestaltung des Buches, sondern für den gesamten Produktionsprozess verantwortlich. Vom Schöpfen des Papiers an lag alles in seiner Hand.
Die Idee einer gemeinschaftlichen Lebens- und Kunstproduktion war um 1900 aktuell und verbreitet, nach dem Vorbild der englischen Handwerkergilden der arts-and-crafts-Bewegung organisierten sich beispielsweise viele Jugendstil- künstler im sezessionistischen Werkstätten-Verbund.
(Blasberg 2000: S. 122)
Mit Sicherheit war nicht exklusiv die französische oder die englische Tradition Inspiration, sondern beide zu einem gewissen Anteil.
Aber nicht nur Veröffentlichungen und Schaffenspraxis sind durch ein höheres Prinzip geeint, auch die Gruppe zeichnet sich durch Holismus aus: „Die Blätter formulieren das Programm einer holistischen Gruppe, die sich selbst höher schätzt als die Individualität ihrer Mitglieder.“ (vgl. Kaiser 2004: S. 67) Darin unterscheidet sich die Blätter -Gruppe von anderen literarischen Vereinigungen wie dem Friedrichshagener Dichterkreis oder den Berliner Naturalisten, deren Zielsetzungen eine zwanglos gesellige Literaturdiskussion, die Publikation neuer Kunstprogramme oder politische Agitation waren. Die Vereinigung existierte um die Visibilität zu erhöhen, aber die Unabhängigkeit des Einzelnen stand außer Frage. Anders bei dem Kreis um die BfdK: sowohl die Anhänger des Kreises als auch Leben und Werk der einzelnen zeichnen sich durch extreme Homogenität aus:
Generalnenner der zahllosen Schilderungen Georges und seiner Anhänger ist die Kongruenz von “Wesen, Leben und Lehre”, der Verzicht auf variierende Rollen und Identitäten, der – im Urteil der Schülerschaft – George als absolutes Gegenbild zur Gegenwart insgesamt empfiehlt, insbesondere aber zur Boheme, zum bloßen Ästhetizismus, dem letztlich egoistischen Leben einer von falscher Toleranz beherrschten Gesellschaft.” (Kaiser 2004: S. 157) Die Person war das Werk, und das Werk die Person.
2.1. Corporate Identity
Auch in modernen Marketingstrategien wird eine holistische Darstellung der Unternehmen und Konzerne angestrebt, d.h. der Eindruck wird forciert, dass die gleichen Grundsätze und Werte auf allen Ebenen und in allen Bereichen Anwendung finden. Als Garant dafür soll in modernen Unternehmen die sog. Corporate Identity dienen.
Der Begriff der „Corporate Identity“ ist seit Anfang der 70er Jahre im Gebrauch und bezeichnet die „Unternehmensleitlinien“. (Leu 1992: S.7), auch wenn man sich für das Image und die Imagebildung einer Unternehmung schon seit den 50er Jahren interessierte.
Eine Corporate Identity ist die Persönlichkeit eines Unternehmens. In Parallele zur Ich-Identität wird die Corporate Identity als schlüssiger Zusammenhang von Erscheinung, Taten und Worten eines Unternehmens gesehen. Spezifischer ausgedrückt: vom Unternehmens-Erscheinungsbild, Unternehmens-Verhalten und der Unternehmens-Kommunikation als manifestiertes Selbstverständnis des Unternehmens. (Leu 1992: S. 14.)
Die Definition nach Birkigt/Statdler:
Corporate Identity ist die strategisch geplante und operativ eingesetzte Selbstdarstellung und Verhaltensweise eines Unternehmens nach innen und nach außen auf Basis einer festgelegten Unternehmensphilosophie, einer langfristigen Unternehmenszielsetzung und eines definierten (Soll-) Images – mit dem Willen, alle Handlungsinstreumente des Unternehmens in einheitlichem Rahmen nach innen und außen zur Darstellung zu bringen.
(Birkigt/Stadtler 1993: S. 18)
Gundolf spricht von einer für George typischen „Durchbildung des ganzen sinnlichen Da-Seins, von der Idee bis zur Kleidung herab.“ (vgl. Gundolf 1921: S. 42) Bartels nennt dies die „’corporate identity’ von Dichter, Werk und Lebensstil“ (Bartels 2007: S.28). In diesem Zusammenhang ist der Begriff „Corporate Identity“ jedoch meiner Ansicht nach irreführend, da er sich nur auf eine Person (George) bezieht. Die „Parallele zur Ich-Identität“, die Leu in seiner Definition als grundlegend erklärt, wird zur Tautologie wenn es sich bereits um eine Ich-Identität handelt.
Kern einer Corporate Identity können sowohl Werte („Corporate Values“ sein; vgl. 2.2) als auch eine Emotion, ein Slogan, ein Stil, oder häufig all dies zusammen.
Auch George sucht nach einem Kern seiner Arbeit, seines Werkes, seiner Identität, sei sie nun corporate oder nicht.
Er selbst sann lange über jede Zeile eines Gedichtes schweigsam und konzentriert nach, nachdem er das, was er Grundvers nannte, gefunden hatte, und begann meist mit der Niederschrift erst dann, wenn schon das Ganze in ihm Form gewonnen hatte.
(Morwitz: Kommentar zum Werk Stefan Georges. Zitiert nach: Durzak 1968: S. 22f)
Es bleibt nun zu klären, worin der „Grundvers“, das vereinende Element, der Kern der Corporate Identity der Blätter -Gruppe bestand. Kolk schlägt die Melancholie als verbindende Emotion vor.
Die literarischen Insignien der Melancholie (…) können als seine Losung dieser Assoziation gelten, verstärken jene corporate identity, von der die moderne Werbepsychologie sich Verkaufserfolge erhofft. (Kolk 1998: S. 60)
Kaiser unterstellt den BfdK die Absenz eines bindenden Elements und der Kompensation dessen durch eine negative Identität, d.h. eine Kritik an den gegenwärtigen Verhältnissen. „Das programmatische Selbstverständnis der BfdK leistet für die Formierung einer stabilen Gruppe zunächst eine Problemidentifikation.“
Schließlich erweisen sich die poetologischen Texte der Blätter vielfach einer Strategie der Euphemisierung unterworfen, die das Distinktionsinteresse der Gruppe durch den Rekurs auf die Notwendigkeit verdeckt, die allgemeine Misere der Kunst und des geistigen Lebens in Deutschland zu beheben.
(beide Zitate: Kaiser 2004: S. 124f.)
Emotionen und Werte als verbindende Elemente des Kreises um die
BfdK sind m.E. vorhanden, eine klare Botschaft jedoch nicht.
Ob man den Inhalt dieser Botschaft nun als negativ oder als nicht vorhanden bezeichnet, gemeinsam ist beiden, dass sie Raum für Interpretation und Projektion lassen. Darauf werde ich in 2.2.5 („Strukturelle Offenheit“) zurückkommen.
2.1.1. Corporate Profile und Corporate Personality als Kommunikationsbasis
Im Folgenden werde ich auf die Kommunkationsstrategien des BfdK - Kreises eingehen, die wiederum Ausdruck der Corporate Identity sind und zu dem erheblichen Erfolg maßgeblich beigetragen haben.
Organisation der Kommunikation
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieses Textes über die "Blätter für die Kunst"?
Der Fokus liegt auf der Interpretation des Schaffens des Kreises um die "Blätter für die Kunst" im Zeichen des Holismus. Es wird argumentiert, dass Holismus das entscheidende Gestaltungsprinzip und Marketinginstrument von Stefan George und seinem Kreis war.
Welche Rolle spielt der Holismus im Kontext der "Blätter für die Kunst"?
Holismus wird als zentrales Marketinginstrument der "Blätter für die Kunst" dargestellt. Dies zeigt sich in der sorgfältigen und strengen Einhaltung von Grundsätzen bis ins kleinste Detail, der Abstimmung von Produktion, Ausstattung, Textauswahl, Preis, Auflage, Vertriebswegen und Leserauswahl.
Was wird unter Corporate Identity im Zusammenhang mit Stefan George und den "Blätter für die Kunst" verstanden?
Der Text untersucht, inwiefern das Konzept der Corporate Identity, normalerweise auf Unternehmen angewendet, auf die Person Stefan George und den Kreis um die "Blätter für die Kunst" übertragbar ist. Es wird diskutiert, ob ein Kern, ein vereinendes Element oder eine gemeinsame Botschaft in ihrer Arbeit existierte.
Welche Elemente der Corporate Identity werden untersucht?
Der Text untersucht verschiedene Elemente der Corporate Identity, einschließlich Corporate Profile, Corporate Personality, Werte (wie Exklusivität und Sublimierung), strukturelle Offenheit und Internationalität. Auch Netzwerkgedanke und Branding werden betrachtet.
Welche Rolle spielte der Symbolismus in der Arbeitsweise von Stefan George und den "Blätter für die Kunst"?
Der Symbolismus wird als eine alle Ebenen durchdringende, holistische Kunstrichtung dargestellt, die Stefan George beeinflusste. Im Symbolismus ist die Kunst nicht nur Ausdrucksmittel, sondern auch Thema, was die Bedeutung des "Wie" neben dem "Was" betont.
Welche anderen Bewegungen könnten die "Blätter für die Kunst" beeinflusst haben?
Neben dem französischen Symbolismus wird auch die englische Art-and-Crafts-Bewegung als mögliche Inspirationsquelle genannt, die sich ebenfalls durch Holismus auszeichnete.
Wie unterschied sich die Gruppe um die "Blätter für die Kunst" von anderen literarischen Vereinigungen?
Die Gruppe zeichnete sich durch Holismus aus, wobei die Gemeinschaft höher geschätzt wurde als die Individualität ihrer Mitglieder. Dies unterscheidet sie von anderen Vereinigungen, deren Zielsetzungen eher zwanglos gesellige Literaturdiskussionen oder politische Agitation waren.
Welche Kommunikationsstrategien wurden von der Gruppe eingesetzt?
Die Gruppe trat meist geschlossen auf, aber die Autoren rezensierten gegenseitig ihre Bücher, um eine Neutralität zu suggerieren, die de facto nie existierte. Dies wird als Aspekt der organisierten Kommunikation und des Netzwerkgedankens betrachtet.
Was wird über die Quellenlage in Bezug auf Stefan George und die "Blätter für die Kunst" gesagt?
Die Quellenlage wird als schwierig beschrieben, da häufig dieselben wenigen Quellen verwendet werden, was die Transparenz beeinträchtigen kann. Es wird jedoch argumentiert, dass die problematische Quellenlage die These, dass Holismus das entscheidende Gestaltungsprinzip war, nicht unmöglich macht, sondern eher stärkt.
- Quote paper
- Eva Schlör (Author), 2008, Holismus als zentrales Marketinginstrument der "Blätter für die Kunst", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114601