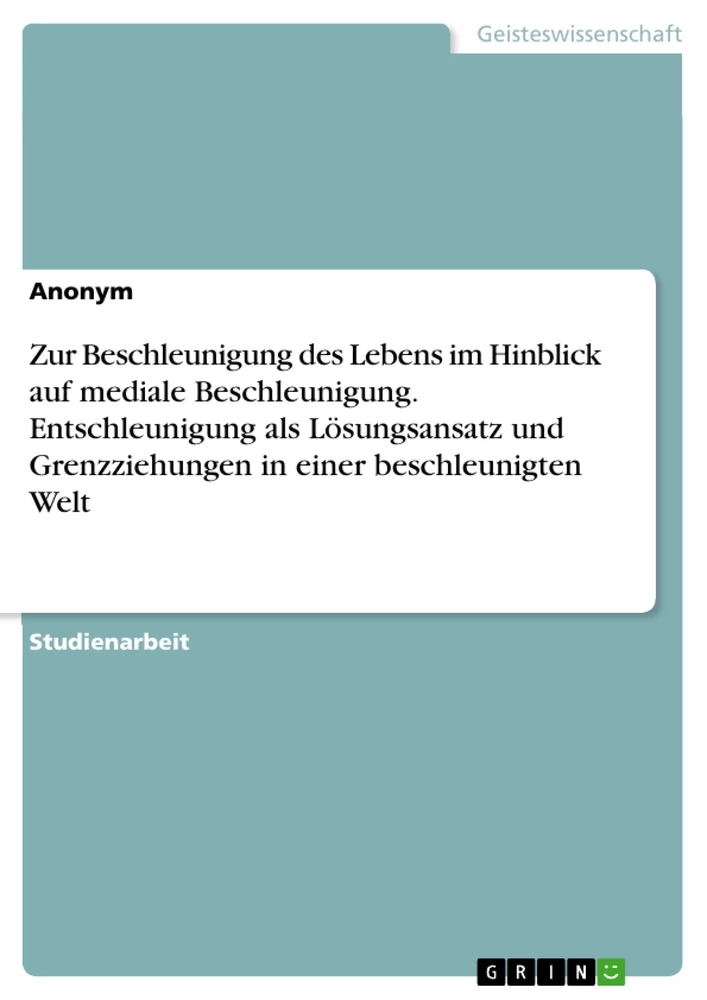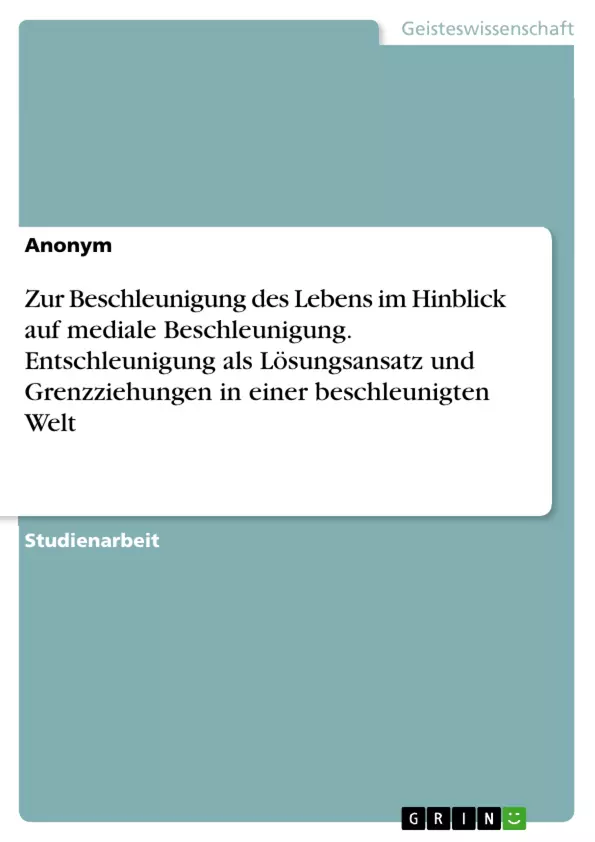In der vorliegenden Hausarbeit soll versucht werden, dem Phänomen der medialen Beschleunigung und der medialen Permanenz eine mögliche Lösung, nämlich die der Entschleunigung, entgegenzustellen. Dabei soll zunächst auf den Begriff der Zeit eingegangen werden und dieser in die Kontexte Gesellschaft und Medien gesetzt werden. Des Weiteren soll der Aspekt des permanenten Online-Seins erörtert werden. Diese Abhandlungen führen im Darauffolgenden zu einer Abhandlung des Phänomens der Beschleunigung. Der Begriff der Beschleunigung soll anhand des Resonanz-Konzeptes von Harmut Rosa verdeutlicht und erläutert werden. Auch wird der Begriff der Beschleunigung in den Kontext der Medien gesetzt [mediale Beschleunigung]. Dabei soll versucht werden, mögliche Konsequenzen permanenter medialer Beschleunigung beziehungsweise Permanenz zu formulieren.
Als möglicher Lösungsansatz soll im darauffolgenden zunächst der Begriff der Entschleunigung dienen. Es werden zudem lösungsorientierte Grenzziehungen formuliert, die dem Individuum in einer beschleunigten Welt eine Möglichkeit bieten, der medialen Permanenz zu entkommen. Am Ende des Kapitels zur Entschleunigung soll dann der Begriff der Entschleunigung als Möglichkeit zur Lösung und Gegenkonzept zur Beschleunigung, diskutiert und in Frage gestellt werden.
Im Kapitel "Konsequenzen ziehen – Der Kapitalismus muss sich ändern" werden Schlussfolgerungen aus dem bereits Erörterten formuliert. Dazu wird auf einen Diskussionsbeitrag mit Hartmut Rosa und Stephan Lessenich zum Thema "Der Kapitalismus muss sich ändern" eingegangen. Dieser formuliert konsequente Wandlungsmöglichkeiten bezüglich des Schnellerwerdens einer kapitalistischen Gesellschaft und bezieht klar Stellung. Im Fazit sollen alle Erkenntnisse gebündelt noch einmal zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Zum Begriff der Zeit
- Gesellschaft und Zeit
- Medien und Zeit
- Eine permanente Internetverbindung - ständig online
- Zum Begriff der Beschleunigung
- Resonanz bei Hartmut Rosa
- Beschleunigung und Medien
- Zum Begriff der Entschleunigung
- Medienspezifische Grenzziehungen in einer beschleunigten Welt
- Zwischenfazit: Entschleunigung als Lösung?
- Konsequenzen ziehen - Der Kapitalismus muss sich ändern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der medialen Beschleunigung und der medialen Permanenz und untersucht die Entschleunigung als möglichen Lösungsansatz. Sie analysiert zunächst den Begriff der Zeit im Kontext von Gesellschaft und Medien und beleuchtet das permanente Online-Sein. Daraufhin werden die Aspekte der Beschleunigung und deren Auswirkungen im medialen Kontext erörtert.
- Das Zeitverständnis und die Auswirkungen der medialen Beschleunigung auf den Lebensalltag
- Die Rolle der Medien im Prozess der Beschleunigung und die Folgen für das Individuum
- Die Entschleunigung als Gegenkonzept und mögliche Strategien zur Bewältigung der medialen Permanenz
- Die Kritik am Kapitalismus und die Notwendigkeit einer Veränderung im Hinblick auf Beschleunigung und Entschleunigung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorwort
Die Arbeit stellt das Thema der medialen Beschleunigung und der Entschleunigung als Gegenkonzept vor. Es wird der Fokus auf den Begriff der Zeit und dessen Bedeutung in Gesellschaft und Medien gelegt. Der Aspekt des permanenten Online-Seins wird ebenfalls beleuchtet.
2. Zum Begriff der Zeit
Das Kapitel analysiert den Begriff der Zeit und dessen Bedeutung im gesellschaftlichen und medialen Kontext. Es werden verschiedene Zeitmaßstäbe und das lineare Zeitbewusstsein in der modernen Gesellschaft erläutert. Zudem wird die Bedeutung der Uhr als Taktgeber des Lebens und die Herausforderungen der Zeitnot in der heutigen Zeit beleuchtet.
2.1 Gesellschaft und Zeit
Dieses Kapitel widmet sich der Zeitstruktur und der Zeitmessung in der westlichen Gesellschaft. Es werden die Bedeutung der Uhr und der daraus resultierenden "Zeitdisziplin" sowie die Herausforderungen der Zeitnot und der Suche nach Eigenzeit in einer hochkomplexen Gesellschaft diskutiert.
2.2 Medien und Zeit
Dieser Abschnitt beleuchtet die Rolle der Medien im Kontext der Zeit. Der Einfluss der Medien auf das Zeitverständnis und die Erfahrung von Zeit wird beleuchtet. Dabei wird auch auf das Phänomen des permanenten Online-Seins eingegangen.
2.3 Eine permanente Internetverbindung - ständig online
Dieser Abschnitt analysiert die Auswirkungen des ständigen Online-Seins auf das Zeitbewusstsein und die Lebensführung des Individuums. Die Folgen dieser permanenten Vernetzung für die Zeitstruktur des Alltags werden diskutiert.
3. Zum Begriff der Beschleunigung
Dieses Kapitel führt den Begriff der Beschleunigung ein und erörtert dessen Bedeutung im Kontext der Gesellschaft und der Medien. Es wird das Konzept der Resonanz von Hartmut Rosa vorgestellt und die Auswirkungen der medialen Beschleunigung auf das Individuum analysiert.
3.1 Resonanz bei Hartmut Rosa
Dieser Abschnitt präsentiert das Konzept der Resonanz von Hartmut Rosa und beleuchtet die Bedeutung von Resonanz für das Individuum. Die Auswirkungen der Beschleunigung auf die menschliche Resonanz werden untersucht.
3.2 Beschleunigung und Medien
Dieses Kapitel analysiert die mediale Beschleunigung und ihre Folgen für die menschliche Erfahrung von Zeit und Raum. Die Auswirkungen der medialen Beschleunigung auf das Zeitbewusstsein und die Lebensführung des Individuums werden untersucht.
4. Zum Begriff der Entschleunigung
Das Kapitel untersucht die Entschleunigung als mögliches Gegenkonzept zur Beschleunigung. Es werden medienspezifische Grenzziehungen vorgestellt, die dem Individuum helfen können, der medialen Permanenz zu entkommen. Die Frage, ob die Entschleunigung tatsächlich eine Lösung für die Probleme der Beschleunigung darstellt, wird diskutiert.
4.1 Medienspezifische Grenzziehungen in einer beschleunigten Welt
Dieser Abschnitt präsentiert verschiedene Strategien und Methoden, um in einer beschleunigten Welt medienspezifische Grenzziehungen zu schaffen. Es werden konkrete Beispiele für die Entschleunigung im medialen Kontext diskutiert.
4.2 Zwischenfazit: Entschleunigung als Lösung?
In diesem Abschnitt wird die Frage nach der Wirksamkeit der Entschleunigung als Gegenkonzept zur Beschleunigung diskutiert. Die Möglichkeiten und Grenzen der Entschleunigung als Lösungsansatz werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Zeit, Beschleunigung, Entschleunigung, Medien, Resonanz, Kapitalismus, Zeitdisziplin, mediale Permanenz, Grenzziehung. Die Kernthemen der Arbeit sind die Auswirkungen der medialen Beschleunigung auf das menschliche Leben, die Suche nach Entschleunigung als Gegenkonzept und die Kritik am Kapitalismus als Motor der Beschleunigung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter medialer Beschleunigung?
Mediale Beschleunigung beschreibt die zunehmende Geschwindigkeit der Informationsvermittlung und das Phänomen der permanenten Internetverbindung ("ständig online").
Wie definiert Hartmut Rosa den Begriff der Beschleunigung?
Rosa verknüpft Beschleunigung mit dem Konzept der Resonanz. Er analysiert, wie das Schnellerwerden der Gesellschaft die Fähigkeit des Individuums beeinträchtigt, in Resonanz mit der Welt zu treten.
Ist Entschleunigung eine wirksame Lösung für den Zeitdruck?
Die Arbeit diskutiert Entschleunigung als Gegenkonzept, stellt aber auch in Frage, ob individuelle Maßnahmen ausreichen, wenn die systemischen Ursachen im Kapitalismus liegen.
Welche Rolle spielen "Grenzziehungen" in einer beschleunigten Welt?
Grenzziehungen sind bewusste Strategien des Individuums, um der medialen Permanenz zu entkommen, etwa durch medienfreie Zeiten oder bewusste Offline-Phasen.
Warum wird der Kapitalismus als Motor der Beschleunigung kritisiert?
Der Kapitalismus verlangt ständiges Wachstum und Effizienzsteigerung, was zwangsläufig zu einem immer schnelleren Lebensrhythmus und Zeitnot führt.
Was bedeutet "mediale Permanenz"?
Es beschreibt den Zustand, durch digitale Medien jederzeit und überall erreichbar und mit Informationen konfrontiert zu sein, was die Grenze zwischen Freizeit und Arbeit auflöst.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Zur Beschleunigung des Lebens im Hinblick auf mediale Beschleunigung. Entschleunigung als Lösungsansatz und Grenzziehungen in einer beschleunigten Welt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1146516