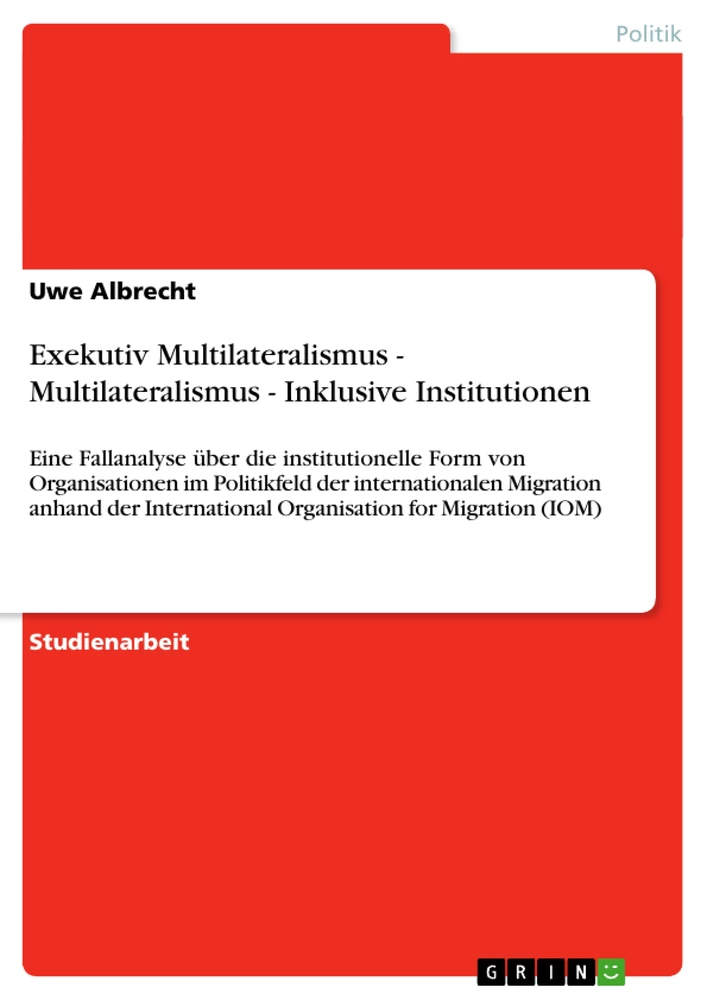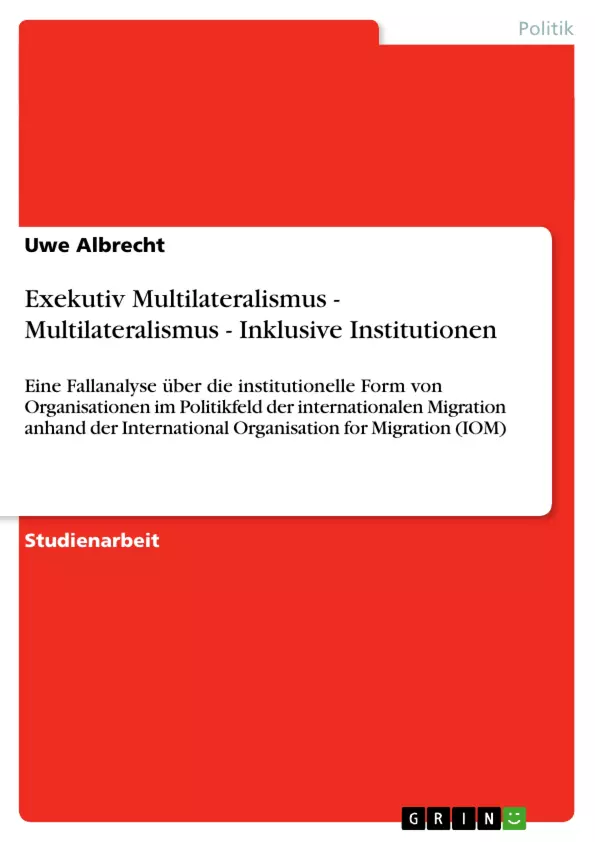Wanderungsbewegungen im großen Stil hat es in der Menschheitsgeschichte immer wieder gegeben. Schon die Römer hatten mit den Folgen der Migration zu kämpfen. Manche Histori-ker gehen sogar soweit und sehen in den damaligen Völkerwanderungen einen von mehreren Gründen für den Zusammenbruch des Römischen Reiches. (vgl. Wöhlcke 2003, S.284) Wie dies auch immer zu bewerten ist, so dürfte es unstrittig sein, dass sich im Laufe der Zeit die Migration in qualitativer sowie in quantitativer Hinsicht verändert hat. Zu keiner Zeit waren so viele Staaten, als auch Menschen von Migration betroffen, wie es heute der Fall ist. Nicht nur durch das Ausmaß, sondern auch durch die wachsende Komplexität von Migration sieht sich die heutige Staatenwelt einer wachsenden Herausforderung gegenüber gestellt. In anbet-racht dessen dürften einfache Problemlösungsmechanismen genauso zum scheitern verurteilt sein wie unilaterales Handeln von Staaten.
Auf institutioneller Ebene gibt es unterschiedliche Varianten des internationalen Regierens, um auf globale Phänomene, wie die Migration eines ist, adäquat zu reagieren. Die angedeute-ten Varianten unterscheiden sich dabei im Grad der Einbeziehung von privaten Akteuren in internationalen Organisationen. Der höchste Grad der Einbeziehung findet sich in so genann-ten Inklusiven Institutionen. Die Wirksamkeit dieser Institutionen wurde u.a. von Rittberger, Huckel, Rieth und Zimmer nachgewiesen. (vgl. Rittberger et al. 2007)
Die vorliegende Arbeit setzt sich nun mit der Problematik auseinander, warum es im Politik-felde Migration bis dato zu keiner Entstehung einer Inklusiven Institution gekommen ist. Um dies zu ergründen wurde das Format einer Einzellfallanalyse gewählt. Gegenstand soll hierbei die International Organization for Migration (IOM) sein. Begründet wird die Auswahl damit, dass es sich bei der IOM um die internationale Organisation mit dem breitesten Aufgaben-spektrum handelt. Zudem zählt sie zu den bedeutendsten Organisationen, welche sich mit dem Bereich der Migration auseinander setzt. (vgl. GCIM 2005, S.72) Auf der Grundlage der Res-sourcentauschtheorie soll die folgende Frage geklärt werden:
Welche Faktoren können auf der Grundlage der Ressourcentauschtheorie benannt werden, warum es sich im Falle der IOM um keine Inklusive Institution handelt?
Um die gestellte Frage zu beantworten, soll zunächst das Phänomen Migration näher beleuchtet werden. Im Anschluss daran wird auf die Probleme des bestehenden internationalen Regierens eingegangen und die unterschiedlichen Regierungsformen vorgestellt. Nach einer genaueren Betrachtung der Ressourcentauschtheorie und der IOM, wird das Untersuchungs-interesse expliziert. Die durchgeführte Analyse orientiert sich an der vorgestellten Theorie
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Ein Blick auf das Phänomen Migration
- 2. Das Regieren auf globaler Ebene
- 2.1 Probleme des internationalen Regierens
- 2.2 Formen des Regierens
- 3. Die Ressourcentauschtheorie
- 4. Die International Organization for Migration
- 5. Die Explizierung des Untersuchungsinteresse
- 6. Die Anwendung der Ressourcentauschtheorie
- 6.1 Die Überprüfung des Konsens im Zuständigkeitsbereich
- 6.1.1 Die Überprüfung des Konsens zwischen der IOM und dem BAB
- 6.1.2 Die Überprüfung des Konsens im Kontext des Dialoges
- 6.2 Die Überprüfung der Ressourceninterdependenz
- 6.2.1 Die Ressourcendependenz des BABS gegenüber der IOM
- 6.2.2 Die Ressourcendependenz der IOM gegenüber dem BAB
- 6.1 Die Überprüfung des Konsens im Zuständigkeitsbereich
- 7. Fazit
- Quellen:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Gründe, warum im Politikfeld der internationalen Migration bis dato keine Inklusive Institution entstanden ist. Sie analysiert die International Organization for Migration (IOM) als Fallbeispiel, um die Frage zu beantworten, welche Faktoren auf der Grundlage der Ressourcentauschtheorie die IOM von einer Inklusiven Institution unterscheiden.
- Das Phänomen der internationalen Migration und seine Herausforderungen
- Die Probleme des internationalen Regierens im Kontext der Migration
- Die Ressourcentauschtheorie als analytisches Instrument
- Die Rolle der IOM im internationalen Migrationsmanagement
- Die Analyse der IOM im Hinblick auf die Kriterien einer Inklusiven Institution
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Migration und die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit dar. Sie führt in die Problematik der Inklusiven Institutionen im Kontext der Migration ein und formuliert die Forschungsfrage.
Kapitel 1 beleuchtet das Phänomen der Migration und seine Entwicklungen. Es analysiert die Ursachen, Folgen und Herausforderungen der Migration für Herkunfts-, Transit- und Zielländer.
Kapitel 2 befasst sich mit dem internationalen Regieren im Kontext der Migration. Es analysiert die Probleme des bestehenden internationalen Regierens und stellt verschiedene Regierungsformen vor.
Kapitel 3 erläutert die Ressourcentauschtheorie als analytisches Instrument, um die Entstehung und Funktionsweise von internationalen Organisationen zu verstehen.
Kapitel 4 stellt die International Organization for Migration (IOM) als internationales Akteur im Migrationsmanagement vor. Es beschreibt die Aufgaben, Ziele und Strukturen der IOM.
Kapitel 5 expliziert das Untersuchungsinteresse und erläutert die Vorgehensweise der Analyse.
Kapitel 6 wendet die Ressourcentauschtheorie auf die IOM an. Es analysiert die Konsensbildung und die Ressourceninterdependenz zwischen der IOM und anderen Akteuren im Migrationsmanagement.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die internationale Migration, Inklusive Institutionen, Ressourcentauschtheorie, International Organization for Migration (IOM), internationales Regieren, Konsensbildung, Ressourceninterdependenz, Migrationsmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine „Inklusive Institution“ im internationalen Regieren?
Dabei handelt es sich um internationale Organisationen, die private Akteure und Nichtregierungsorganisationen in hohem Maße in ihre Entscheidungsprozesse einbeziehen.
Warum ist die IOM keine Inklusive Institution?
Die Arbeit analysiert anhand der Ressourcentauschtheorie, dass fehlender Konsens und spezifische Ressourcenabhängigkeiten die Einbeziehung privater Akteure bei der IOM einschränken.
Was besagt die Ressourcentauschtheorie?
Sie geht davon aus, dass Organisationen Kooperationen eingehen, um notwendige Ressourcen (Geld, Wissen, Legitimität) zu erhalten, die sie selbst nicht besitzen.
Welche Aufgaben hat die International Organization for Migration (IOM)?
Die IOM ist die weltweit bedeutendste Organisation für Migrationsmanagement und befasst sich mit einem breiten Spektrum von Wanderungsbewegungen und deren Regulierung.
Warum scheitert unilaterales Handeln bei Migration?
Aufgrund der Komplexität und des globalen Ausmaßes von Migration können einzelne Staaten das Phänomen nicht allein kontrollieren; es bedarf internationaler Regierungsformen.
- Quote paper
- Uwe Albrecht (Author), 2008, Exekutiv Multilateralismus - Multilateralismus - Inklusive Institutionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114730