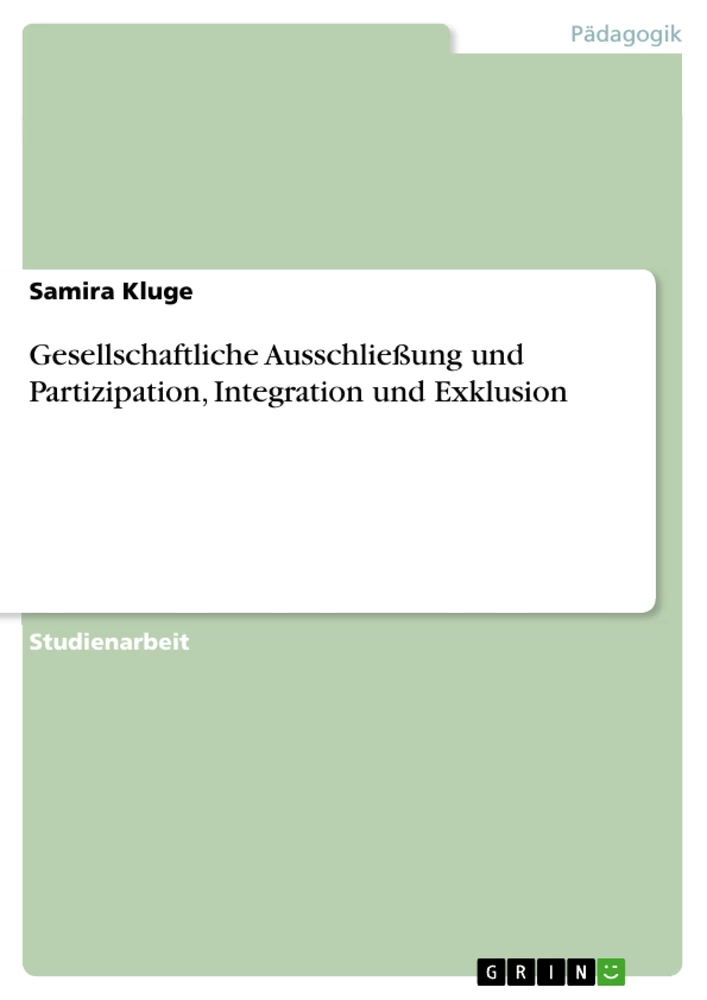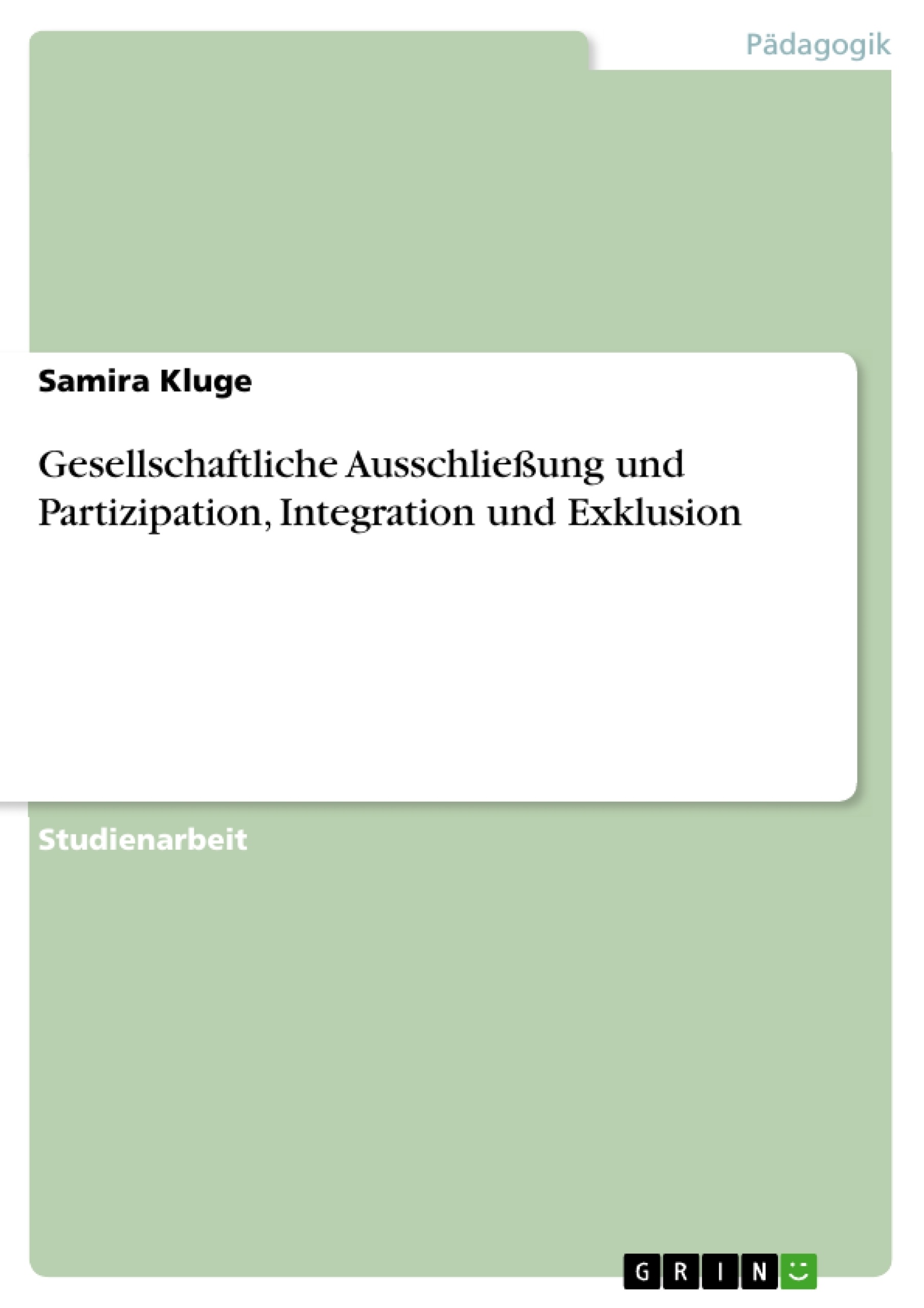Dieses Thesenpapier diskutiert unterschiedliche Thesen zu gesellschaftliche Ausschließung und Partizipation. In seinem Beitrag “Warum sich gerade jetzt mit sozialer Ausschließung befassen?” beschreibt Heinz Steinert zu Beginn, weshalb die Thematik rund um soziale Ausschließung eine solch hohe Bedeutung für die Soziale Arbeit und deren Sozialwissenschaften trägt. Diese Relevanz begründet er damit, dass gesellschaftlicher Ausschluss immer über eine gewisse Aktualität verfügt, wodurch wir, zumindest partiell, dauerhaft davon betroffen sind. Als konkretes Beispiel für diese bestehende Bedeutung nennen sowohl Cremer-Schäfer als auch Steinert die sogenannte “Flüchtlingskrise” und wie es dazu kommen kann, dass bestimmte Menschen kategorisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden sollen. Aus diesem Grund eines wiederkehrenden gemeinsamen Anschauungsbeispiels ist eine Kombination der hier verwendeten Beiträge auch besonders hilfreich für ein besseres Verständnis der Thematik.
These 1: Die gesellschaftliche, sowie politische Anwendung von Kategorisierung, also dem Erstellen bestimmter symbolischer Gruppen beziehungsweise Kategorien von Menschen, sowie das anschließende Einfügen bestimmter Gesellschaftsmitglieder*innen in eben diese ist ursächlich für eine Grenzziehung zwischen Adressat*innen innerhalb und
außerhalb dieser Kategorien.
Inhaltsverzeichnis
- Sozialer Ausschluss in der Gesellschaft und dessen Relevanz für die Sozialwissenschaften
- Darstellung von Thesen zum Thema Integration und Exklusion
- These 1: Die gesellschaftliche, sowie politische Anwendung von Kategorisierung
- These 2: In Bezug auf soziale Ausschließung stellen Integration
- These 3: Sozialer Ausschluss wird, zumindest partiell, politisch hergestellt
- These 4: Eine angrenzende These stellt diese dar, dass Kategorisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung sozialer Ausschließung für die Sozialwissenschaften und beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen Integration und Exklusion. Sie analysiert verschiedene Thesen, die aufzeigen, wie Kategorisierung und gesellschaftliche Grenzziehungen zu sozialem Ausschluss führen können.
- Die Bedeutung von Kategorisierung und Grenzziehungen für sozialen Ausschluss
- Das Paradoxon von Integration und Exklusion und deren zirkulärer Beziehung
- Die Rolle der Politik bei der Herstellung und Tolerierung von sozialem Ausschluss
- Die Nutzung von sozialem Ausschluss zur Legitimierung sozialer Kontrolle
- Die Folgen von sozialem Ausschluss für die Gesellschaft und die Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Relevanz von sozialem Ausschluss für die Sozialwissenschaften und beleuchtet die Kontroverse um Selbstverantwortung versus gesellschaftliche Strukturen. Es stellt die zentralen Themen der Arbeit vor und führt die Beiträge von Helga Cremer-Schäfer und Heinz Steinert ein.
Das zweite Kapitel präsentiert verschiedene Thesen zu Integration und Exklusion. Es analysiert die Bedeutung von Kategorisierung als Ursache für gesellschaftliche Grenzziehungen und erklärt das Paradoxon, dass Integrationsmaßnahmen gleichzeitig eine Form von Exklusion darstellen können.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der politischen Dimension von sozialem Ausschluss. Es diskutiert, wie soziale Ausschließung politisch konstruiert und instrumentalisiert werden kann, um gesellschaftliche Krisen zu erzeugen und politische Machtausübung zu legitimieren.
Das vierte Kapitel untersucht die Rolle von Institutionen bei der Förderung und Nutzung von Kategorisierung zur sozialen Kontrolle. Es zeigt auf, wie soziale Ausschließung als Mittel der sozialen Kontrolle genutzt werden kann, um gesellschaftliche Normen zu festigen und disziplinierende Maßnahmen zu legitimieren.
Schlüsselwörter
Sozialer Ausschluss, Integration, Exklusion, Kategorisierung, Grenzziehung, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, soziale Kontrolle, Institution, Institutionelle Verbannung, TINA-Prinzip, Flüchtlingskrise.
Häufig gestellte Fragen
Wie entsteht sozialer Ausschluss in der Gesellschaft?
Sozialer Ausschluss entsteht oft durch Kategorisierung und symbolische Grenzziehungen, die Menschen in Gruppen innerhalb oder außerhalb der Gesellschaft einteilen.
Warum ist soziale Ausschließung für die Soziale Arbeit relevant?
Laut Heinz Steinert verfügt das Thema über eine ständige Aktualität, da gesellschaftliche Krisen (wie die Flüchtlingskrise) immer wieder neue Formen des Ausschlusses hervorbringen.
Was ist das Paradoxon von Integration und Exklusion?
Die Arbeit zeigt auf, dass Integrationsmaßnahmen paradoxerweise selbst eine Form der Exklusion darstellen können, indem sie die Andersartigkeit der Betroffenen erst definieren.
Wird sozialer Ausschluss politisch gesteuert?
Ja, die Thesen besagen, dass Ausschluss oft politisch hergestellt oder instrumentalisiert wird, um soziale Kontrolle auszuüben oder Machtverhältnisse zu legitimieren.
Welche Rolle spielen Institutionen beim gesellschaftlichen Ausschluss?
Institutionen nutzen Kategorisierungen zur sozialen Kontrolle und können durch 'institutionelle Verbannung' den Ausschluss bestimmter Gruppen festigen.
- Citar trabajo
- Samira Kluge (Autor), 2020, Gesellschaftliche Ausschließung und Partizipation, Integration und Exklusion, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1147444