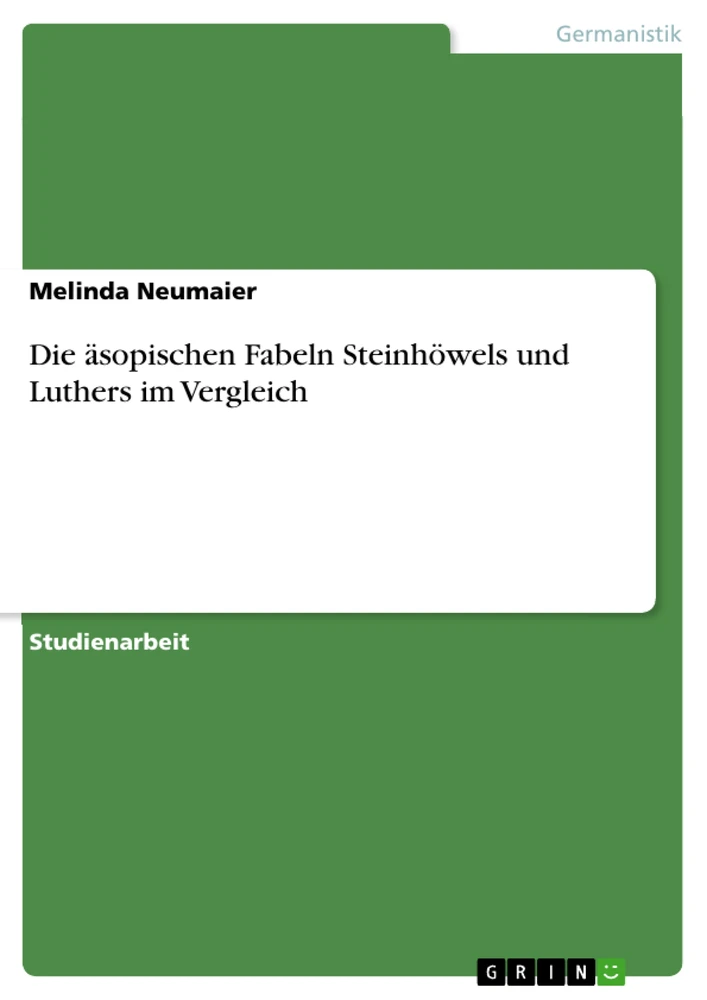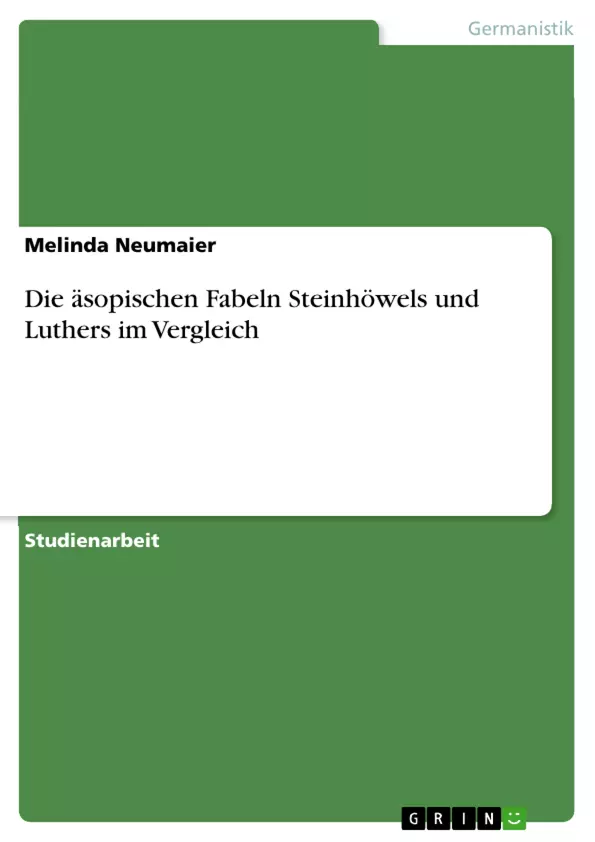In dieser Hausarbeit werden die beiden Fabel Versionen des Äsops von Martin Luther und Steinhöwel miteinander verglichen. Hierzu wird vor allem die Vorrede der beiden sowie die Fabel vom Wolf und dem Lamm hinsichtlich des Aufbaus sowie des Inhalts genauer betrachtet. Diesbezüglich soll vor allem auf den äußeren Stil, die inhaltlichen Differenzen, die Intentionen des Autors sowie auf die jeweiligen Rezipienten eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung – die Literaturgattung Fabel.
- 2. Steinhöwels Äsop..
- 2.1 Die Vorrede Steinhöwels............
- 2.2 Die Fabel: Die ander fabel von dem wolff und dem lamp…..\n
- 3. Luthers Äsop
- 3.1 Die Vorrede Luthers
- 3.2 Die Fabel: Vom Wolf und Lemlin ..
- 4. Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert und vergleicht die Fabeln des 16. Jahrhunderts von Heinrich Steinhöwel und Martin Luther. Sie beleuchtet den historischen Kontext und die literarischen Besonderheiten beider Ausgaben der äsopischen Fabeln. Dabei werden die Vorreden der beiden Autoren sowie die Fabel vom Wolf und Lamm detailliert untersucht.
- Die Bedeutung der Fabel als literarische Gattung in der Renaissance
- Der Einfluss des Humanismus auf Steinhöwels und Luthers Interpretationen
- Die unterschiedlichen Stilmittel und Übersetzungsstrategien der beiden Autoren
- Die didaktische Funktion der Fabeln und deren Rezeption im 16. Jahrhundert
- Der Vergleich der Fabel vom Wolf und Lamm in den beiden Versionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung - die Literaturgattung Fabel
Dieses Kapitel führt in die Geschichte der Fabel als literarische Gattung ein, beleuchtet ihre antiken Wurzeln und zeigt ihre Bedeutung als Instrument der Argumentation. Der Mythos um Äsop als Schöpfer der Fabel wird erörtert, und es wird auf die Bedeutung der Fabel als versteckte Wahrheitserzählung, die durch poetische Geschichten verhüllt ist, eingegangen.
2. Steinhöwels Äsop
Hier wird Heinrich Steinhöwel als der „Ulmer Äsop“ vorgestellt. Sein Werk, eine zweisprachige (lat./dt.) Ausgabe der äsopischen Fabeln, wird als Meilenstein der deutschen Fabeldichtung des 16. Jahrhunderts dargestellt. Steinhöwels Rolle im Kontext des Humanismus und die Bedeutung seiner Übersetzung für die intellektuelle Emanzipation der Bevölkerung werden beleuchtet.
3. Luthers Äsop
Dieses Kapitel widmet sich der Fabelbearbeitung von Martin Luther. Es analysiert die Besonderheiten seiner Vorrede und die spezifische Gestaltung der Fabel vom Wolf und Lamm. Dabei wird die Bedeutung der Luther'schen Übersetzung für die Verbreitung und Rezeption der Fabeln im 16. Jahrhundert hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der äsopischen Fabeln im 16. Jahrhundert, insbesondere mit den Bearbeitungen von Steinhöwel und Luther. Die Schlüsselwörter sind daher: Fabel, Aesop, Steinhöwel, Luther, Humanismus, Renaissance, Didaktik, Übersetzung, Vorrede, Wolf, Lamm, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptunterschiede zwischen den Fabeln von Steinhöwel und Luther?
Der Vergleich konzentriert sich auf den äußeren Stil, inhaltliche Differenzen und die unterschiedlichen Intentionen der Autoren im Kontext der Renaissance und Reformation.
Warum gilt Heinrich Steinhöwel als bedeutender Fabeldichter?
Sein "Ulmer Äsop" war eine zweisprachige Ausgabe, die den Humanismus förderte und die äsopischen Fabeln einem breiteren Publikum zugänglich machte.
Welche Absicht verfolgte Martin Luther mit seinen Fabeln?
Luther nutzte Fabeln als didaktisches Instrument zur moralischen Erziehung und als "versteckte Wahrheitserzählung" zur Argumentation in religiösen und sozialen Fragen.
Wie wird die Fabel "Wolf und Lamm" in den beiden Versionen interpretiert?
Die Analyse untersucht, wie beide Autoren das Machtverhältnis und die Moral der Geschichte sprachlich und inhaltlich unterschiedlich ausgestaltet haben.
Welche Rolle spielt die "Vorrede" in diesen Werken?
In den Vorreden erläutern Steinhöwel und Luther ihre Übersetzungsstrategien, ihre pädagogischen Ziele und ihre Sicht auf die Gattung Fabel.
- Quote paper
- Melinda Neumaier (Author), 2021, Die äsopischen Fabeln Steinhöwels und Luthers im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1147709