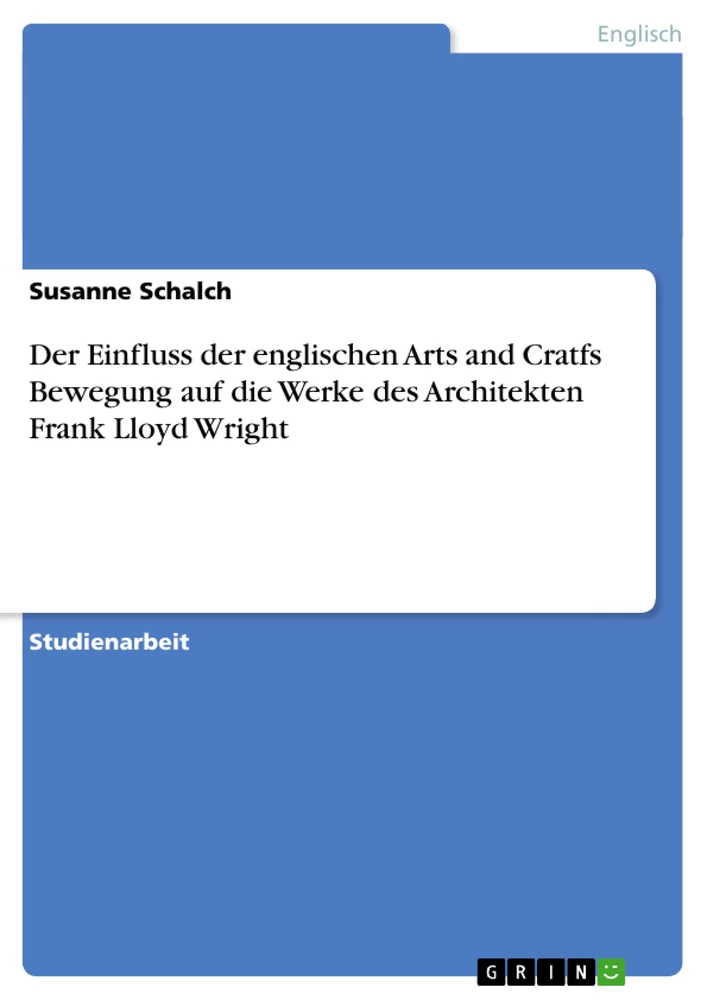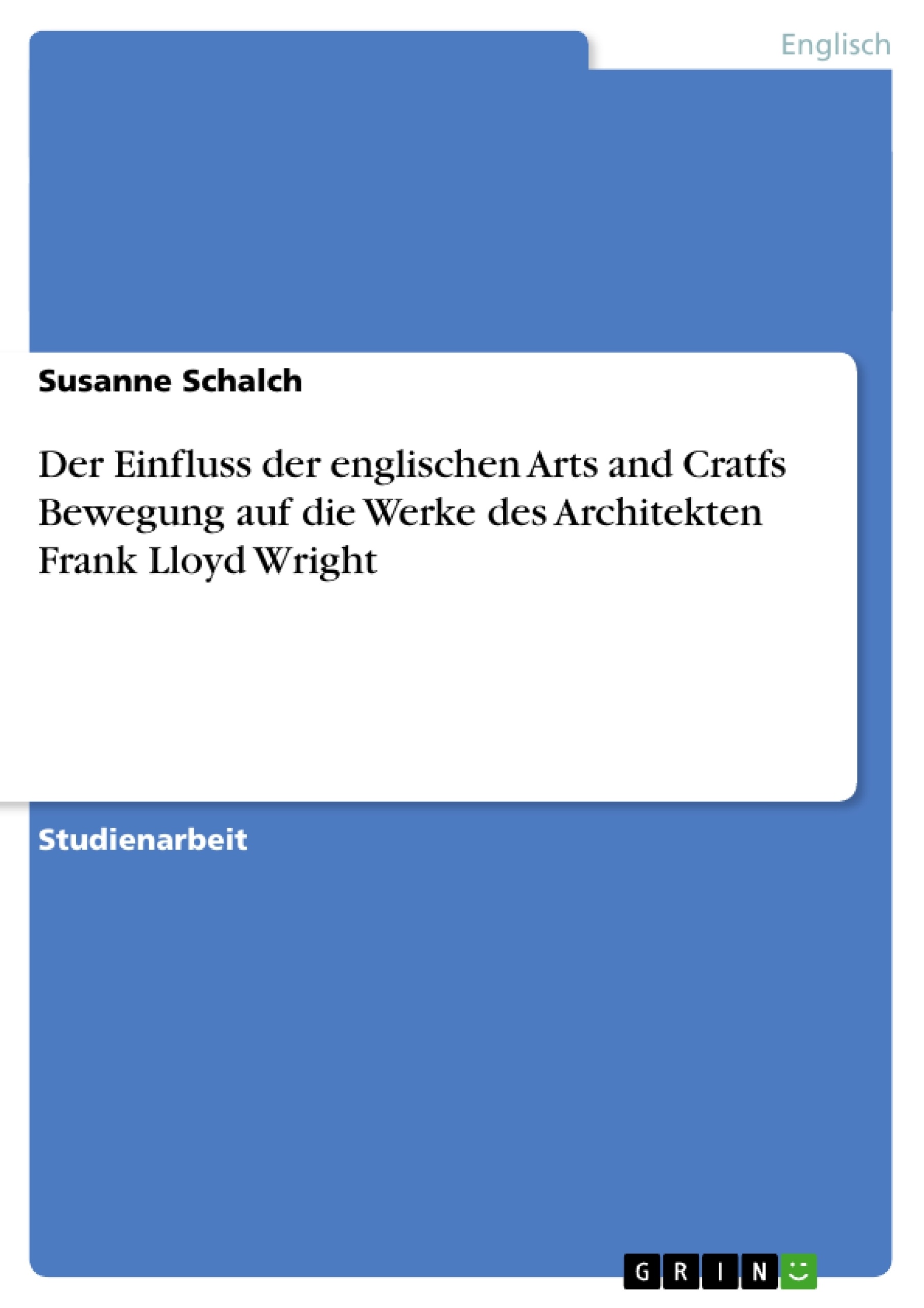Diese Hausarbeit will einen Überblick über das Arts and Crafts Movement geben, über
Grundideen, Hauptvertreter und deren Werke berichten. Da besonders auf die
Weiterentwicklung der Ideen in Amerika durch Frank Lloyd Wright eingegangen wird,
müssen vorher die Anfänge der Bewegung in England, hier durch William Morris und Philip
Webb betrachtet werden.
Das „Arts and Crafts Movement“ entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts in England und wurde dort, aber auch in anderen Teilen der Erde, wie zum
Beispiel in Amerika, bis in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und in manchen
Aspekten auch darüber hinaus praktiziert.
Der Begriff „Arts and Crafts“ wurde von T.J.Cobden-Sanderson (1840-1922) geprägt
und bedeutet soviel wie „Künste und Handwerk“ (Kirsch, S.269). Bereits im Namen der
Bewegung erkennt man, für was das Movement steht: zurück zu den alten Künsten und zu
echtem handwerklichen Können. Dies bezieht sich sowohl auf die damalige Architektur, als
auch auf das zeitgenössische Innendesign. Im folgenden Zitat von Walter Crane, erster
Präsident der „Arts and Crafts Exhibition Society“, werden Ziele der Bewegung treffend
formuliert: „Sie stellt in gewissem Sinn eine Revolte gegen das harte, mechanische,
konventionelle Leben und seine Unsensibilität für Schönheit dar. Sie ist ein Protest gegen den
so genannten industriellen Fortschritt, der Schundwaren hervorbringt, deren Billigkeit mit
dem Leben der Erzeuger und der Entwürdigung ihres Verbrauchers bezahlt ist.“ (Kirsch,
S.269).
Die Bewegung war zunächst eine Reaktion auf die Viktorianische Zeit, in der Königin
Viktoria von England regierte (1837-1901). In der „Victorian era“ waren die Häuser meist an
den Baustil der Antike angelehnt, mit pompösen Veranden und Terrassen, die über eine große
Treppe in riesige Portale mündeten. Außerdem schmückten sehr verspielte Ornamente die
Außenmauern und die Häuser glichen prunkvollen Palästen. Die Anhänger des Arts and
Crafts Movements störten sich an diesem Erscheinungsbild und wollten zurückkehren zu
gradlinigen, einfachen Formen und Gebäuden.
Der Bewegung gehörten Künstler an, darunter auch Schriftsteller und Handwerker
jeglicher Fachrichtung, wie zum Beispiel Architekten, Drucker und Buchbinder, Juweliere,
Töpfer, Bildhauer und Maler. All diese verschiedenen Künstler hatten jedoch eines
gemeinsam: die Ablehnung der Auswirkungen der Industriellen Revolution, die im 19.
Jahrhundertvon England aus die Welt eroberte.
Inhaltsverzeichnis
- Überblick über das Arts and Crafts Movement und über Einfluss auf Frank Lloyd Wright ca. 1850 bis 1920
- Reaktion auf ,,Victorian Era"
- Ablehnung der Auswirkungen der Industriellen Revolution
- Ziel: Qualität über Quantität
- Aussehen der Arts and Crafts Möbel und Gebäude an den Beispielen Red House uns Standen House
- Red House
- Naturmaterialien
- Pflanzenmotive
- Einfachheit und Funktionalität
- Gegenstände sinnvoll, nicht nur zu Zierde
- Standen House
- in Landschaft eingearbeitet
- Pflanzenmuster der Einrichtungsgegenstände
- Firma Morris, Marshall, Faulkner und Co. stellt diese Einrichtungsgegenstände her
- Sozialer Aspekt der Bewegung
- Morris und Webb wollten sowohl ästhetische Standarts als auch Arbeitskonditionen verbessern
- Frank Lloyd Wright als Hauptvertreter der amerikanischen Arts and Crafts Bewegung
- Wright erkannte Vorteile von maschineller Produktion
- Greatest American architect of all time
- Der Einfluss der Arts and Crafts Bewegung wird nach und nach in seinen Werken abnehmen
- Prairie Style am Beispiel Robie House
- Flache und horizontale Bauweise
- Erläuterung Prairie House
- Innen: fließender Raum ohne Wände
- Große Fenster, die das Licht und die Natur in den Raum bringen
- Terrassen und Balkone um Natur zu geniessen
- Verwendung von natürlichen Materialien wie Backstein und Holz, auch in den Möbelstücken
- Geometrie der Möbel
- Ennis-Brown House als Beispiel für Vorliebe für Geometrie
- aus Betonblockstein gebaut
- eher Palast statt Wohnhaus
- Einfluss der Natur im Ennis-Brown House
- Falling Water House als Beispiel für Naturliebe Wrights
- in Natur involviert
- verschiedene Level des Hauses
- 2,Auskragende Terrassen und Balkone, die in die Natur hinaus führen
- selbstdesigntes Interiör
- Glaswände, die die Natur auch im Haus spürbar machen sollen
- Stahlbeton als neuen Baustoff, Stein für die Natürlichkeit der Materialien
- Abgerundete Ecken der Balkone lassen auf neuen Trend schliessen: gegen scharfe Kanten und Ecken
- Solomon R. Guggenheim Museum als letztes Gebäude, das er gebaut hat
- rundes Bauwerk als krasser Abschluss der abgerundeten Ecken
- außergewöhnliche Bilder, außergewönliches Museum
- Betonung des vertikalen Raumflusses
- Einfluss des Arts and Crafts Movements verschwindet fast völlig:
- Stahlbeton als unnatürliches Baumaterial
- Weg von eckigen geometrischen Formen, hin zum Runden und Weichen
- aber einige Elemente bleiben Wright bis an sein Lebensende
- Schlichtheit und Ornamentlosigkeit
- Liebe zur Natur ist sichtbar in seinen Werken
- Kritik, dass das Museum von der Schönheit der Bilder ablenke
- Einfluss des Arts and Crafts Movements verblasste langsam während Wrights Karriere, ist allerdings vereinzelt immer noch sichtbar. Naturliebe als konstanter Faktor in seinen Werken.
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Einfluss der englischen Arts and Crafts Bewegung auf die Werke des Architekten Frank Lloyd Wright. Sie verfolgt das Ziel, einen Überblick über die Bewegung, ihre Grundideen und Hauptvertreter zu geben und die Weiterentwicklung dieser Ideen in Amerika durch Wright zu beleuchten. Dabei werden die Anfänge der Bewegung in England, insbesondere durch William Morris und Philip Webb, betrachtet.
- Die Arts and Crafts Bewegung als Reaktion auf die Industrialisierung und die Viktorianische Ära
- Die Betonung von Handwerkskunst, Qualität und Natürlichkeit in der Gestaltung
- Der Einfluss der Bewegung auf die Architektur und das Innendesign
- Die Entwicklung des Prairie Style durch Frank Lloyd Wright
- Die Veränderung des Einflusses der Arts and Crafts Bewegung auf Wrights Werke im Laufe seiner Karriere
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einem Überblick über die Arts and Crafts Bewegung, die als Reaktion auf die Viktorianische Ära und die Industrialisierung entstand. Die Bewegung strebte nach einer Rückkehr zu handwerklicher Qualität, Natürlichkeit und Einfachheit in der Gestaltung. Als Hauptvertreter der englischen Arts and Crafts Bewegung werden William Morris und Philip Webb vorgestellt, deren Werke wie das Red House und das Standen House als Beispiele für die typischen Merkmale der Bewegung dienen.
Im weiteren Verlauf der Hausarbeit wird der Einfluss der Arts and Crafts Bewegung auf die Werke von Frank Lloyd Wright untersucht. Wright, der als einer der bedeutendsten amerikanischen Architekten gilt, übernahm viele Ideen der Bewegung, entwickelte sie jedoch weiter und integrierte sie in seinen eigenen Stil. So entstand der Prairie Style, der sich durch flache, horizontale Bauweise, fließende Räume, große Fenster und die Verwendung natürlicher Materialien auszeichnet.
Die Hausarbeit beleuchtet verschiedene Gebäude Wrights, die den Einfluss der Arts and Crafts Bewegung auf unterschiedliche Weise zeigen. Das Robie House ist ein Beispiel für den Prairie Style, während das Ennis-Brown House die Vorliebe Wrights für geometrische Formen und das Falling Water House seine Liebe zur Natur widerspiegelt. Das Solomon R. Guggenheim Museum, Wrights letztes Gebäude, zeigt eine Abkehr von den Prinzipien der Arts and Crafts Bewegung, jedoch bleiben einige Elemente wie Schlichtheit und Ornamentlosigkeit in seinen Werken bis zum Schluss erhalten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Arts and Crafts Bewegung, Frank Lloyd Wright, William Morris, Philip Webb, Prairie Style, Architektur, Innendesign, Handwerkskunst, Qualität, Natürlichkeit, Industrialisierung, Viktorianische Ära, Red House, Standen House, Robie House, Ennis-Brown House, Falling Water House, Solomon R. Guggenheim Museum.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des Arts and Crafts Movements?
Die Bewegung war eine Revolte gegen die industrielle Massenproduktion und forderte eine Rückkehr zu handwerklicher Qualität, Schlichtheit und Schönheit im Alltag.
Wer waren die englischen Pioniere dieser Bewegung?
William Morris und Philip Webb gelten als Hauptvertreter, bekannt durch Werke wie das „Red House“.
Wie beeinflusste die Bewegung Frank Lloyd Wright?
Wright übernahm die Liebe zu natürlichen Materialien und Schlichtheit, integrierte jedoch im Gegensatz zu den Engländern die maschinelle Produktion in sein Konzept.
Was zeichnet den „Prairie Style“ aus?
Flache, horizontale Linien, fließende Innenräume ohne Wände und eine enge Verbindung zwischen Architektur und umgebender Natur.
Verlor Wright später den Bezug zum Arts and Crafts Stil?
In späten Werken wie dem Guggenheim Museum wich er von eckigen Formen ab, behielt aber die Prinzipien der Ornamentlosigkeit und Naturliebe bei.
- Citation du texte
- M.A. Susanne Schalch (Auteur), 2005, Der Einfluss der englischen Arts and Cratfs Bewegung auf die Werke des Architekten Frank Lloyd Wright, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114780