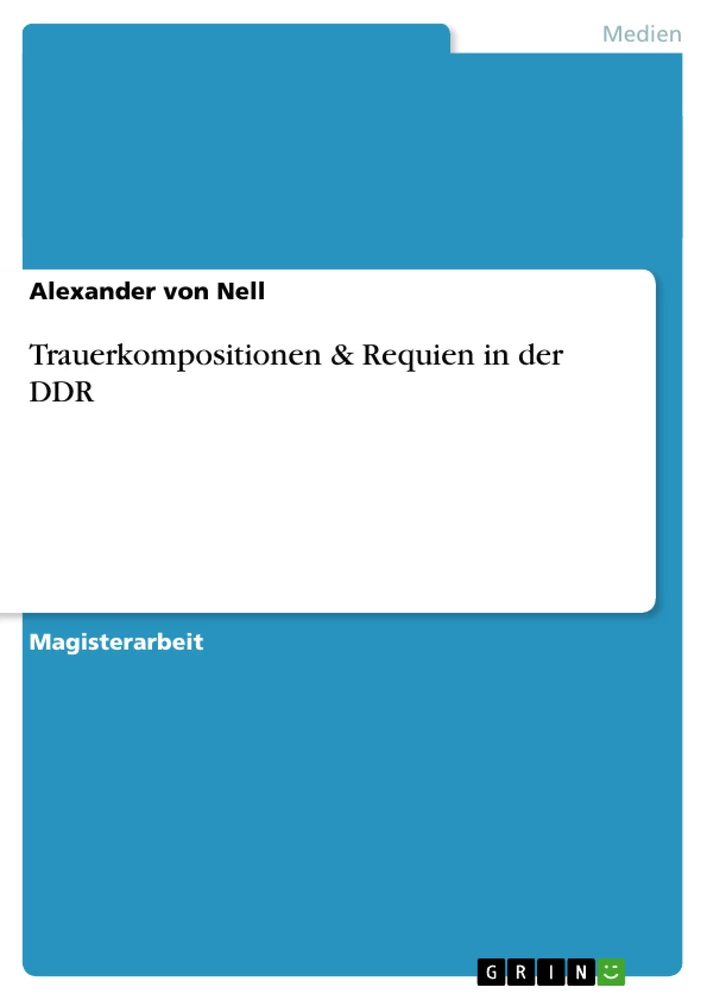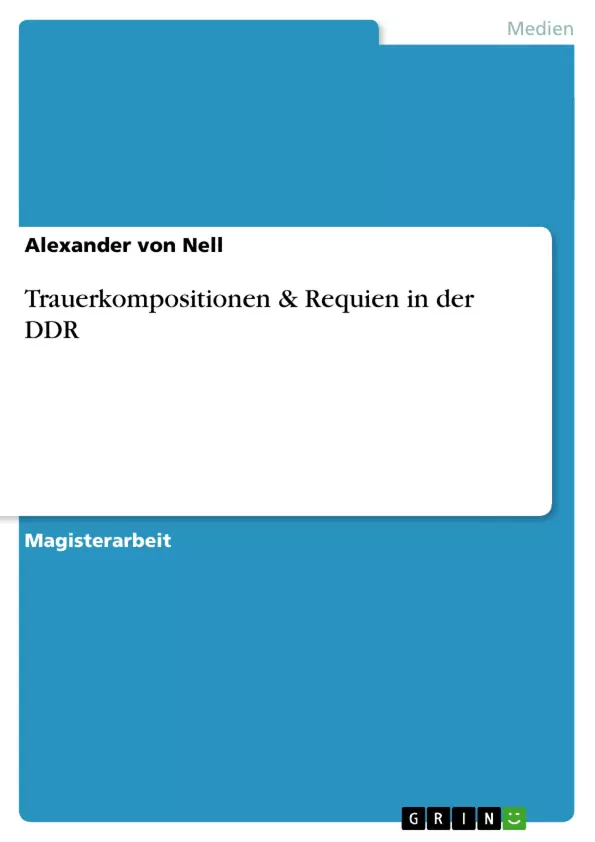Dass die Teilung Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg in zwei Staaten mit unterschiedlicher ideologischer Ausrichtung im Jahr 1990 in einer Wiedervereinigung ohne Blutvergießen ein Ende haben sollte, war noch zu Beginn des vorangegangen Jahres kaum absehbar. Nach der schnellen politischen Wiedervereinigung setzte - sehr viel zögerlicher als erwartet - eine Annäherung der persönlichen, kulturellen und ideellen Ansichten ein, die bis zum heutigen Tag bei weitem noch nicht als abgeschlossen angesehen werden kann.
Selbst meine Generation, die nur noch ihre frühe Jugend in einem politisch geteilten Deutschland erlebte, ist immer noch bereit, in den Kategorien von ‚Ossis’ und ‚Wessis’ zu denken. Diese nach wie vor vorhandene „Mauer in den Köpfen“ führt auch dazu, dass kulturelle Werte unterschiedlich wahrgenommen werden.
Wenn ich mir als ehemals Westdeutscher eine Forschungsaufgabe stelle, die sich mit der Deutschen Demokratischen Republik befasst, so dient das der eigenen Verortung in einem gesamtdeutschen System und dem Interesse an der ‚anderen Seite’. Gleichzeitig erhebe ich den Anspruch an mich, nicht wie frühere Generationen, die noch mit der realen Teilung Deutschlands in zwei Staaten unterschiedlicher politischer Ideologien leben mussten, gegen ein feindliches System anzuschreiben, wie es seit der Zeit unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg zu beobachten war.
Während der Teilung Deutschlands war auch die Musikwissenschaft nicht davor gefeit, zwischen die ideologischen Fronten zu geraten oder sich als Teil dieser Fronten zu begreifen: Vom Westen wurde die ostdeutsche Forschung und kompositorische Arbeit größtenteils stillschweigend übergangen, aus dem Osten wurde beispielsweise gegen Hans Heinz Stuckenschmidt oder den „Amerikaner“ Theodor W. Adorno zu Felde gezogen, und die westliche Avantgarde als „Auswuchs spätbürgerlicher Dekadenz“ verurteilt.
Mein Ziel ist es, in dieser Arbeit mit einem möglichst neutralen Blick die musikalischen Entwicklungen der SBZ/DDR in Bezug auf die Komposition von Trauermusik darzustellen und in ihren Kontexten zu erforschen. Dies erfordert eine Einordnung des politischen Systems der SBZ/DDR in seine geographischen und ideologischen Vorgängersysteme. Denn beide Systeme, Sowjetunion wie NS-Deutschland wirkten weit in die kulturpolitische Struktur und in die Bevorzugung - aber auch die Verdammung - bestimmter künstlerischer Mittel in die SBZ/DDR hinein.
INHALT
Vorbemerkung
1 Einleitung
2 Historische und theoretische Grundlagen der Trauermusik
2.1 Zur Trauermusik
2.2 Musik in totalitären Systemen des frühen 20. Jahrhunderts
2.3 Die Grundlagen im Nationalsozialismus
2.4 Die Grundlagen in der Sowjetunion
2.5 Sozialistische Musikästhetik
3 Trauerkompositionen und Requien in der SBZ/DDR
3.1 Struktur der musikpolitischen Einflussnahme
3.2 Exilerfahrung, Zerstörung und Wiederaufbau (1945 - 1959)
3.2.1 Paul Dessau: „Deutsches Miserere“
3.2.2 Rudolf Mauersberger: „Wie liegt die Stadt so wüst“
3.2.3 Zusammenfassung
3.3 ‚Bitterfelder Weg’, Mauerbau und ‚umfassender Aufbau des entwickelten Sozialismus’ (1959 - 1970)
3.3.1 Tilo Medek: „Todesfuge“
3.3.2 Staatskunst: „Für die sozialistische Feier“
3.3.3 Zusammenfassung
3.4 Die zweite Generation, Öffnung für neue Einflüsse (1971 - 1980)
3.5 Kontraste - Konflikte (1980 - 1990)
4 Fazit
5 Literaturverzeichnis
Anhang I Abkürzungsverzeichnis
Anhang II Trauerkompositionen in der DDR
Anhang III Kurzbiographien V
Anhang IV SBZ/DDR im historischen Überblick
Vorbemerkung
Dass die Teilung Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg in zwei Staaten mit unterschiedlicher ideologischer Ausrichtung im Jahr 1990 in einer Wiedervereinigung ohne Blutvergießen ein Ende haben sollte, war noch zu Beginn des vorangegangen Jahres kaum absehbar. Nach der schnellen politischen Wiedervereinigung setzte - sehr viel zögerlicher als erwartet - eine Annäherung der persönlichen, kulturellen und ideellen Ansichten ein, die bis zum heutigen Tag bei weitem noch nicht als abgeschlossen angesehen werden kann.
Selbst meine Generation, die nur noch ihre frühe Jugend in einem politisch geteilten Deutschland erlebte, ist immer noch bereit, in den Kategorien von ‚Ossis’ und ‚Wessis’ zu denken.[1] Diese nach wie vor vorhandene „Mauer in den Köpfen“[2] führt auch dazu, dass kulturelle Werte unterschiedlich wahrgenommen werden.[3]
Wenn ich mir als ehemals Westdeutscher eine Forschungsaufgabe stelle, die sich mit der Deutschen Demokratischen Republik befasst, so dient das der eigenen Verortung in einem gesamtdeutschen System und dem Interesse an der ‚anderen Seite’. Gleichzeitig erhebe ich den Anspruch an mich, nicht wie frühere Generationen, die noch mit der realen Teilung Deutschlands in zwei Staaten unterschiedlicher politischer Ideologien leben mussten, gegen ein feindliches System anzuschreiben, wie es seit der Zeit unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg zu beobachten war.
Während der Teilung Deutschlands war auch die Musikwissenschaft nicht davor gefeit, zwischen die ideologischen Fronten zu geraten oder sich als Teil dieser Fronten zu begreifen: Vom Westen wurde die ostdeutsche Forschung und kompositorische Arbeit größtenteils stillschweigend übergangen[4], aus dem Osten wurde beispielsweise gegen Hans Heinz Stuckenschmidt[5] oder den „Amerikaner“ Theodor W. Adorno[6] zu Felde gezogen, und die westliche Avantgarde als „Auswuchs spätbürgerlicher Dekadenz“ verurteilt.[7]
Mein Ziel ist es, in dieser Arbeit mit einem möglichst neutralen Blick die musikalischen Entwicklungen der SBZ/DDR in Bezug auf die Komposition von Trauermusik darzustellen und in ihren Kontexten zu erforschen. Dies erfordert eine Einordnung des politischen Systems der SBZ/DDR in seine geographischen und ideologischen Vorgängersysteme. Denn beide Systeme, Sowjetunion wie NS-Deutschland wirkten weit in die kulturpolitische Struktur und in die Bevorzugung - aber auch die Verdammung - bestimmter künstlerischer Mittel in die SBZ/DDR hinein.
„Der Tod scheint als ein harter Sieg der Gattung über das bestimmte Individuum und ihrer Einheit zu widersprechen; aber das bestimmte Individuum ist nur ein bestimmtes Gattungswesen, als solches sterblich .“[8]
Karl Marx
1 Einleitung
Der Musikgeschichte der SBZ/DDR, besonders der ersten zwei Jahrzehnte, wurden in den vergangenen Jahren manche Überblicksarbeiten und einige interessante Einzeldarstellungen gewidmet.[9] Die Kirchenmusik oder die von religiösen Ritualen geprägte Musik, unter die der hier zu behandelnde Forschungsgegenstand fällt, ist aber bisher aus der Betrachtung ausgeklammert worden. Bei den Einflüssen auf die Komposition von Trauer- und Gedenkmusiken in der SBZ/DDR handelt es sich um ein höchst komplexes Konglomerat von Anforderungen, Vorschriften und Verboten, die zeitgleich nebeneinander existieren. Diese speisen sich einerseits aus der Geschichte der Trauermusik als ritueller Musik, andererseits aus den kulturpolitischen Gegebenheiten in der SBZ/DDR:
Angefangen von reiner Gebrauchsmusik, die - an kirchlichen Vorbildern geschult - das sozialistische Wertesystem in die Kompositionen einfließen lässt[10] und Werken mit deutlich propagandistischer Absicht[11], über kirchenmusikalische Werke[12], bestimmten Persönlichkeiten gewidmete Kompositionen[13] reicht das Spektrum des Untersuchungsgegenstands bis hin zu Bestrebungen, das Grauen des Nationalsozialismus in Form von Gedenkkompositionen zu verarbeiten.[14] Der Ausdruck individueller Trauer wurde hingegen aus den Kompositionen weitestgehend eliminiert, oder per Dekret verschleiert. So wurde im Mittelsatz von Johann Cilenšeks
2. Symphonie die Trauermusik, die er dem Tod der Mutter widmete, ohne seine Einwilligung zu einer Trauermusik an die Opfer der Selbstbefreiung des KZ Buchenwalds umgewandelt.[15] Solcherart staatliche Einmischung in eigentlich künstlerische Prozesse bestätigten eine der Grundannahmen des Autors, dass das individuelle Sterben im Staatssystem der DDR so gut wie möglich ignoriert wurde. Die sozialistische Ideologie fußte im wesentlichen auf der Vorstellung von Kollektiven. Individuell herausragende Leistungen dienten daher im sozialistischen System ausschließlich dem Ansporn des Kollektivs, individuelle Gefühlsäußerungen wurden aber unter Umständen zu einer Gefahr für das System.[16] Die Sehnsucht der Menschen nach einem metaphysischen Rückhalt, etwa in der Ausübung einer Religion, wurde einerseits als ‚rückständig und bürgerlich’ abgelehnt, andererseits wurde das Klassenbewusstsein, etwa durch Ernst Bloch, zu einer neuen Projektionsfläche für die Grundfragen der Menschheit stilisiert.[17]
In der Musikgeschichte der SBZ/DDR war die sozialistische Ideologie und Ästhetik von wesentlicher Bedeutung. Ernst Hermann Meyer betonte in seiner Gründungsschrift der DDR-Musikästhetik „Musik im Zeitgeschehen“ (1952), dass der Musiker, sei er Komponist oder Interpret, nur im Kontext seiner sozialen Gemeinschaft schaffen könne und zu verstehen sei. Diese sei zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notwendigerweise eine marxistische.[18] Über eine stringente Bezugslinie von der Sowjetunion übernommener sozialistischer Grundsätze und Organisation hinaus ist die SBZ/DDR auch als Erbin des faschistischen Deutschlands zu sehen. Die Einflüsse aus letzterem System werden in „Kapitel 2.3 Die Grundlagen im Nationalsozialismus“ näher beleuchtet.[19] Dabei ist herauszuarbeiten, wie sich diese Vorgaben in der 40- jährigen Geschichte der DDR verändert haben.
Die Trauermusik selbst kann dank ihrer Geschichte als Beispiel für die Verknüpfung von Machtpolitik und musikalischer Kreativität betrachtet werden. Im kirchenmusikalischen Zusammenhang steht ihr ein bestimmter Platz und ein bestimmtes musikalisches Material zu, das in einer tausendjährigen Tradition geprägt wurde.[20] In diesem Kontext wurde sie zur Manifestation von Machtansprüchen der christlichen Religion sogar über den Tod hinaus.[21]
Schon in vorchristlicher Zeit wurden Trauerriten zur Demonstration von Machtansprüchen benutzt, beispielsweise die ausgeprägten Begräbnisrituale der frühen ägyptischen Kultur oder der Trauerzug Alexanders des Großen, der durch große Teile seines Herrschaftsgebiets führte. Von den Beerdigungsriten der christlichen Tradition zeugen etwa die Grabmäler des frühneuzeitlichen Papsttums, denen sich derzeit ein großangelegtes Forschungsprojekt widmet.[22]
Ebenso wie die Despoten früher Hochkulturen legten die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts beträchtlichen Wert auf eine repräsentative Darstellung nach dem Tod. Beispielsweise diente das Leninmausoleum in Moskau über Jahrzehnte der ideologischen Rückversicherung der Sowjetunion im Personenkult. Die größte Felsenbasilika der Welt im Valle de los Caídos ist ein Monument des franquistischen Staates, das gleichzeitig dem Gedächtnis an die Opfer des Bürgerkriegs und dem Diktator Franco gewidmet ist.[23] Seit Jahrtausenden sind der Tod und der mit ihm verbundene Kultus nicht nur religiös-metaphysisch, sondern] auch machtpolitisch von Bedeutung.
Da das sozialistische System sich erklärter Maßen gegen die Ausübung religiöser Kulte stellte, versuchte es einen Ersatz für diese Traditionen zu schaffen. Die in diesem Zusammenhang häufig zitierte Aussage Karl Marx’, Religion sei das Opium des Volkes, ist dabei nur die Grundlage des staatlichen Verbotes.[24] Seine Aussage reflektiert ausschließlich die Bedeutung und Funktion religiöser Kulte in feudalen oder bürgerlichen Herrschaftssystemen. Das Atheismusgebot sozialistischer Staaten und der bloße Ersatz religiöser durch kommunistische Kulte diskreditiert das marxsche Verdikt eher, als das es dieses bestätigt. Der Psychotherapeut Hans Joachim Maaz stellte dieses Phänomen in seinem direkt nach der Wiedervereinigung erschienenen Buch „Der Gefühlsstau“ wie folgt dar:
„Die ganze DDR glich einem Riesentempel pseudoreligiösen Kults: gottgleiche Führerverehrung, «Heiligenbilder» und Zitate ihrer Lehren, Prozessionen, Massenrituale, Gelöbnisse, strenge moralische Forderungen und Gebote, verwaltet von Propagandisten und Parteisekretären mit priesterlicher «Würde».“[25]
In Kongruenz mit den kirchlichen Sakramenten wurden in der DDR eigene Riten eingeführt: die Namensweihe, der Eintritt bei den Thälmann-Pionieren, die Jugendweihe und die Eheschließung bedeuteten die entsprechenden Initiationsriten der sozialistischen Gesellschaft. War die Übernahme und Umdeutung der genannten kirchlichen Sakramente innerhalb der sozialistischen Logik noch als ‚Aneignung des kulturellen Erbes’ zu verstehen, so erwuchs eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Ausrichtung von Totenfeiern, die im Widerspruch zum Selbstverständnis eines optimistischen und lebensbejahenden Sozialismus standen.[26] Ein Äquivalent für die katholische „Letzte Ölung“ ist nicht eingeführt worden. Kirchliche Bestattungen, die in zweierlei Hinsicht gegen die Ideologie verstießen, wurden möglichst unterbunden. „Es wird ihnen [den Gemeindemitgliedern] mehr und mehr die Durchführung einer Bestattung durch den Betrieb in welchem der Verstorbene tätig war [...] nahegelegt und dabei großartige Unterstützung zugesagt“ [27] , konstatiert im Jahr 1975 ein protestantischer Pfarrer in der von der evangelischen Kirche herausgegebenen Zeitschrift „Die Zeichen der Zeit“.
Eine deutliche Stellungnahme der sozialistischen Bewegung gegenüber dem Tod wird in dem autobiographischen Roman Johannes R. Bechers „Abschied“ von 1940 deutlich: „‚Du, sag mal Genosse, wie steht’s mit dem Tod?’ Darüber nämlich hatte er sich seine Gedanken gemacht und konnte mit seinem eigenen Denken nicht weiterkommen. ‚Mit dem Tod? Mit dem Tod?’ lachte der erfahrene Genosse, er hat sich schier nicht halten können vor Lachen, dann aber antwortete er ganz ernsthaft: ‚Eine derartige bürgerliche Frage beantworte ich nicht. Zur Frage des Tods? Dazu stehen wir überhaupt nicht. Diese Frage gibt es für uns nicht.’“[28]
Diese Negation des Todes und damit die Unfähigkeit zu Trauern kann als beispielhaft für die DDR gesehen werden. Generell wurden Gefühle laut Hans Joachim Maaz distanziert vom Erleben behandelt, da eine spontane Gefühlsäußerung verpönt war.[29] Die erfolgreiche Bewältigung einer Trauersituation durch Trauerarbeit war dadurch nicht gewährleistet. Eine Ausnahme von der regelrechten Verdrängung der Trauer stellte die Verehrung der ‚roten Helden’ dar, die Ernst Bloch mit christlichen Märtyrern verglich: „Nur eine Art Mensch kommt auf dem Weg zum Tod fast ohne überkommenen Trost aus: der rote Held. Indem er bis zu seiner Ermordung die Sache bekennt, für die er gelebt hat, geht er klar, kalt, bewußt in das Nichts, an das er als Freigeist zu glauben gelehrt worden ist. Sein Opfertod ist deshalb auch von dem der früheren Blutzeugen verschieden; denn diese starben, fast ausnahmslos, mit einem Gebet auf den Lippen und glaubten sich den Himmel erworben zu haben [...] der kommunistische Held dagegen [...] opfert sich ohne Hoffnung auf Auferstehung.
Sein Karfreitag ist durch keinen Ostersonntag gemildert, gar aufgehoben, an dem er persönlich wieder zum Leben erweckt wird.“ [30]
In diesem Zitat wird das Dilemma einer materialistischen Deutung der Todesbereitschaft deutlich: um freiwillig in den Tod zu gehen, muss - ob christlicher Märtyrer oder ‚roter Held’ - an etwas geglaubt werden. Dass Bloch den Jenseitsglauben durch den Glauben an das Klassenbewusstsein ersetzte, enthebt seine Todesvorstellung nicht der metaphysischen Grundlagen.
In dem in der BRD stark rezipierten Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“[31] betonen die Autoren Henry Loewenfeld zitierend, dass „eine Störung dieser Trauerarbeit beim einzelnen dessen seelische Entwicklung, seine zwischenmenschlichen Beziehungen und seine spontanen und schöpferischen Tätigkeiten“[32] behindern kann. Auch wenn sich dieses Buch mit der kollektiven Aufarbeitung des Naziregimes im Westdeutschland der 1970er Jahre auseinandersetzt, können seine Thesen in erstaunlicher Kongruenz auf die DDR übertragen werden.
In der vorliegenden Arbeit wird in „Kapitel 2 Historische und theoretische Grundlagen der Trauermusik“ die Frage gestellt, aus welchen Quellen die Musikpolitik - als Teil der Kulturpolitik - der DDR gespeist wurde. Dabei ist zu beachten, dass es autoritären Systemen offenbar sehr viel schwerer fällt, der Musik klare ästhetische Rahmenbedingungen vorzugeben, als der Literatur oder den bildenden Künsten. Diese Problematik ist der Musik immanent.[33] In der philosophischen Reflektion über die Künste wird ihr häufig eine Sonderrolle eingeräumt, die besonders in der Zeitstruktur und dem hohen Abstraktionspotential der Musik begründet liegt. Besonders deutlich formulierte diese Position Arthur Schopenhauer, der die Musik für nicht integrierbar in den Kanon der schönen Künste hielt.[34] Gleichwohl existieren zahlreiche Dokumente, die belegen, dass die Musik trotz allem nicht vor Einflussnahme durch die jeweils herrschende Ideologie gefeit ist. Die Forderungen an die sozialistischen Komponisten, die im „Manifest des II. Internationalen Kongress’ der Komponisten und Musikkritiker“ in Prag im Jahr 1948 aufgestellt wurden, verdeutlichen, wie schwer es den Teilnehmern fiel, eindeutige Maximen zu erstellen.[35] Die bloße Forderung, sich auf Gattungen zu beschränken, die dem Volk einen einfachen Zugang zur Musik verschaffen, war wesentlich unkonkreter als die Forderungen, die durch den ‚sozialistischen Realismus’ an die bildenden Künstler und die Schriftsteller gestellt wurden. In der DDR wurde der ‚sozialistische Realismus’ 1952 durch die 1. Bitterfelder Konferenz zum herrschenden Kunstideal erklärt und der in seiner Freizeit künstlerisch tätige Arbeiter erhielt eine Vorbildfunktion.[36] Die auch in der offiziellen Kulturdiskussion aufgetauchte Frage, was ‚sozialistischer Realismus’ sei, wird in „Kapitel 2.5 Sozialistische Musikästhetik“ beleuchtet.
Das in Ost- und Westdeutschland gerne gebrauchte Schlagwort der ‚Stunde Null’ und eines darauf folgenden vollständigen Neubeginns nach dem 2. Weltkrieg wird in der Forschung seit Mitte der 1980er Jahre mehr und mehr angezweifelt.[37] Der Versuch, einen völligen Neuanfang in Deutschland nach 1945 zu konstruieren, erscheint auch dem Autor als Geschichtsklitterung, da nicht nur die politischen Führungspersönlichkeiten der sich neu gründenden deutschen Staaten, sondern auch die Intellektuellen durch das nationalsozialistische System oder durch ihre Exilerfahrung geprägt wurden.[38] Ebenso wenig lässt sich im Bereich der Musik ein deutlicher Bruch mit der Kompositionspraxis der Zeit vor 1933 oder selbst der Zeit der Nazi-Diktatur erkennen.[39] Daher setzen die Überlegungen in dieser Arbeit auch nicht mit Gründung der DDR im Jahre 1949 an, sondern es wird für notwendig erachtet, die Kulturpolitik der maßgeblichen Vorgängersysteme - i.e. NS-Deutschlands und der stalinistischen Sowjetunion - mit in den Blick zu nehmen. Ein erster Fokus der musikalischen Betrachtung nach Ende des Krieges richtet sich konsequenter Weise auf das zwischen 1944 und 1947 im Exil entstandene „Deutsche Miserere“ von Paul Dessau und Bertold Brecht.
Besonders in der ersten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg versuchten sich einige Zeitzeugen mit den schrecklichen Ereignissen der Nazizeit, mit Verfolgung, Krieg, Massenvernichtung und Konzentrationslagern auseinander zu setzen. Nicht nur bildende Künstler empfanden es als bindend, sich diesen Erlebnissen gedenkend, mahnend, anklagend oder aufklärend zu stellen. Besonders das zerstörte Dresden wurde in der Kunst Ostdeutschlands zu einem Topos für die Schrecken des Krieges.[40]
Auch in der Musik wurde mit dem „Dresdner Requiem“ von Rudolf Mauersberger (1947) ein deutliches Zeichen gesetzt.[41] Die Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Nazizeit wurde zu einer stehenden Größe im Kunstschaffen der DDR. Auf Grund des erklärten Ziels, ein antifaschistischer Staat zu sein, war es fast ausschließlich in Werken, die sich mit der Reflektion des Faschismus beschäftigten, gestattet, einen Ausdruck für Trauer und Verzweiflung - auch privater Natur - zu gestalten.
2 Historische und theoretische Grundlagen der Trauermusik
Das folgende Kapitel dient dem Einstieg in den sowohl historisch, als auch ästhetisch komplizierten Forschungsgegenstand. Zunächst werden in 2.1 die gattungs- geschichtlichen Voraussetzungen der Trauermusik beschrieben, anschließend von 2.2 bis 2.4 die historischen und musikpolitischen Vorgängersysteme der SBZ/DDR beleuchtet und schließlich in 2.5 die Grundlagen der ästhetischen Diskussion in sozialistischen Systemen dargestellt.
Requiem aeternam, dona eis requiem, Domine[42]
2.1 Zur Trauermusik
Missa pro defunctis
Das Thema dieser Arbeit macht es erforderlich, neben der Darstellung der allgemeinen soziologischen Bedingungen, die die Künstler in der DDR vorfanden, auch auf die musikgeschichtlichen Grundlagen der zu besprechenden Werke einzugehen. Die in Anhang II aufgeführten Kompositionen, wie auch die im Folgenden zu besprechenden Werke gehören keiner klar zu umreißenden musikalischen Gattung an. Das verbindende Element aller dieser Werke ist der Verweis auf ein individuelles oder kollektives Totengedenken und/oder eine individuelle oder kollektive Trauer. Diese Vorgabe vereint alle Werke unter dem Begriff der Trauermusik, deren Ziel es ist, die Empfindung der Trauer in ihren unterschiedlichsten Facetten darzustellen.[43]
Die Forschung zu einer spezifischen Musik der Trauer ist relativ jung. So existiert in der ersten Ausgabe der „Musik in Geschichte und Gegenwart“ kein Eintrag unter dem Stichwort ‚Trauermusik’. Genauso wenig lässt sich im „New Grove’s Dictionary of Music and Musicians“ ein Eintrag unter music of mourning o.ä. finden. Erst in der Zweiten Auflage der „Musik in Geschichte und Gegenwart“ findet sich in Band 9 (1998) ein Überblicksartikel zu diesem Thema.[44]
In der christlichen Tradition ist die Missa pro defunctis einer der ältesten Teile der katholischen Liturgie.[45] Mehrstimmige Totenmessen sind ab dem späten 15. Jahrhundert in ganz Europa nachweisbar. Jedoch wurde zu dieser Zeit dem einstimmigen Vortrag des Requiems ein höherer Grad an Feierlichkeit und Dignität zugesprochen, so dass mehrstimmige Totenmessen im Verhältnis zu den mehrstimmigen, lose in die Liturgie eingebetteten Totenmotetten, aus dieser Zeit relativ selten sind.[46]
Im 16. Jahrhundert entwickelte sich mit der Reformation auch in der Trauermusik eine deutliche Spaltung der unterschiedlichen christlichen Konfessionen. Luther setzte sich in der Verarbeitung von Trauer deutlich von der katholischen Ideologie ab. Ein besonderer Dorn im Auge waren ihm die „bepstlichen grewel / als Vigilien / Seelenmessen / Begengnis / Fegefer / vnd alles ander gauckelweck“ [47] . Dagegen hielt er es für empfehlenswert „tröstliche lieder / von vergebung der sundenn / von ruge / schlaff / leben vnd aufferstehung der verstorbenen christen“[48] bei Trauerfällen zu singen. Dieser Forderung schlossen sich umfangreiche protestantische Liedersammlungen an, die „bey christlichen Leichenbestattungen tröstlich können gebrauchet werden.“[49] Die diametral dem katholischen Ritus entgegengesetzte protestantische Todesauffassung spiegelt gleichzeitig eine geänderte Einstellung zum Leben wider. Der Fokus, der in der katholischen Lehre in der Furcht vor den Strafen des Jenseits liegt, richtet sich im Protestantismus auf den Trost der Hinterbliebenen. Damit musste zwangsläufig auch eine deutliche ästhetische Wende in der protestantischen Trauermusik eingeleitet werden.
Die fortschreitende Säkularisierung der europäischen Gesellschaft führte im 17. Jahrhundert dazu, dass der kirchliche Trauerritus und die damit verbundenen Messen und Motetten nicht mehr singuläre Orte des Totengedenkens waren. Jenseits eines liturgischen Kontexts entstanden anlässlich des Todes hochgestellter oder hochverehrter Persönlichkeiten Trauerkantaten und Trauermusiken, die auch als déplorations, planhs oder lamentationes bezeichnet wurden.[50] In der solistischen Instrumentalmusik entstanden explizite[51] und implizite[52] Klagekompositionen. Es bildeten sich in der Folge verschiedene, außerliturgische Gedächtnisveranstaltungen, die sich in jeweils unterschiedlichen sozialgeschichtlichen Zusammenhängen einzelnen oder einer bestimmten Gruppe von Verstorbenen widmeten. Die Freimaurerlogen erteilten beispielsweise Kompositionsaufträge für die sogenannten Toten-Logen, in denen verstorbenen Mitgliedern gedacht wurde. Für eine solche Loge komponierte Wolfgang Amadeus Mozart 1785 seine „Maurerische Trauermusik“. Für die nichtkirchliche Ehrung des schwedischen Königs Gustav III. komponierte Joseph Martin Kraus seine „Symphonie funèbre“.[53] Ganz in der Tradition der Empfindsamkeit entstanden zur gleichen Zeit Kompositionen auf Texte, die einer allgemein christlichen Religiosität jenseits kirchlicher Dogmen huldigten. In den Dichtungen Friedrich Klopstocks - besonders in seinem äußert populären Werk „Messias“ - Matthias Claudius’ oder den Mitgliedern des >Göttinger Hainbundes<, tauchten antikisierende Elemente, aufklärerische Ideale und empfindsame Tendenzen auf, die eine Richtschnur für die Libretti von Trauerkompositionen bildeten. Eine zeitgenössische Rezension einer Trauerkantate auf den Tod des preußischen Königs Friedrich Willhelm II. in der „Allgemeinen Musikalischen Zeitung“ machte deutlich, welcher Maßstab an ein solches Werk gelegt wurde: „... dass die Kantate durchaus in edlem einfachen Style geschrieben ist und den Charakter der Würde hat, wie ihn ein solches Sujet erfordert“.[54]
In einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft wurden auch in nichtkirchlichen Kompositionen verschiedene musikalische Mittel angewendet, die aus der liturgischen Praxis stammten. Eine Tradition sakraler Trauer konnte durch Komponisten allerdings nicht umgesetzt werden, da es sich dabei um die bewusste Abwesenheit von Musik handelte. In der Passionszeit gibt es bis heute in stark katholisch geprägten Gebieten die Tradition, dass während der Passionszeit in Kirchen ausschließlich a cappella musiziert wird und auch das Glockengeläut etwa durch Ratschen oder Schnarren ersetzt wird. Im 18. Jahrhundert wurde diese Tradition in protestantischen Gebieten in Fällen von Staatstrauer angewandt. Nach dem Tod eines Herrschers wurden während des Trauerjahres keine Hofmusiken veranstaltet und daher unter Umständen ganze Hofkapellen aufgelöst.[55]
Eine absichtsvoll nicht schön klingende Musik war lange Zeit ein Tabu, das aber seit dem 18. Jahrhundert schwand. Spätestens mit der „Ästhetik des Hässlichen“ von Karl Rosenkranz aus dem Jahr 1850 wurde die Verwendung von solchen Elementen legitimiert und insbesondere für die kompositorische Umsetzung der Schrecken des Todes genutzt. Denn in der säkularisierten Welt stellte sich der Tod im Gegensatz zur kirchlichen Ideologie nicht als Erlöser, sondern als Vernichter und Zerstörer dar. Daher wurde das Zerstückeln von melodischen Zusammenhängen wie das Zerstören harmonischer Strukturen zu einem bevorzugten Stilmittel der Trauermusik.
Im 19. Jahrhundert erschloss sich die Trauermusik neue Ausdrucksformen und neben dem Kirchenraum auch den Konzertsaal als Aufführungsort. Nach der am Ende des 18. Jahrhunderts geschriebenen „Symphonie funèbre“ von Kraus entstanden symphonische Kompositionen, die Thema wie auch Melodiematerial der liturgischen Requiemkomposition entlehnten oder durch ihre Widmungen zu kollektiven oder persönlichen Gedenkkompositionen wurden. Als Beispiele seien hier Berlioz’ „Grande symphonie funèbre et triomphale“ (1840) zum Andenken an die Opfer der Julirevolution 1830, denen auch das drei Jahre zuvor entstandene Requiem des selben Komponisten gewidmet ist[56], und die 2. Symphonie Aleksandr Glasunows (1886), Franz Liszt gewidmet, genannt. Hans Wolfgang Schneider veröffentlichte eine Auswahl der rein instrumentalen Trauerkompositionen seit dem späten 18. Jahrhundert in seiner Dissertation.[57] Dabei finden sich gleichermaßen Werke aus der instrumentalen Sololiteratur, der Kammermusik, des Instrumentalkonzerts und der Symphonik. Auch die ausdrücklichen Requiemkompositionen der Zeit entwickelten eine Tendenz zu symphonischen Qualitäten und Konzeptionen außerhalb der liturgischen Form einer Trauermesse und legen dadurch eine Aufführung als Konzertstück nahe. Das Requiem Verdis, zum Andenken an den Dichter Alessandro Manzoni, wurde nur bei seiner Uraufführung am 22. März 1874 in der Kirche San Marco in Mailand gespielt. Es folgten Aufführungen in der Mailänder Scala und der Pariser Opéra Comique, sowie eine Tournee nach London, Paris und Wien im Jahr Ähnlich verhielt es sich bei den Requiemkompositionen Cherubinis (1836), Berlioz’ (1837), Dvořáks (1890), und auch Brahms’ (1869). Letztere ist schon durch ihren textlichen Gehalt für einen liturgischen Einsatz nicht geeignet.
Um ihrer Funktion gerecht zu werden, muss der Gehalt der Trauermusik von ihren Rezipienten verstanden werden. Dieses Verstehen fußt insbesondere auf einer stringenten kompositionstechnischen Traditionslinie, die der Trauermusik eigen ist und die sich an einer Reihe musikalischer Mittel darstellen lässt:
- moll-Tonalität
- getragene Notenwerte, häufige Pausen
- Chromatik, passus duriusculus
- g - fis - b - a („Crucifixus-Thema“)
- dies-irae Sequenz
- Zitate aus Passionschorälen
- Lamento-Bass € Passacaglia
- Außergewöhnliche Intervalle: Tritonus
- Tremolo (vokal und instrumental)
- tiefe Lage
- Minimalisierung der „Tonigkeit“ und Dynamik
- „Augenmusik“ € z.B. Josquins „déplorations“ in schwarzer Notation
- bei der Ehrung verstorbener Komponisten: Zitate aus Werken des Verstorbenen
Dass die angeführten Mittel zwar Hinweise, aber keine hinreichenden Begründungen für die Identifikation von Trauermusik sind, geht aus der Jahrhunderte alten Diskussion um die Eingangsarie „Che faro senza Euridice“ von Orfeus in Glucks „Orfeo e Euridice“ hervor, die im 19. Jahrhundert von Eduard Hanslick in seinem Werk „Vom Musikalisch Schönen“[59] aufgegriffen wurde. Er sah sich durchaus, in Nachfolge des französischen Musikkritikers Boyé, in der Lage, der Musik auch einen fröhlichen Text zu unterlegen. Hanslick machte an diesem Beispiel seine Position deutlich, dass „auch weit bestimmtere und ausdrucksvollere Gesangsstellen [], losgelöst von ihrem Text, uns höchstens raten lassen, welches Gefühl sie ausdrücken. Sie gleichen Silhouetten, deren Original wir meistens erst erkennen, wenn man uns gesagt hat, wer das sei.“[60]
Wenn auch die Schrift Hanslicks ihre polemische Absicht nicht verleugnen kann, so wird in dieser Aussage dennoch ein Problem deutlich: die oben aufgeführten Merkmale können ein Element von Trauermusik sein, diese verfügt aber über ein sehr viel weiteres Ausdruckspektrum, in das durchaus auch die von Hanslick kritisierte Inkongruenz von Text und musikalischem Ausdruck integrierbar ist.
Zusätzlich erschwert wird die Identifikation bei nicht textgebundener Musik der Trauer, für die Hans Schneider in seiner Dissertation verschiedene Paradigmen festgelegte, denen der Autor dieser Arbeit im wesentlichen folgen möchte:[61]
1. Der Titel weist auf eine Trauermusik hin:
a. allgemeine Bezeichnung von Trauer und Klage (z.B. Grabschrift, in memoriam, Trauermusik)
b. musikalische Form mit Trauercharakterisierung (z.B. Trauermarsch)
c. durch einen Begriff des Totenkults innerhalb der bildenden Künste (z.B. Totentanz)
d. durch einen Begriff aus der Literatur (z.B. Doberaner Totensprüche)
e. durch einen Begriff des religiös-liturgischen Ritus (z.B. De profundis, Requiem, Messe)
2. Der Untertitel weist auf Trauermusik (z.B. in memoriam, Nachruf)
3. Tempo- und Charakterbezeichnungen eines Satzes weisen auf Trauergehalt (z.B. largo e mesto, triste, moderato funèbre, marcia funèbre)
4. Musikalische Zitate
a. Zitate der kirchlichen Tradition
b. Zitate aus Werken eines verstorbenen Komponisten, dem das Werk gewidmet ist
5. Quellendokumente belegen die Funktion als Trauermusik
a. schriftliche bzw. mündliche Aussagen des Komponisten selbst
b. Überlieferung durch Personen aus dem Umkreis des Komponisten
Der nicht tonal gebundenen Musik des 20. Jahrhunderts stehen bestimmte Topoi aus der Tradition der Trauermusik nicht mehr zur Verfügung. Dadurch verstärkt sich die Verwendung solcher Ausdrucksmittel, die bis dahin nicht oder nur wenig benutzt wurden. Insbesondere der Rückgriff auf alte musikalische Formen wie beispielsweise die Passacaglia, das Zitieren der Tradition durch den Rückgriff auf gregorianische Sequenzen der Missa pro defunctis oder die Verwendung von Passionschorälen rücken seitdem in den Vordergrund der kompositorischen Praxis.
„Eine wirklich revolutionäre Partei ist weder in der Lage noch willens, die Aufgabe einer Lenkung, noch die einer Gängelung der Kunst zu übernehmen, weder vor noch nach ihrem Machtantritt.“[62]
Leo Trotzki
„Inzwischen übte Goebbels, um die Bedenken der Musiker zu beschwichtigen und im Sinne eines erklärten Prinzips relativer künstlerischer Freiheit, in dieser frühen Phase des Regimes ziemliche Zurückhaltung bei der Durchsetzung seiner kulturellen Ziele.“[63]
Michael Meyer
2.2 Musik in totalitären Systemen des frühen 20. Jahrhunderts
Funktionäre des faschistischen Deutschlands und der Sowjetunion artikulierten zu Beginn ihrer Herrschaft auffallend deutlich die Vorstellung einer freien künstlerischen Entwicklung unter ihrem jeweiligen Regime. Es wurde aber vorausgesetzt und als unabwendbare Konsequenz aus der geschichtlichen Entwicklung gesehen, dass sich Komponisten, Musikwissenschaftler und Musiker freiwillig in den Dienst des Systems stellen würden.[64] So gab der sowjetische Kulturkommissar Anatoli Lunatscharski die Maxime aus: „Wenn die Revolution der Kunst die Seele geben kann, so kann die Kunst zum Mund der Revolution werden.“ [65]
In gleicher Deutlichkeit und zeitlich parallel wurde aber eine Bestrebung deutlich, avantgardistische Kunst zu verdammen. Diese Zensur zeigte sich in den Kontrollmechanismen der Künstler innerhalb der Systeme und in der bewussten Verfemung bestimmter Komponisten und Stile. Ein sowjetisches Beispiel dafür war der 1936 - unter Umständen von Josef Stalin persönlich - in der Prawda lancierte Artikel „Chaos statt Musik“. Als Veriss von Schostakowitschs Oper „Lady Macbeth“ getarnt, wurden in ihm Vorwürfe gegen die moderne Musik wie Monotonie und Pseudoradikalität erhoben.[66] Ein Äquivalent im nationalsozialistischen Deutschland war die Ausstellung „Entartete Musik“ anlässlich des Reichsmusikfestes in Düsseldorf 1938.[67]
Die Politisierung der Musik war in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ein Phänomen, das nicht nur in Deutschland, sondern ebenso in Russland (seit 1922 UdSSR), Frankreich, Spanien und Italien beobachtet werden konnte. In den westlichen Ländern entstand zu dieser Zeit der Begriff ‚Musikbolschewismus’ in aggressiv antikommunistischer Bedeutung.[68] Hans Pfitzner und eine große Zahl von Musikjournalisten wendeten diese Diffamierung auf alles an, was sich gegen die Tradition richtete oder zu richten schien: An erster Stelle gegen Schönberg und die Wiener Schule, aber auch gegen die radikal-experimentellen Konzeptionen des Futurismus und Dadaismus, gegen Strawinsky, Bartók, Křenek, mit Einschränkungen auch gegen Hindemith, gegen Jazz und die Vermischung von Kunst und Unterhaltung in der Musik.[69] Es sind genau diese Künstler und musikalischen Richtungen, die auch in der Musikgeschichte Anton Meyers aus dem Jahr 1933 angegriffen wurden: „...der Zusammenhang der destruktiven, in der Tat verderblichen Tendenzen der Kunst mit denen der Politik, also des Marxismus, wurde nun [nach der ‚Machtergreifung’ Hitlers] vielen Menschen klar, die vorher an dem Grundsatz ‚Abgeschlossenheit’ der Kunst oder einem gewissen ‚l’art pour l’art’-System festgehalten hatten.“[70]
Den Kompositionen wurde schlichtweg der künstlerische Gehalt abgesprochen, wodurch die Würdigung in einer Musikgeschichte nicht mehr gerechtfertigt sei: „Es ist heute nicht mehr wichtig, sich mit dem Wesen der atonalen Musik zu beschäftigen; ihre von Arnold Schönberg in seiner Harmonielehre verkündete Theorie ist ebenso kompliziert, wie überholt“. [71] Der entscheidende Aspekt dieser Art von Kritik war nicht, dass zeitgenössische Werke der Avantgarde kritisiert wurden, sondern dass diese Kritik politisierte und die Musik nicht nur in einen politischen, sondern auch rassistischen Kontext stellte. Als Pate für diese Art der Musikkritik wurde Richard Wagners Musikschrifttum, insbesondere der Aufsatz „Das Judentum in der Musik“ von 1850 in Anspruch genommen, der in dieser Zeit besonders intensiv rezipiert wurde.
1937 setzte die Ausstellung „Entartete Kunst“ in München ein deutliches Zeichen, wie im nationalsozialistischen Reich mit unliebsamer Kunst und Künstlern umgegangen werden würde. Besonders die expressionistische Kunst geriet in das Visier der faschistischen Ausstellungsmacher.[72] Zeitgleich entfaltete sich im sozialistischen Lager eine Debatte über den literarischen Expressionismus, die mindestens ebenso polemisch geführt wurde, wie die Kunstdebatte im nationalsozialistischen Deutschland.[73] Entgegen den Bemühungen Gottfried Benns, der anfänglich ein glühender Vertreter des Faschismus war, wurde der Expressionismus von der faschistischen Führung als ‚Kulturbolschewismus’ gebrandmarkt. In der oben zitierten Musikgeschichte bezeichnete Mayer den literarischen Expressionismus als „Gestammel“.[74] In der sozialistischen Diskussion wurde derselben Kunstrichtung Abgehobenheit und Realitätsferne vorgeworfen[75], zusätzlich aber auch Wegbereiter des Faschismus zu sein[76]. Alfred Kurella, der diese These 1938 aufbrachte, war sich der Parallelität zwischen faschistischer Verfemung und sozialistischer Diffamierung ein und derselben Kunstrichtung durchaus bewusst. Eine ausführliche Diskussion darüber, warum der als große Bedrohung empfundene Faschismus und die stalinistische Sowjetunion, die als Retter vor dieser Gefahr gesehen wurde, beide den Expressionismus als verfehlt und bedrohlich erachteten, vermied Kurella, in dem er behauptete: „Wenn zwei das selbe sagen, so ist es nicht dasselbe.“[77]
Die Übereinstimmung in der Deutung des Expressionismus als verkommene Kunstform ist nicht die einzige, die sich in der ästhetischen Auffassung und in der Musikpolitik des nationalsozialistischen Deutschlands und der Sowjetunion finden lässt. Sie belegt aber, wie sehr sich diese beiden totalitären Systeme, besonders seit dem verstärkten Einfluss Stalins, in ihrer Kunstauffassung glichen. Die Politisierung der musikalischen Diskussion von rechts und die politische Funktionalisierung der Musik von links sind offenbar zwei Phänomene, die in ständiger Wechselwirkung standen und sich aus ihrer Unvereinbarkeit heraus gegenseitig zuspitzten.
Das Bestreben, Musik mit in die Verantwortung für politische Umstände und Veränderungen zu nehmen, ist ein Traditionsstrang, der schon bei Platon nachzuweisen ist: Dieser räumt der Musik in seiner Staatsutopie eine wichtige Rolle ein.[78] Die Kompositionen, die sich einem bestimmten politischen Zweck widmeten, oder zu politischen Ereignissen Stellung nahmen sind unübersehbar - hier sei nur an die Titelgenese von Beethovens „Eroica“ erinnert.[79] Daher hat auch die Musik ihren Beitrag zum deutschen nation building beigetragen, wie Herfried Winkler anhand des „Freischütz“ und der „Meistersinger“ nachweist.[80] Aber erst mit der Radikalisierung der politischen Systeme zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte dann eine Entwicklung ein, die schon die Wahl der musikalischen Form zu einem Politikum werden ließ und darüber entschied, ob ein Komponist innerhalb eines Systems arbeiten durfte, oder nicht.[81]
Die DDR, die sich nach dem 2. Weltkrieg als Satellitenstaat der Sowjetunion formierte, beruhte auf einem Gründungsmythos, der sich „zum einen gegen das NS-Regime [...] als zu überwindenden Tiefpunkt der deutschen Geschichte stellt und zum anderen gegen den kapitalistisch- imperialistischen Westen, den der amtliche Marxismus [...] unbeirrbar als Hort von Ausbeutung, Unterdrückung, Kriegsvorbereitung und neuen ‚Faschismen’ sah.“[82]
Der Nachweis faschistoider Züge in der Kulturpolitik und den verschiedenen Ästhetikdebatten[83] wäre in der DDR selbst undenkbar gewesen. Im Rückblick erscheinen diese aber fast unübersehbar.[84]
[...]
[1] Kalle, Matthias, 2003, S. 67-74.
[2] Der Urheber dieses Zitats ist leider nicht mehr zu ermitteln. Dass es nach wie vor Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gibt, bestätigt etwa der jährliche „Bericht zum Stand der Wiedervereinigung“ der Bundesregierung.
[3] Gojowy, Detlev, 1990, S. 244.
[4] Im Gegensatz zur ostdeutschen Literatur, die etwa durch Christa Wolf, Peter Hacks oder Gunther Kunert im westdeutschen Bewusstsein vertreten war.
[5] Rebling, Eberhard, zit. nach: Dibelius, Ulrich; Schneider Frank, 1, 1993, S. 134.
[6] So bezeichnet durch: Meyer, Ernst-Hermann, 1952, S. 147.
[7] Rebling, Eberhard, zit. nach: Dibelius, Ulrich; Schneider Frank, 1, 1993, S. 135.
[8] Hier zit. nach: Greshake, Giesbert, 1980, S. 77.
[9] Bibliographischer Nachweis der einschlägigen Werke, z.B. Berg, Michael, Weimar 2001; zur Weihen, Daniel, Köln 1999. Darüber hinaus, siehe:“ Anhang II, Verzeichnis verwendeter Literatur“.
[10] Kirmße, Heidi (Hrsg.), Für die sozialistische Feier, Totengedenken, Vokalmusik 2 , 1963.
[11] Dessau, Paul, Sinfonischer Trauer mar sch zu Ehren des ermordeten Volkspolizisten Helmut Just , 1953.
[12] Mauersberger, Rudolf, Dresdner Requiem, für 3 Chöre à cappella, Knabensoli, Bläser, Schlagzeug und Orgel , 1948.
[13] Dessau, Paul, In memoriam B. Brecht , 1957; Schmidt, Christfried, In memoriam Martin Luther King , 1968.
[14] Zechlin, Ruth, Lidice, Kantate für Bariton, Chor und Orchester , 1958; Medek, Tilo, Kindermesse. Zum Gedenken an die im Dritten Reich ermordeten Kinder , 1974.
[15] Siehe Berg, Michael, 2001, S. 36. 16Zu diesem Komplex, siehe S. 5-7. 17Bloch, Ernst, 1959.
[18] Meyer, Ernst Hermann, 1952, S. 77.
[19] Vgl. hierzu: „Kapitel 2.3 Die Grundlagen im Nationalsozialismus“, S 19-25.
[20] Die im liber usualis niedergeschriebene Missa pro defunctis ist für Requiemkompositionen seit der ersten mehrstimmigen Trauermesse Josquin Desprez’ stilprägend.
[21] Das castrum doloris spielt in den Trauerfeierlichkeiten der barocken Donaumonarchie eine wichtige Rolle. Vgl.: Riedel, Friedrich, 1977, S. 181-184.
[22] Bredekamp, Horst, et al., 2004.
[23] Burmeister, Hans-Peter, 2001, S. 271.
[24] „Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.“ Zit. nach: Marx Engels Gesamtausgabe, Bd. 1, S. 378.
[26] Jacobi, Fritz, 2003, S. 61.
[27] Stiller, Günther, 1975, S. 343.
[28] Becher, Johannes R., 1995, S. 396.
[30] Bloch, Ernst, 5, 1959, S. 1378.
[31] Mitscherlich, Alexander; Mitscherlich, Margarethe, ²1977.
[32] Ebd., S. 9.
[33] Siehe dazu: „Kapitel 2.5 Sozialistische Musikästhetik“ S. 29-35.
[34] „Die Musik ist also keineswegs, gleich den anderen Künsten, das Abbild der Ideen, sondern Abbild des Willens selbst.“ Zit. nach: Schopenhauer, Arthur, 1977, S. 248.
[35] Abgedruckt in: Dibelius, Ulrich; Schneider Frank, 1, 1993, S. 68-70.
[36] So etwa Hans Marchwitza: „Ich bleib der Hans der Kohlenhäuer,/ Und steckt Ihr mich ins Märchenhaus,/ Bin ich ein Berg von Kraft und Feuer,/ Und brech aus jedem Sessel aus!“ dichtete er als Diskussionsbeitrag für die Bitterfelder Konferenz 1959. Hier zit. nach: Berg, Michael, 2001, S. 24.
[37] Vgl.: Glaser, Hermann, 1999, S. 33-35.
[38] „Die Überlebenden waren in der Regel gerade nicht die Widerständler, die Integren, sondern all jene, die, ob Zivilisten oder Soldaten, […] sich jetzt [...], voller innerer Abwehr und ohne das Bedürfnis nach Einsicht der reinen Gegenwartsbewältigung zuwandten.“ Zit. nach: Emmerich, Wolfgang, 1997, S. 30. Auch: Klingenberg, Lars, (Rostock 2001), S. 251.
[39] Der Bezugspunkt der jüngeren Komponistentradition im gesamten Nachkriegsdeutschland ist insbesondere die Musik Paul Hindemiths. Vgl.: Berg, Michael, Rostock 2000, S. 235-236.
[40] Jacobi, Fritz, 2003, S. 63-71.
[41] Theodor W. Adorno hat sich in seinem Aufsatz „Kulturkritik und Gesellschaft“ mit der Frage nach der Möglichkeit von Kunst im Angesicht des faschistischen Terrors auseinandergesetzt und damit im Westen eben dieser Diskussion eine Plattform gegeben. Adorno, Theodor W., Frankfurt/Main 1997, Bd. 10.1, S. 30.
[42] Beginn der katholischen Missa pro defunctis.
[43] Schneider, Hans Wolfgang, 1987, S. 8.
[44] Braun, Werner, 9, 1998, Sp. 749-769.
[45] Die Ursprünge der katholischen Totenmesse reichen bis in die frühchristliche Tradition Roms zurück. Die gregorianische Totenmesse ist in der heute bekannten Form auf dem Tridentiner Konzil von 1563 beschlossen worden. Vgl. Robertson, Alec, 1967.
[46] Ebd., S. 11.
[47] Zit. nach Braun, Werner, 9, 1998, Sp. 751.
[48] Ebd.
[49] Gothaer Cantionale Sacrum (Gotha 1646-1648)
[50] Schon früh entstehen zahlreiche Gedenkkompositionen für verstorbene Komponistenkollegen, etwa Josquins déploration „nymphes des bois“ für Johan Ockeghem“ (1545), oder Heinrich Schütz’ Gedenkkomposition für Johann Schein „Das ist ja gewißlich wahr“ (1631).
[51] Etwa die Tombeaux für Jean-Baptiste Lully durch Marin Marais und Jean-Ferry Rebel.
[52] Wie es etwa Helga Thoene für J.S. Bachs Ciaconna der d-Moll Partita für Violine Solo BWV 1004 nachweist. Thoene, Helga, 2001, S. 19-28.
[53] Riedel, Friedrich, 1982, S. 154.
[54] Zit. nach: Kleinicke, Konrad-Jürgen, 1986, S. 124.
[55] Braun, Werner, 9, 1998, Sp. 765.
[56] Vgl. Robertson, Alec, 1967, S. 85.
[57] Schneider, Hans Wolfgang, 1987, S. 348-376.
[58] Abert, Anna Amalie, 1966, Sp. 1439.
[59] Hanslick, Eduard, 81891.
[60] Ebd., S. 48.
[61] Schneider, Hans Wolfgang, 1987, S. 12-16.
[62] Trotzki, Leo, 1973, S. 153.
[63] Meyer, Michael, 1990, S. 43.
[64] Für das NS-System: Mayer, Anton, 1933, für die DDR: Meyer, Ernst Hermann, 1953.
[65] Lunatscharski, Anatoli, 1974.
[66] Redepenning, Dorothea, 3, 1998, S. 4.
[67] Siehe hierzu die Dokumentation: Heister, Hanns-Werner, 2001.
[68] John, Eckhard, 1994, S. 41. Nähere Definition des Begriffs ‚Musikbolschewismus’, siehe S. 21 dieser Arbeit.
[69] Redepenning, Dorothea, 2, 1998, S.36.
[70] Mayer, Anton, 1933, S. 400.
[71] Mayer, Anton, 1933, S. 394.
[72] Vgl.: Barron, Stephanie (Hrsg.), 1992.
[73] Zu diesem Themenkomplex siehe auch „Kapitel 2.4 Die Grundlagen in der Sowjetunion“, S. 25-29.
[74] Mayer, Anton, 1933, S. 392.
[75] Lukács, George, zit. nach: Schmitt, Hans Jürgen, 1973, S. 192.
[76] Ziegler, Bernhard, „Nun ist dies Erbe zuende...“, zit. nach: Schmitt, Hans Jürgen, 1973, S. 50.
[77] Ziegler, Bernhard, Schlußwort , zit. nach: Schmitt, Hans Jürgen, 1973 S. 232.
[78] „Damon behauptet - und ich glaube es ihm: Nirgends wird an den Gesetzen der Musik gerüttelt, ohne dass auch die höchsten Gesetze des Staates ins Wanken geraten .“ Platon: Der Staat. 1949, S. 119.
[79] Nachdem Beethoven seine 3. Symphonie ursprünglich Napoleon widmete, nannte er sie - durch die Selbstkrönung Napoleons enttäuscht - in „Eroica“ um. Im Kontext dieser Arbeit sei auch darauf hingewiesen, dass der 2. Satz als „Marcia funèbre“ bezeichnet ist.
[80] Winkler, Herfried, 2001, S. 45-60.
[81] John, Eckhard, 1994, S. 28.
[82] Emmerich, Wolfgang, 1997, S. 29.
[83] In der SU sind hier insbesondere die Debatten um Schostakowitschs Oper „Lady Macbeth“ und Muradelis Oper „Die große Freundschaft“ zu nennen. In der jungen DDR entstehen ähnliche Debatten um Dessaus Oper „Lukullus“ und Eislers „Dr. Faustus“.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein umfassender Sprachentwurf, der den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es befasst sich mit Trauermusik in der SBZ/DDR, ihren historischen und theoretischen Grundlagen, und der Struktur musikpolitischer Einflussnahme.
Worum geht es in der Vorbemerkung?
Die Vorbemerkung behandelt die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und die anschließende Wiedervereinigung. Sie reflektiert die weiterhin bestehenden Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen und deren Auswirkungen auf die Wahrnehmung kultureller Werte. Sie beschreibt auch die Zielsetzung des Autors, die musikalische Entwicklung in der SBZ/DDR im Bereich der Trauermusik neutral zu betrachten.
Welche Themen werden in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Forschung zur Musikgeschichte der SBZ/DDR, insbesondere zur Kirchenmusik und religiös geprägten Musik. Sie behandelt die Einflüsse auf die Komposition von Trauer- und Gedenkmusiken, die von der Geschichte der Trauermusik bis zu den kulturpolitischen Gegebenheiten in der SBZ/DDR reichen. Sie thematisiert die staatliche Einmischung in künstlerische Prozesse und die sozialistische Ideologie.
Was sind die historischen und theoretischen Grundlagen der Trauermusik (Kapitel 2)?
Kapitel 2 dient als Einführung in das Thema und beschreibt die gattungsgeschichtlichen Voraussetzungen der Trauermusik. Es beleuchtet die historischen und musikpolitischen Vorgängersysteme der SBZ/DDR und stellt die Grundlagen der ästhetischen Diskussion in sozialistischen Systemen dar.
Was beinhaltet der Abschnitt "Zur Trauermusik" (2.1)?
Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeinen soziologischen Bedingungen, die die Künstler in der DDR vorfanden, und die musikgeschichtlichen Grundlagen der besprochenen Werke. Er thematisiert das Totengedenken und die Trauer als verbindendes Element aller Werke. Er gibt einen Überblick über die Forschung zur Trauermusik und die Entwicklung der Missa pro defunctis in der christlichen Tradition.
Welche Aspekte werden in "Musik in totalitären Systemen des frühen 20. Jahrhunderts" (2.2) behandelt?
Dieser Abschnitt behandelt die Rolle der Musik in totalitären Systemen wie dem faschistischen Deutschland und der Sowjetunion. Er beschreibt die Politisierung der Musik, die Zensur avantgardistischer Kunst und die Verfemung bestimmter Komponisten und Stile. Er vergleicht die Kunstauffassungen und Musikpolitik des nationalsozialistischen Deutschlands und der Sowjetunion.
Was ist die Bedeutung der Abkürzungen und Kurzbiographien im Anhang?
Der Anhang I enthält ein Abkürzungsverzeichnis, während Anhang III Kurzbiographien wichtiger Personen im Kontext der Trauermusik in der DDR bietet.
Was sind die Schlüsselwörter oder Themen in diesem Dokument?
Schlüsselwörter umfassen Trauermusik, SBZ/DDR, Nationalsozialismus, Sowjetunion, sozialistische Musikästhetik, Requiem, musikpolitische Einflussnahme, Exilerfahrung, Bitterfelder Weg, Todesfuge, Staatskunst, Antifaschismus, und Vergangenheitsbewältigung.
- Arbeit zitieren
- Alexander von Nell (Autor:in), 2004, Trauerkompositionen & Requien in der DDR, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114798