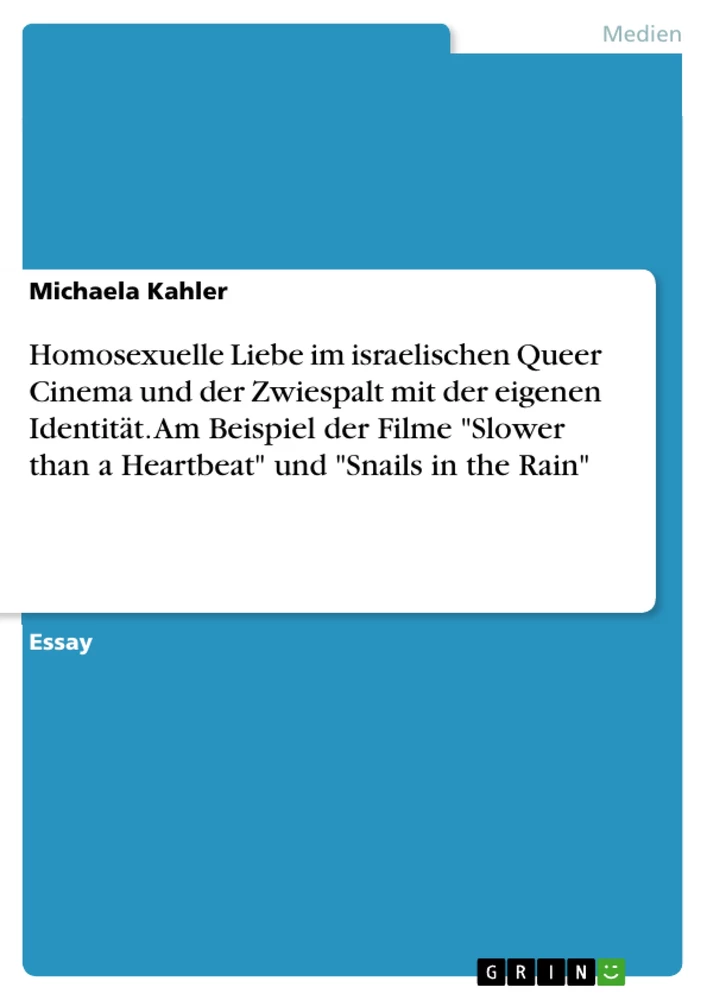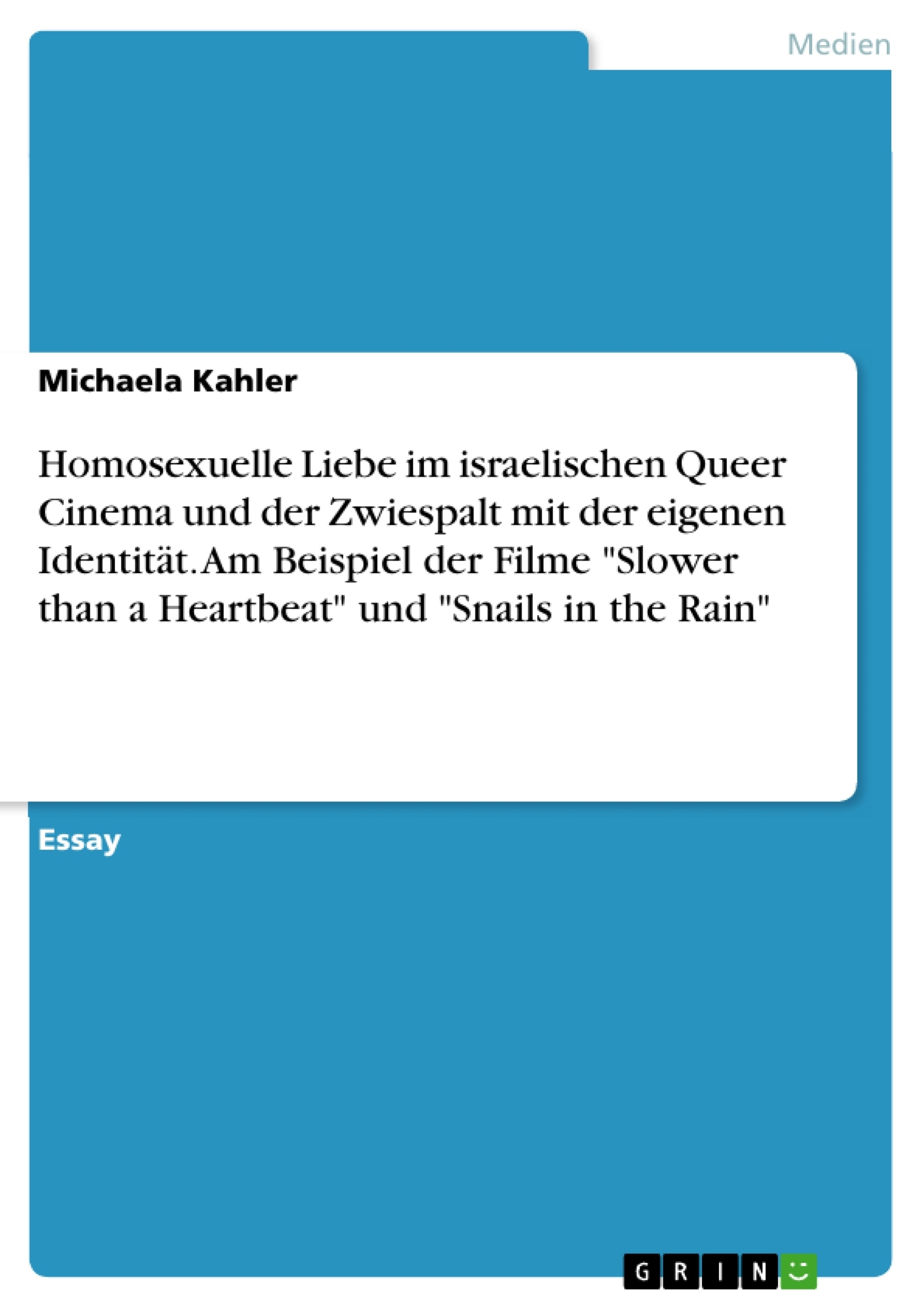Das Essay beschäftigt sich mit der Darstellung homosexueller Liebe im israelischen Queer Cinema und dem Zwiespalt mit der eigenen Identität, am Beispiel der Filme "Slower than a Heartbeat" und "Snails in the Rain". Israel ist ein Land, das spannende Filme mit schwuler, lesbischer und queerer Thematik produziert, die auf Festivals große Erfolge feiern, von der Kritik gelobt und vom Publikum geliebt werden. So zeigen etwa Filme, wie "Slower than a Heartbeat" von Yanai Goz und Yoni Zicholt sowie Yariv Mozer’s "Snails in the rain", die Lebenslagen von queeren Personen in Tel Aviv auf. Dies ist allerdings nur eine Sichtweise, die aus den oben genannten Filmen entnommen werden können.
Ein anderer und gleichzeitig wesentlicher Fokus dieser Filme bildet das Verhältnis zwischen der Homosexualität beziehungsweise der homosexuellen Liebe in Tel Aviv und dem Zwiespalt mit der eigenen Identität, die in den beiden Filmen unterschiedlich dargestellt werden. Folglich befasst sich dieses Essay mit der Frage, wie schwule Personen in Tel Aviv mit geschlechtlichen und sexuellen Identitäten und Wünschen umgehen, die den Lehren ihrer religiösen Traditionen beziehungsweise der gesellschaftlichen Werte und Normen ihres Landes widersprechen. Doch bevor auf diese Frage in Verbindung mit den erwähnten Filmen eingegangen werden kann, muss ferner erläutert werden, wie die gesellschaftliche Lage in Tel Aviv und die Rechtslage von LGBTQI*-Personen in Israel ist, aber auch welche Männlichkeiten in Israel präsent sind und wie diese präsentiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesellschaftliche Situation von Homosexualität in Tel Aviv
- Rechtslage von Homosexualität in Israel
- Hegemoniale Männlichkeit vs. Männlichkeiten in Tel Aviv
- Hegemoniale Männlichkeit
- Militärische Männlichkeit in Israel
- Queere Männlichkeit in Tel Aviv
- Tel Aviv als eine „Bubble“
- Homosexualität in der ultraorthodoxen (Haredi) Community
- Der „Konflikt“ mit der (Queeren) Identität in Slower than a Heartbeat und Snails in the Rain
- Freddy aus Slower than a Heartbeat
- Die Bedeutung des Wassers
- Ist Freddy homosexuell?
- Zwischen zwei Welten
- Boaz aus Snails in the Rain
- Blicke
- Der letzte Brief - Die Entscheidung
- Heterosexualität siegt über Homosexualität
- Freddy aus Slower than a Heartbeat
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Darstellung homosexueller Liebe im israelischen Queer Cinema und den damit verbundenen Identitätskonflikt. Anhand der Filme "Slower than a Heartbeat" und "Snails in the Rain" wird analysiert, wie homosexuelle Personen in Tel Aviv mit geschlechtlichen und sexuellen Identitäten umgehen, die im Widerspruch zu religiösen Traditionen und gesellschaftlichen Normen stehen. Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftliche und rechtliche Situation von LGBTQI*-Personen in Israel, untersucht verschiedene Männlichkeitsbilder und analysiert die Herausforderungen und Ambivalenzen der queeren Identität im Kontext des israelischen Gesellschaft.
- Darstellung homosexueller Liebe im israelischen Queer Cinema
- Identitätskonflikt zwischen homosexueller Orientierung und gesellschaftlichen Normen in Israel
- Gesellschaftliche und rechtliche Situation von LGBTQI*-Personen in Tel Aviv und Israel
- Verschiedene Männlichkeitsbilder im israelischen Kontext
- Analyse der Filme "Slower than a Heartbeat" und "Snails in the Rain"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Umgang homosexueller Personen in Tel Aviv mit Identitäten, die im Widerspruch zu religiösen und gesellschaftlichen Normen stehen. Sie benennt die beiden zu analysierenden Filme und skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit, der die gesellschaftliche und rechtliche Situation von LGBTQI*-Personen in Israel beleuchtet, bevor die filmische Darstellung näher betrachtet wird.
Gesellschaftliche Situation von Homosexualität in Tel Aviv: Dieses Kapitel beschreibt Tel Aviv als eine international anerkannte homofreundliche Stadt. Es werden Beispiele wie die jährlich stattfindende Gay-Pride-Parade, das TLVFest (Tel Aviv's International LGBT Film Festival) und ein Denkmal für homosexuelle Opfer des Nationalsozialismus genannt, um die Akzeptanz und das Engagement der Stadt für die LGBTQI*-Gemeinschaft zu verdeutlichen. Gleichzeitig wird angedeutet, dass diese Offenheit nicht die gesamte Realität widerspiegelt.
Rechtslage von Homosexualität in Israel: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Rechtslage für Homosexuelle in Israel, ausgehend von den diskriminierenden Sodomiegesetzen der britischen Mandatszeit. Es werden wichtige Meilensteine wie das Diskriminierungsverbot von 1992, die Zulassung homosexueller Männer und Frauen zum Militärdienst (1993, erweitert 2013 auf Transgender-Personen), die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und die Legalisierung der Adoption erwähnt. Trotz der Fortschritte wird auch auf anhaltende Herausforderungen und den andauernden Kampf um Gleichstellung hingewiesen.
Schlüsselwörter
Israelisches Queer Cinema, Homosexualität, Heterosexualität, Identität, Tel Aviv, LGBTQI*, Männlichkeit, religiöse Traditionen, gesellschaftliche Normen, Rechtslage, "Slower than a Heartbeat", "Snails in the Rain", Identitätskonflikt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Darstellung homosexueller Liebe im israelischen Queer Cinema"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Darstellung homosexueller Liebe im israelischen Queer Cinema und den damit verbundenen Identitätskonflikt. Sie analysiert, wie homosexuelle Personen in Tel Aviv mit geschlechtlichen und sexuellen Identitäten umgehen, die im Widerspruch zu religiösen Traditionen und gesellschaftlichen Normen stehen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Filme "Slower than a Heartbeat" und "Snails in the Rain".
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftliche und rechtliche Situation von LGBTQI*-Personen in Israel, untersucht verschiedene Männlichkeitsbilder und analysiert die Herausforderungen und Ambivalenzen der queeren Identität im Kontext der israelischen Gesellschaft. Konkret werden die Darstellung homosexueller Liebe im israelischen Queer Cinema, der Identitätskonflikt zwischen homosexueller Orientierung und gesellschaftlichen Normen, die gesellschaftliche und rechtliche Situation von LGBTQI*-Personen in Tel Aviv und Israel sowie verschiedene Männlichkeitsbilder im israelischen Kontext untersucht.
Welche Filme werden analysiert?
Die Seminararbeit analysiert die Filme "Slower than a Heartbeat" und "Snails in the Rain", um die Darstellung homosexueller Liebe und den damit verbundenen Identitätskonflikt zu untersuchen.
Wie wird die gesellschaftliche Situation von Homosexualität in Tel Aviv dargestellt?
Die Arbeit beschreibt Tel Aviv als eine international anerkannte homofreundliche Stadt, wobei jedoch gleichzeitig darauf hingewiesen wird, dass diese Offenheit nicht die gesamte Realität widerspiegelt. Beispiele wie die Gay-Pride-Parade, das TLVFest und ein Denkmal für homosexuelle Opfer des Nationalsozialismus verdeutlichen die Akzeptanz und das Engagement der Stadt für die LGBTQI*-Gemeinschaft.
Wie wird die Rechtslage von Homosexualität in Israel dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Rechtslage für Homosexuelle in Israel, von den diskriminierenden Sodomiegesetzen der britischen Mandatszeit bis hin zu wichtigen Meilensteinen wie dem Diskriminierungsverbot von 1992, der Zulassung homosexueller Männer und Frauen zum Militärdienst und der Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Trotz der Fortschritte werden auch anhaltende Herausforderungen und der andauernde Kampf um Gleichstellung hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Israelisches Queer Cinema, Homosexualität, Heterosexualität, Identität, Tel Aviv, LGBTQI*, Männlichkeit, religiöse Traditionen, gesellschaftliche Normen, Rechtslage, "Slower than a Heartbeat", "Snails in the Rain", Identitätskonflikt.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zur gesellschaftlichen und rechtlichen Situation von Homosexualität in Tel Aviv und Israel. Ein zentrales Kapitel analysiert verschiedene Männlichkeitsbilder, darunter hegemoniale Männlichkeit, militärische Männlichkeit und queere Männlichkeit. Die Analyse der Filme "Slower than a Heartbeat" und "Snails in the Rain" bildet einen weiteren Schwerpunkt. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
- Arbeit zitieren
- Michaela Kahler (Autor:in), 2021, Homosexuelle Liebe im israelischen Queer Cinema und der Zwiespalt mit der eigenen Identität. Am Beispiel der Filme "Slower than a Heartbeat" und "Snails in the Rain", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1148114