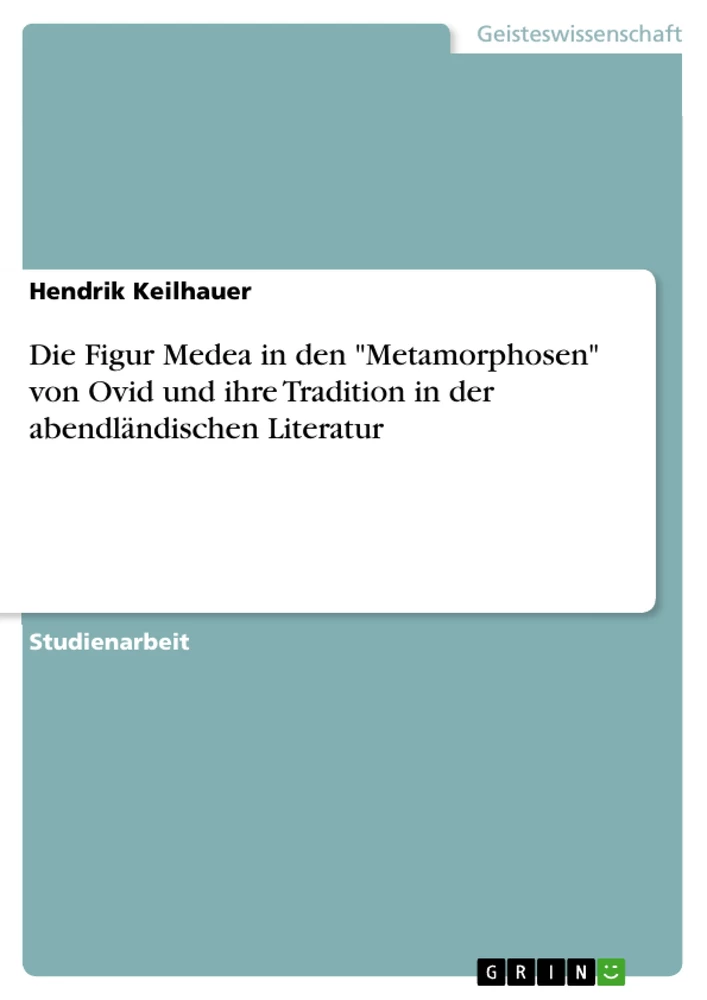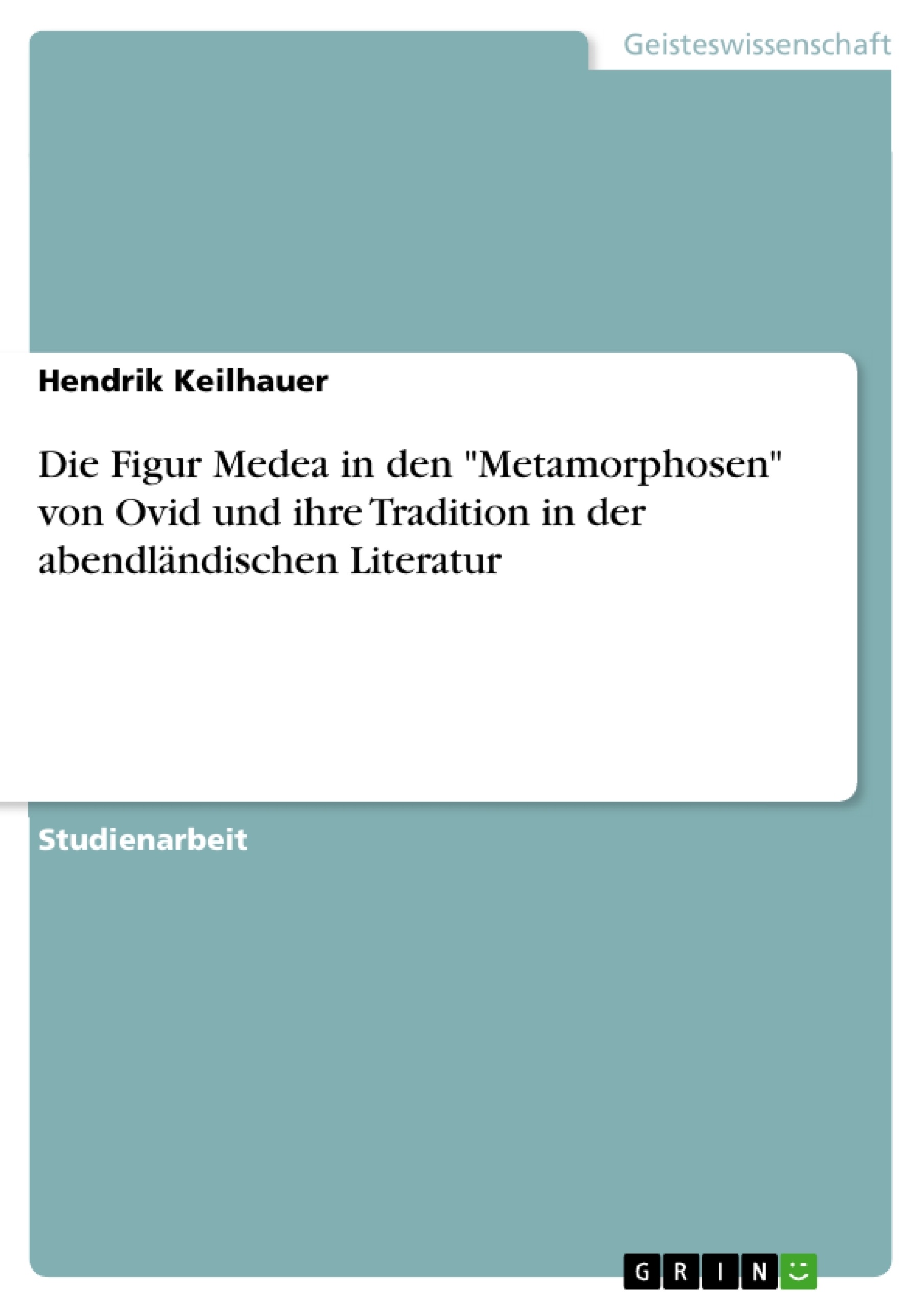Die kolchische Königstochter und Hexe Medea, die ihre Feinde und – von ihrem Mann verlassen – schließlich ihre Kinder tötet, ist eine Figur der antiken Mythologie, die dort wie nur wenige andere auf mannigfaltige Art und Weise in Erscheinung tritt. Sie gilt als eine der größten Zauberinnen des griechischen Mythos’. Zahlreiche Autoren des Altertums haben diesen Sagenstoff bearbeitet, und dies z. T. in sehr unterschiedlicher Manier. Der Mythos wurde innerhalb der letzten zweitausend Jahre ebenso reichhaltig in der Literatur, der Musik und der bildenden Kunst behandelt.
Der römische Dichter PUBLIUS OVIDIUS NASO (20. März 43 v. Chr. – 17 n. Chr.) widmete sich in seinem umfangreichen poetischen Werk ebenfalls dieser damals wie auch heute noch
bekannten sagenhaften Geschichte, und dies sogar mehrfach.
Diese Arbeit wird den Mythos von Medea, in der Form, in der er heute für uns greifbar ist, zu Beginn kurz zusammenfassen, um anschließend einen groben Überblick darüber zu geben, wer
den Sagenstoff vor OVID und auf welche Art und Weise behandelt hat. Danach werden nach einer Kurzbeschreibung von Leben und Werk des Autors die Version(en) und die Art der
Darstellung im Werk des Dichters vorgestellt, wobei das besondere Augenmerk dabei darauf liegt, wie die Medea dem Leser in OVIDs siebten Buch der Metamorphosen präsentiert wird. Die Leitfrage ist demnach: Wie präsentiert OVID seine Medea und was unterscheidet seine Darstellung von seinen Vorläufern und den Vorbildern, auf die er konkret zurückgreift?
Daraufhin folgt eine Darlegung der Rezeption des Medeamythos’ in der Literatur nach OVID, die ebenfalls nur einen Überblick eher episodischen Charakters bieten kann. Abschließen wird
die Arbeit dann mit einem eingehenderen Vergleich der ovidischen Darstellung mit JEAN ANOUILHs Drama Médée. Wichtig bleibt auch hierbei die Fragestellung, worin genau OVID in seiner Version von seinen Vorgängern abweicht.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der (griechische) Mythos in Kurzform
- 2. Der Medeamythos vor OVID
- 3. OVIDS Version(en) des Mythos'
- 3.1 Darstellungsweise der Sage bei OVID: Die Epistulae heroidum und die verschollene Tragödie Medea
- 3.2 Die Medea der Metamorphosen
- 4. Die Rezeption des Mythos' und der ovidianischen Bearbeitung
- 4.1 Allgemeiner Überblick
- 4.2 Je ne sais faire que le mal. - Die Médée JEAN ANOUILHS
- Schlussbetrachtung:
- Bibliographie
- Anhang.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Darstellung des Medea-Mythos in Ovids Werk, insbesondere in den Metamorphosen. Ziel ist es, Ovids Version des Mythos zu analysieren und sie mit früheren Bearbeitungen und der späteren Rezeption des Stoffes in der abendländischen Literatur zu vergleichen. Dabei wird insbesondere auf die Frage eingegangen, wie Ovid seine Medea präsentiert und was seine Darstellung von den Vorbildern unterscheidet.
- Die Darstellung des Medea-Mythos in der Antike
- Ovids Version des Mythos in den Metamorphosen
- Die Rezeption des Mythos in der Literatur nach Ovid
- Der Vergleich von Ovids Darstellung mit Jean Anouilhs Drama Médée
- Die Frage nach den Besonderheiten von Ovids Darstellung im Vergleich zu seinen Vorgängern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und stellt die zentrale Figur des Medea-Mythos vor. Sie erläutert die Bedeutung des Mythos in der Antike und seine vielfältige Rezeption in der Literatur, Musik und bildenden Kunst.
Kapitel 1 bietet eine kurze Zusammenfassung des griechischen Mythos von Medea, der die Geschichte von Iasons Suche nach dem Goldenen Vlies und seiner Beziehung zu Medea erzählt. Es werden die wichtigsten Figuren und Ereignisse des Mythos vorgestellt, darunter die drei Prüfungen, die Medea Iason hilft zu bestehen, der Mord an Apsyrtos und die Flucht nach Iolkos.
Kapitel 2 beleuchtet die Bearbeitung des Medea-Mythos vor Ovid. Es wird auf die frühesten Erwähnungen des Mythos in den Epinikien des Pindaros und in Euripides' Tragödie Medea eingegangen. Außerdem wird die Rolle des Apollonius von Rhodos und seiner Argonautenepos im Kontext der Weiterentwicklung des Mythos beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich Ovids Versionen des Medea-Mythos. Es werden die Darstellungsweise in den Epistulae heroidum und die verschollene Tragödie Medea behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Medea-Figur in Ovids siebtem Buch der Metamorphosen.
Kapitel 4 beleuchtet die Rezeption des Medea-Mythos in der Literatur nach Ovid. Es wird ein Überblick über die vielfältigen Bearbeitungen des Stoffes gegeben, wobei ein besonderer Fokus auf Jean Anouilhs Drama Médée liegt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Medea-Mythos, Ovids Metamorphosen, die Darstellung der Figur Medea, die Rezeption des Mythos in der Literatur, Jean Anouilhs Médée, die Unterschiede zwischen Ovids Darstellung und seinen Vorläufern.
- Citar trabajo
- Hendrik Keilhauer (Autor), 2008, Die Figur Medea in den "Metamorphosen" von Ovid und ihre Tradition in der abendländischen Literatur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114891