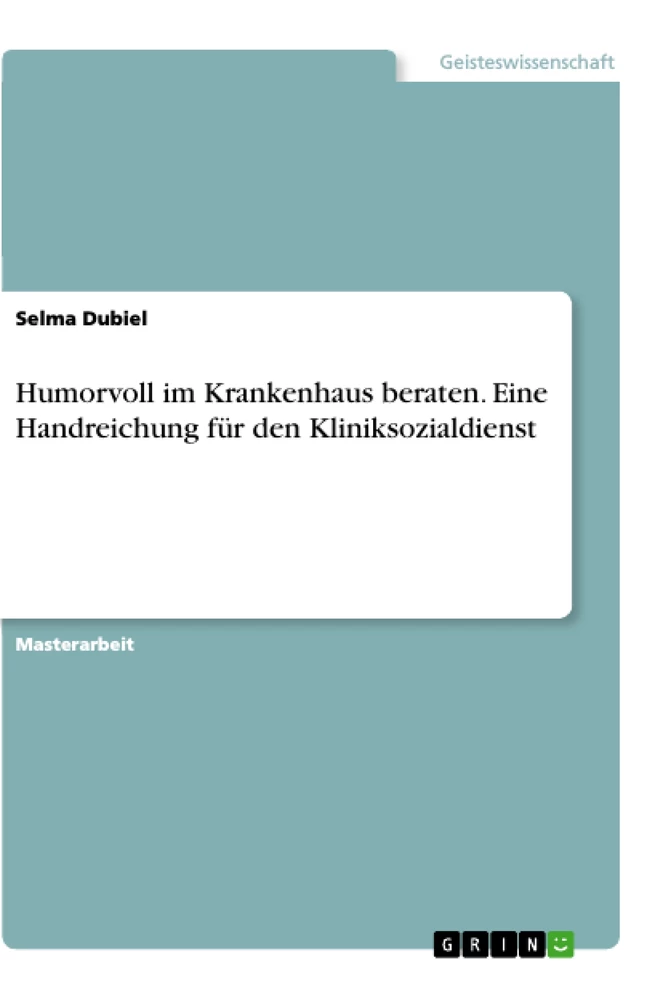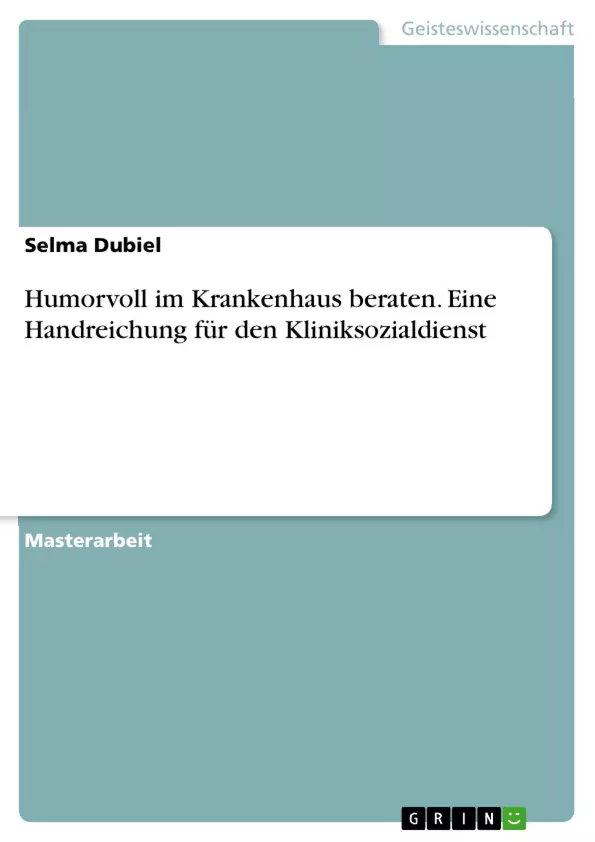Diese Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen der psychosozialen Beratung von Erkrankten und deren Familien in Rahmen des Sozialdiensts und dem Humor. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Beantwortung der Forschungsfragen: Wie kann eine mit Humor unterstützte Beratung in kurzen Beratungssequenzen für Patient*innen hilfreich sein? Was sollte bei der Beratung mit Humor beachtet werden, um Patient*innen nicht zu schaden oder zu kränken?
Die Erkenntnisse aus diesen Fragen werden als eine Handreichung gebündelt und mit Praxishinweisen verdeutlicht. Diese Handreichung soll Sozialdienstmitarbeiter*innen in einem Akutkrankenhaus helfen, humorvoll mit Patient*innen sowie mit sich selbst und mit den stressigen Situationen im Arbeitsalltag umgehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erkenntnisse zum Humor
- 2.1 Begriffsannäherung Humor
- 2.2 Das Lächeln und Lachen – Ergebnisse der Gelotologie
- 2.3 Humorarten
- 3. Humoranregende Angebote in Krankenhäusern
- 3.1 Entwicklung von Humor im Akutkrankenhaus
- 3.2 Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e. V.
- 3.3 Stiftung „Humor hilft heilen“ (HHH)
- 4. Praxisforschender Zugang zur Kliniksozialarbeit
- 4.1 Beschreibung des empirischen Zugangs
- 4.2 Beschreibung der deskriptiven Analysemethodik
- 4.3 Nutzung der Beobachtungsprotokolle
- 5. Praxis der Kliniksozialarbeit im Akutkrankenhaus
- 5.1 Beschreibung des Arbeitsauftrags
- 5.2 Beschreibung der Patient*innenkontakte
- 5.3 Erleben und Emotionen im Akutkrankenhaus
- 6. Eine Handreichung für den Kliniksozialdienst
- 6.1 Was beim Lachen zu beachten ist
- 6.2 (Humor-)Haltung
- 6.3 Beispiele von Humorinterventionen
- 6.4 Selbstfürsorge
- 7. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht den Einsatz von Humor in der psychosozialen Beratung im Kliniksozialdienst. Ziel ist die Entwicklung einer Handreichung, die Sozialarbeiter*innen dabei unterstützt, humorvoll mit Patient*innen und den Herausforderungen des Arbeitsalltags umzugehen. Die Arbeit beantwortet die Forschungsfragen nach der Hilfreichkeit humorvoller Beratung in kurzen Sequenzen und nach Aspekten, die bei der Anwendung von Humor beachtet werden sollten.
- Der Einfluss von Humor auf die psychosoziale Beratung im Krankenhauskontext.
- Die verschiedenen Arten und Funktionen von Humor und deren Anwendung in der Praxis.
- Die Entwicklung einer angemessenen „Humorhaltung“ für Sozialarbeiter*innen.
- Die Bedeutung von Selbstfürsorge für Sozialarbeiter*innen im Umgang mit herausfordernden Situationen.
- Die Erarbeitung von praktischen Beispielen für humorvolle Interventionen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation der Autorin als Sozialarbeiterin in einem Akutkrankenhaus und ihr persönliches Interesse an der Erforschung des Humors im Beratungsalltag. Sie führt die Forschungsfragen ein: Wie kann humorvolle Beratung Patient*innen helfen, und was sollte dabei beachtet werden, um Schaden zu vermeiden? Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil über Humor und einen praktischen Teil mit der Handreichung für den Kliniksozialdienst.
2. Erkenntnisse zum Humor: Dieses Kapitel nähert sich dem Begriff „Humor“ aus verschiedenen Perspektiven an und beleuchtet die Bedeutung von Lächeln und Lachen (Gelotologie). Es werden verschiedene Humorarten diskutiert und der vielschichtige Charakter des Humors herausgestellt, der sowohl positive als auch negative Aspekte umfasst. Die Arbeit räumt mit gängigen Missverständnissen auf und betont die Komplexität einer klaren Definition.
3. Humoranregende Angebote in Krankenhäusern: Dieses Kapitel stellt verschiedene Initiativen vor, die Humor in Krankenhäusern fördern, wie z.B. den Dachverband Clowns in Medizin und Pflege und die Stiftung „Humor hilft heilen“. Es wird die Entwicklung und der Einsatz von Humor im Akutkrankenhauskontext beleuchtet und die positiven Effekte dieser Initiativen im Hinblick auf die Verbesserung des Wohlbefindens von Patient*innen und Mitarbeitern hervorgehoben.
4. Praxisforschender Zugang zur Kliniksozialarbeit: In diesem Kapitel wird die Methodik der Arbeit beschrieben. Es wird ein praxisforschender Ansatz gewählt, der auf der Analyse von anonymisierten Gedächtnisprotokollen von Patient*innengesprächen beruht. Die deskriptive Analysemethodik wird erläutert, sowie die Vorgehensweise bei der Nutzung der Beobachtungsprotokolle. Der Fokus liegt auf der Erfassung humorvoller Interaktionen und abwehrender Reaktionen.
5. Praxis der Kliniksozialarbeit im Akutkrankenhaus: Dieses Kapitel beschreibt den Arbeitsauftrag der Kliniksozialarbeit, die Patient*innenkontakte und das Erleben der Patient*innen im Akutkrankenhaus. Es beleuchtet die Rolle des Humors in der Interaktion und analysiert die emotionalen Aspekte der Situation. Der Abschnitt setzt die vorhergehenden theoretischen Überlegungen in einen konkreten Praxisbezug.
6. Eine Handreichung für den Kliniksozialdienst: Dieses Kapitel präsentiert die zentrale Handlungsempfehlung der Arbeit. Es bietet konkrete Tipps und Richtlinien für den Einsatz von Humor in der Beratung, wobei sowohl positive Aspekte als auch mögliche Risiken und negative Folgen beleuchtet werden. Die Handreichung umfasst Hinweise zur „Humorhaltung“, Beispiele für Humorinterventionen und Aspekte der Selbstfürsorge für Sozialarbeiter*innen.
Schlüsselwörter
Humor, Kliniksozialarbeit, psychosoziale Beratung, Akutkrankenhaus, Gelotologie, Humorinterventionen, Selbstfürsorge, Patient*innenkommunikation, Handreichung, Praxisforschung.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Humor in der psychosozialen Beratung im Kliniksozialdienst
Was ist der Gegenstand der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Einsatz von Humor in der psychosozialen Beratung im Kliniksozialdienst eines Akutkrankenhauses. Sie zielt darauf ab, eine Handreichung für Sozialarbeiter*innen zu entwickeln, die diese darin unterstützt, humorvoll mit Patient*innen und den Herausforderungen des Arbeitsalltags umzugehen.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Hilfreichkeit humorvoller Beratung in kurzen Sequenzen und welche Aspekte bei der Anwendung von Humor beachtet werden sollten, um negative Folgen zu vermeiden. Konkret wird der Einfluss von Humor auf die psychosoziale Beratung im Krankenhauskontext, verschiedene Arten und Funktionen von Humor, die Entwicklung einer angemessenen „Humorhaltung“, die Bedeutung von Selbstfürsorge und praktische Beispiele für humorvolle Interventionen untersucht.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit verwendet einen praxisforschenden Ansatz. Die Datenbasis besteht aus anonymisierten Gedächtnisprotokollen von Patient*innengesprächen. Eine deskriptive Analysemethodik wird angewendet, um humorvolle Interaktionen und abwehrende Reaktionen zu erfassen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Erkenntnisse zum Humor (inkl. Begriffsannäherung, Gelotologie und Humorarten), Humoranregende Angebote in Krankenhäusern (inkl. Dachverband Clowns und Stiftung „Humor hilft heilen“), Praxisforschender Zugang zur Kliniksozialarbeit (inkl. Beschreibung der Methodik), Praxis der Kliniksozialarbeit im Akutkrankenhaus, Eine Handreichung für den Kliniksozialdienst (inkl. Tipps, Richtlinien, Humorhaltung, Beispiele und Selbstfürsorge) und Zusammenfassung und Ausblick.
Was beinhaltet die Handreichung für den Kliniksozialdienst?
Die Handreichung bietet konkrete Tipps und Richtlinien für den Einsatz von Humor in der Beratung. Sie beleuchtet positive Aspekte, mögliche Risiken und negative Folgen. Sie umfasst Hinweise zur „Humorhaltung“, Beispiele für Humorinterventionen und Aspekte der Selbstfürsorge für Sozialarbeiter*innen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Erkenntnisse der Gelotologie (Wissenschaft vom Lachen) und beleuchtet verschiedene Humorarten und deren Funktionen. Sie thematisiert die Komplexität des Humors und räumt mit gängigen Missverständnissen auf.
Welche praktischen Beispiele werden gegeben?
Die Arbeit enthält konkrete Beispiele für humorvolle Interventionen im Kontext der psychosozialen Beratung im Akutkrankenhaus. Diese Beispiele werden in der Handreichung für den Kliniksozialdienst vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Humor, Kliniksozialarbeit, psychosoziale Beratung, Akutkrankenhaus, Gelotologie, Humorinterventionen, Selbstfürsorge, Patient*innenkommunikation, Handreichung, Praxisforschung.
Für wen ist die Arbeit relevant?
Die Arbeit ist relevant für Sozialarbeiter*innen im Kliniksozialdienst, aber auch für alle, die sich für den Einsatz von Humor in der psychosozialen Beratung und im Gesundheitswesen interessieren.
Wo kann ich die vollständige Arbeit einsehen?
Die vollständige Arbeit ist (voraussichtlich) [hier den Zugriffsort einfügen, z.B. in der Universitätsbibliothek einsehbar].
- Citation du texte
- Selma Dubiel (Auteur), 2021, Humorvoll im Krankenhaus beraten. Eine Handreichung für den Kliniksozialdienst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1149307