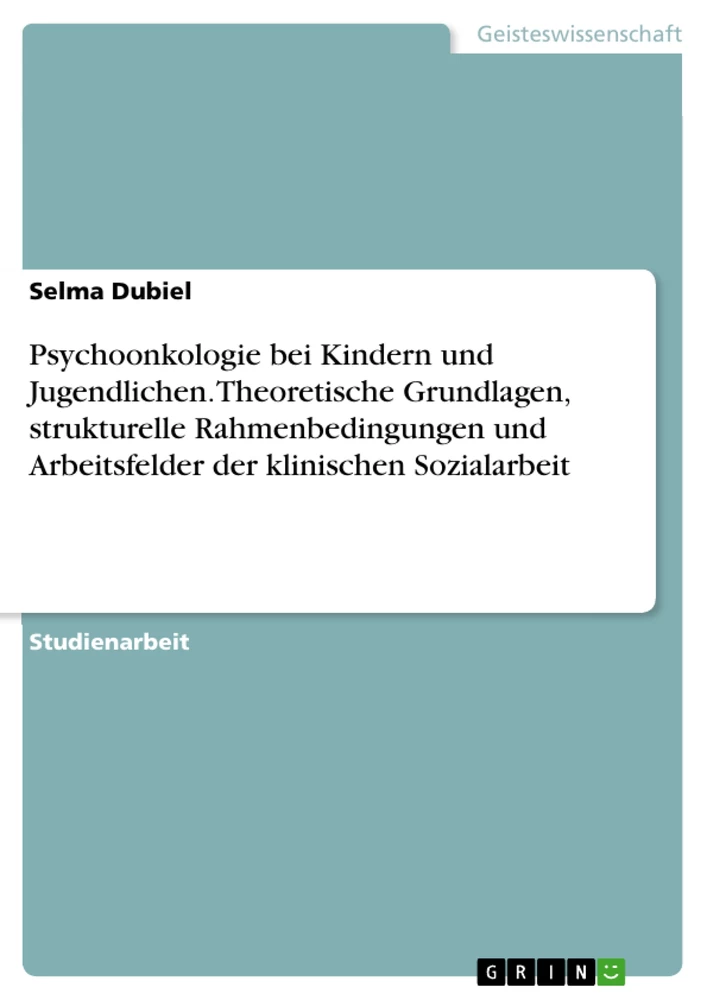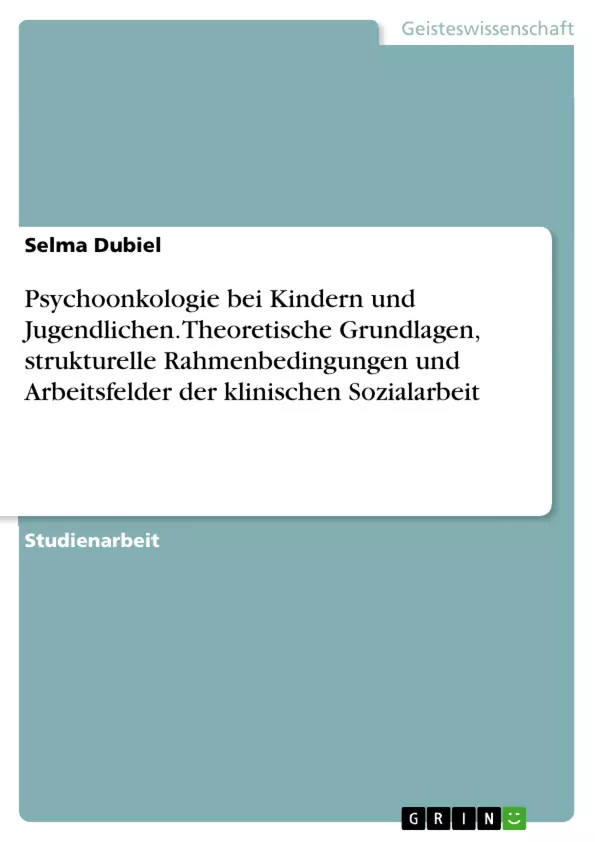Diese Arbeit beschäftigt sich zunächst mit einer theoretischen Erläuterung der Psychoonkologie und deren medizinischen und beratungstechnischen Besonderheiten im Kindes- und Jugendalter. Es folgt eine Vorstellung des Sonnenstrahl e.V. Das ist ein psychoonkologischer Elternverein, der professionell krebskranke Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien in Notsituationen auffängt und berät.
Jährlich erkranken circa 2000 Kinder und Jugendliche an Krebs und hämatologischen Erkrankungen in Deutschland. Die Krankheit selbst, wie auch die intensive Behandlung ist für den jungen Patienten und sein Umfeld sehr belastend und nur schwer zu ertragen. Um eine Genesung bestmöglich zu fördern, wird seit den letzten Jahrzehnten zunehmend die Lebenswelt des Patienten miteinbezogen. Zuvor war es beispielsweise unüblich, dass Eltern bei ihren Kindern auf Station übernachten konnten oder dass das Personal Weiterbildungen zum Umgang von jungen Krebserkrankten und deren Familien besucht. Mit dem heutigen Ziel rückt neben dem Ziel der Gesundung, Rehabilitation und die Erhaltung von Lebensqualität auch die psychosoziale Beratung von Krebskranken in den Fokus. Damit beschäftigt sich die Psychoonkologie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Erklärung
- Definition Psychoonkologie
- Spezifische Aspekte einer Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter
- Praktische Anwendung
- Einblick in den Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche Sonnenstrahl e. V.
- Psychosoziale Beratung zu Krebs
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Psychoonkologie bei Kindern und Jugendlichen, indem sie die theoretischen Grundlagen, strukturellen Rahmenbedingungen und Arbeitsfelder der Klinischen Sozialarbeit am Beispiel des Sonnenstrahl e.V. beleuchtet. Sie analysiert die spezifischen Herausforderungen, die eine Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter mit sich bringt, und beleuchtet die Rolle der psychosozialen Unterstützung in diesem Kontext.
- Definition und Bedeutung der Psychoonkologie
- Spezifische Herausforderungen der Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter
- Rolle der psychosozialen Beratung und Unterstützung
- Beispiel des Sonnenstrahl e.V. als psychoonkologischer Elternverein
- Zusammenhang von Psychoonkologie und Klinischer Sozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand der Psychoonkologie bei Kindern und Jugendlichen vor und beleuchtet die Notwendigkeit von psychosozialen Gesprächen in diesem Kontext. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition der Psychoonkologie und analysiert die spezifischen Herausforderungen einer Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter.
Schlüsselwörter
Psychoonkologie, Kinder und Jugendliche, Krebserkrankung, Klinische Sozialarbeit, Psychosoziale Beratung, Sonnenstrahl e.V., Elternverein, Gesundheitsverhalten, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Psychoonkologie?
Die Psychoonkologie befasst sich mit der psychosozialen Beratung und Unterstützung von Krebspatienten, um deren Lebensqualität und Genesungsprozess zu fördern.
Welche Besonderheiten gibt es bei Kindern und Jugendlichen?
Die Krankheit und Behandlung sind für junge Menschen besonders belastend, weshalb die Einbeziehung der gesamten Familie und Lebenswelt essenziell ist.
Was leistet der Verein „Sonnenstrahl e. V.“?
Der Elternverein bietet professionelle Auffangberatung und Unterstützung für krebskranke Kinder, Jugendliche und deren Familien in Notsituationen.
Wie viele Kinder erkranken jährlich in Deutschland an Krebs?
Jährlich erkranken in Deutschland circa 2.000 Kinder und Jugendliche an Krebs oder hämatologischen Erkrankungen.
Welche Rolle spielt die Klinische Sozialarbeit in diesem Bereich?
Die Klinische Sozialarbeit stellt die strukturellen Rahmenbedingungen und Arbeitsfelder bereit, um Patienten psychosozial durch die schwere Zeit der Behandlung zu begleiten.
- Arbeit zitieren
- Selma Dubiel (Autor:in), 2018, Psychoonkologie bei Kindern und Jugendlichen. Theoretische Grundlagen, strukturelle Rahmenbedingungen und Arbeitsfelder der klinischen Sozialarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1149308