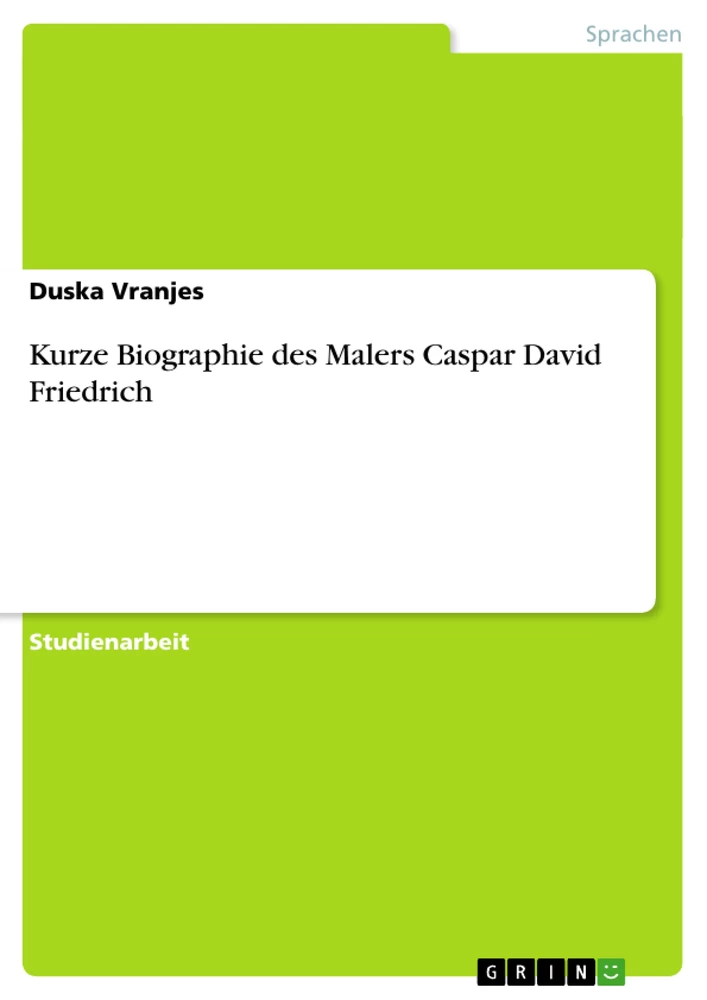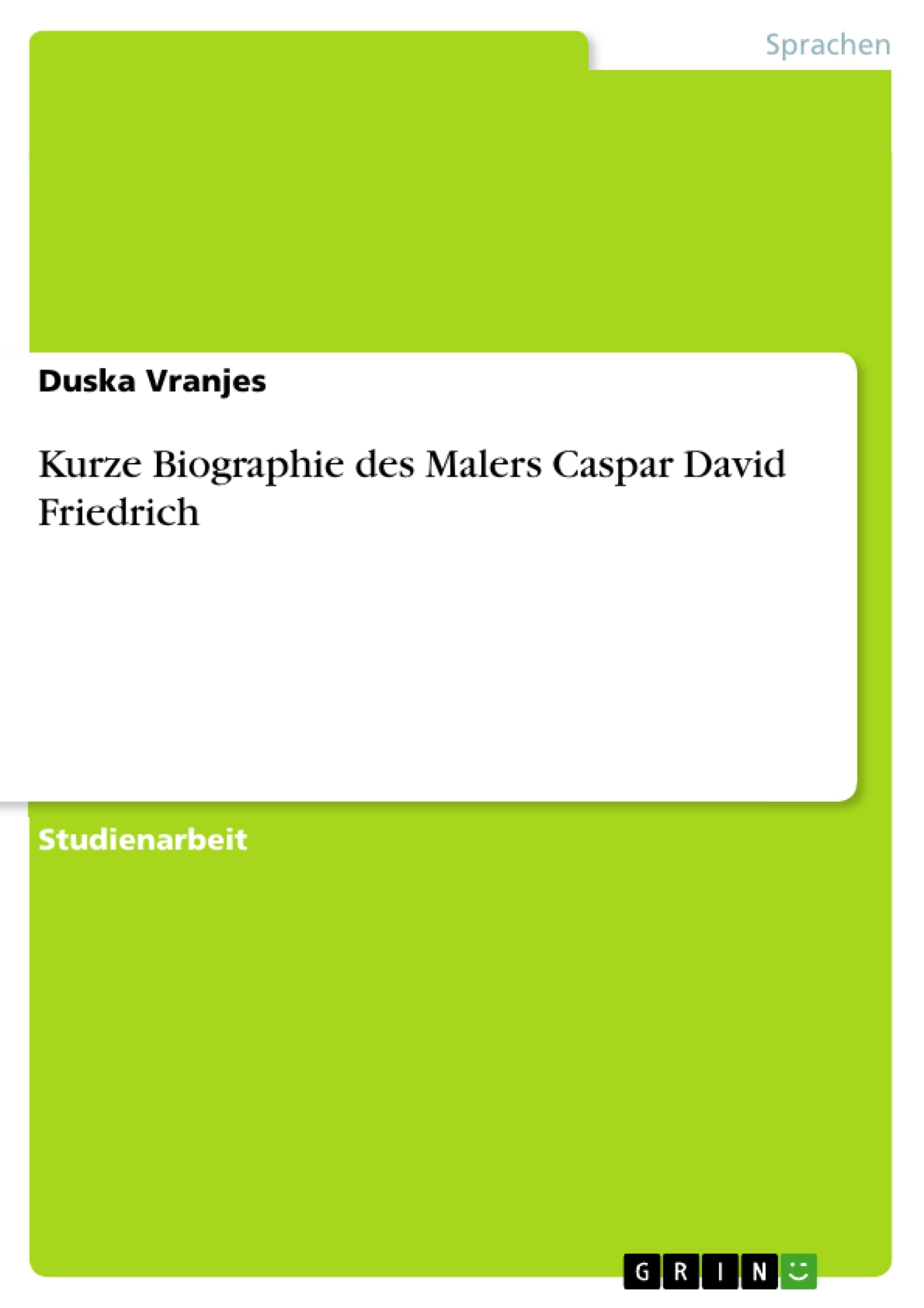Die Werke Caspar David Friedrichs, die bis heute Kunstliebhaber bewegen , haben im Laufe der Jahre viele Interpretationsansätze Kritik, wie Lob erfahren müssen. Die Symbolsprache, die Metaphorik, sowie die ideologische Aussage seiner Bilderhaben viele Diskussionen entfacht. Friedrichs poetische Auffassung von Kunst, seine Art Bilder als Instrument zur Vermittlung von Gefühlen und Gedanken durch einfachen Symbolismus zu nutzen, will erst verstanden werden.
Bei dem Versuch der Deutung von Caspar David Friedrichs Bildern stößt man auf das Problem der Konventionen der religiösen Sprache. Der Versuch Parallelen zur traditionellen religiösen Symbolik zu ziehen, reduziert den Inhalt Friedrichs Bilder auf religiöse Dogmatik und verfehlt somit den Kern der Bedeutung.
Im folgenden soll auf das Leben Caspar David Friedrichs eingegangen werden, mit dem Ziel des Versuchs der Annäherung an Friedrichs Einstellung zur Gesellschaft, Religion, Leben und der Einwirkung dieser auf seine Kunst. Es sollen die äußeren und inneren Einflüsse diskutiert werden, die sich auf Friedrichs Malerei ausgewirkt haben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die romantische Bewegung
- III. Lebenslauf
- IV. Die Zeit in Kopenhagen
- V. Dresden
- VI. Die Heirat
- VII. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Leben und Werk Caspar David Friedrichs. Sie zielt darauf ab, Friedrichs Einstellung zur Gesellschaft, Religion und Leben zu beleuchten und den Einfluss dieser auf seine Kunst zu untersuchen. Dabei werden die äußeren und inneren Einflüsse diskutiert, die seine Malerei prägten.
- Die romantische Bewegung und ihr Einfluss auf Caspar David Friedrich
- Friedrichs Biografie und seine künstlerische Entwicklung
- Die Symbolik in Friedrichs Werken
- Die Rolle von Religion und Spiritualität in Friedrichs Kunst
- Friedrichs Verhältnis zur Natur und Landschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I. Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Relevanz von Caspar David Friedrichs Werken. Es werden die Interpretationsansätze und die ideologische Aussage seiner Bilder beleuchtet.
Kapitel II. Die romantische Bewegung beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Romantik im Kontext der französischen Revolution und den Auswirkungen auf Deutschland. Die Rolle der Romantik im Hinblick auf die nationale Identität und die Rückbesinnung auf traditionelle Werte wird diskutiert.
Kapitel III. Lebenslauf gibt einen chronologischen Überblick über das Leben von Caspar David Friedrich.
Kapitel IV. Die Zeit in Kopenhagen beschreibt Friedrichs Zeit in Kopenhagen und dessen Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung.
Kapitel V. Dresden befasst sich mit Friedrichs Zeit in Dresden und seinen künstlerischen Kontakten in dieser Stadt.
Kapitel VI. Die Heirat behandelt Friedrichs Heirat und dessen Auswirkungen auf sein Leben und seine Kunst.
Schlüsselwörter
Caspar David Friedrich, Romantik, deutsche Kunst, Landschaftsmalerei, Symbolik, Religion, Spiritualität, Natur, Landschaft,
- Arbeit zitieren
- Duska Vranjes (Autor:in), 2001, Kurze Biographie des Malers Caspar David Friedrich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11495