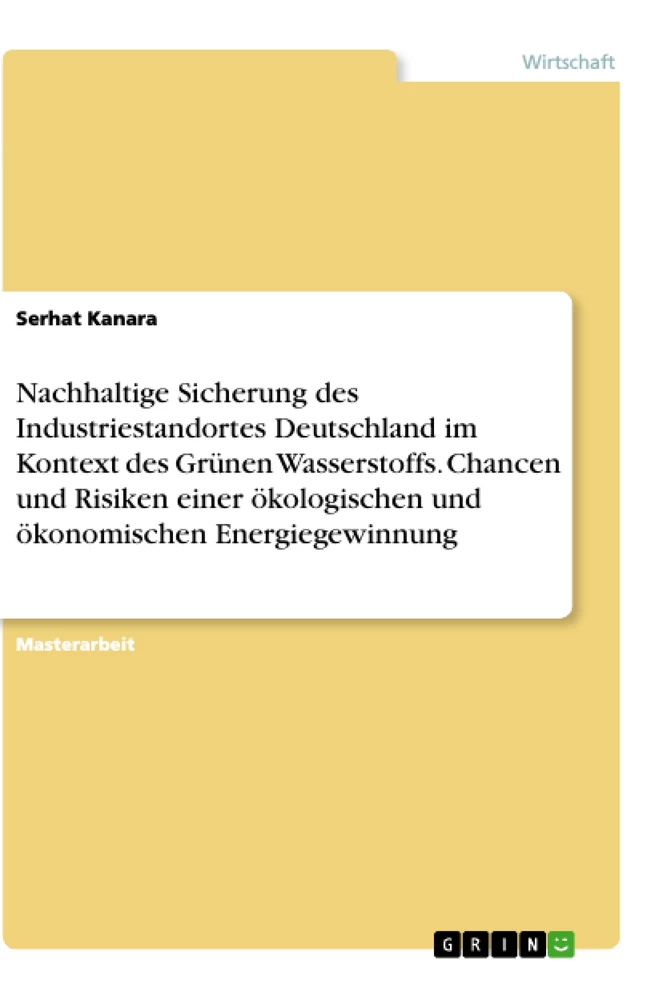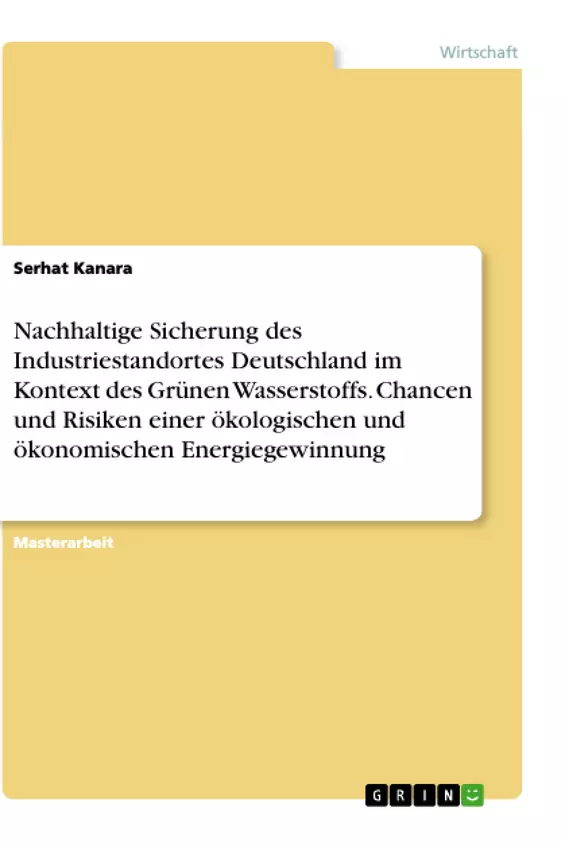Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Analyse des Energieträgers grüner Wasserstoff, sowie eine darauf basierende ökonomische und ökologische Beurteilung des Nutzungspotenzials von regenerativen Energieträgern mit Hinblick auf den Industriestandort Deutschland. Als Grundlage soll ebenso die wissenschaftliche Forschungsfrage dienen, welche Bedeutung eine grüne, nachhaltige Energiegewinnung für den Industriestandort Deutschland hat und vor allem, ob mögliche Veränderungen in den betroffenen Branchen und Industrien, durch eine Umstellung von fossilen Brennstoffen hin zu grünem Wasserstoff zu erkennen sind. Zusätzlich wird der aktuelle Stand der Infrastruktur von grünem Wasserstoff näher betrachtet werden. Außerdem werden in dieser Arbeit die Chancen und Risiken der relevanten deutschen Wirtschaftsbranchen wie Automobil, Stahl- und Chemieindustrie sowie Luft- und Seeverkehr im Hinblick auf die Umstellung zu regenerativen Energien kritisch betrachtet, um eine abschließende Gegenüberstellung zwischen Ökonomie und Ökologie zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation und Problemstellung
- Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Nachhaltigkeit und nachhaltige Sicherung
- Herkunft und Definition des Begriffs „Nachhaltigkeit“
- Aspekte der Nachhaltigkeit
- Ökologische Nachhaltigkeit
- Ökonomische Nachhaltigkeit
- Soziale Nachhaltigkeit
- Stellenwert für die Industrie in Deutschland
- Vorteile eines nachhaltigen Unternehmens
- Anforderungen an Industrieunternehmen
- Wachstum durch Nachhaltigkeit?
- Corporate Citizenship
- Stakeholder-Ansatz
- Instrumente der Nachhaltigkeit
- Sustainable Supply Chain Management
- Sustainable Balanced Scorecard
- Grundlagen des Wasserstoffs
- Geschichte und Vorkommen des Wasserstoffs
- Unterschiedliche Varianten und Gewinnformen des Wasserstoffs
- Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Arten
- Warum Wasserstoff die Lösung ist
- Der Grüne Wasserstoff
- Definition und Abgrenzung
- Regenerative Energiegewinnungsmöglichkeiten
- Sonnenenergie
- Windkraft
- Wasserkraft
- Bioenergie
- Vor- und Nachteile des grünen Wasserstoffs
- Die deutsche Wasserstoffstrategie
- Ursprung des grünen Wasserstoffs
- Transport- und Logistikkonzepte
- Grüner Wasserstoff in der deutschen Industrie
- Nutzungspotenziale in unterschiedlichen Branchen der Industrie
- Automobilsektor
- Schifffahrt
- Luftfahrt
- Stahlindustrie
- Gründe für die Nutzung von grünem Wasserstoff in den Industriesektoren
- Innovative Wasserstoff-Projekte
- Kritischer Ausblick
- Fossile Brennstoffe
- Atomkraft
- Nachwachsende Rohstoffe
- Beurteilung des grünen Wasserstoffs
- Ökologische Beurteilung
- Ökonomische Beurteilung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der nachhaltigen Sicherung des Industriestandortes Deutschland im Kontext des Grünen Wasserstoffs. Sie analysiert die Chancen und Risiken einer ökologischen und ökonomischen Energiegewinnung mithilfe von Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird. Dabei werden die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit und deren Bedeutung für die Industrie in Deutschland beleuchtet.
- Die Bedeutung von Nachhaltigkeit für die Industrie in Deutschland
- Die Herausforderungen und Chancen der Nutzung von grünem Wasserstoff
- Die Einsatzmöglichkeiten von grünem Wasserstoff in verschiedenen Industriebranchen
- Die ökonomischen und ökologischen Aspekte der Wasserstoffgewinnung und -nutzung
- Die Rolle des Grünen Wasserstoffs für die zukünftige Energieversorgung Deutschlands
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung ein und erläutert die Relevanz des Themas. Sie definiert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau der einzelnen Kapitel. Das zweite Kapitel widmet sich dem Begriff der Nachhaltigkeit und erläutert seine Bedeutung für die Industrie in Deutschland. Dabei werden die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit, wie ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit, detailliert betrachtet. Das dritte Kapitel geht auf die Anforderungen an Industrieunternehmen im Kontext der Nachhaltigkeit ein. Es analysiert die Rolle von Corporate Citizenship und den Stakeholder-Ansatz.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Grundlagen des Wasserstoffs. Es beleuchtet die Geschichte und Vorkommen des Wasserstoffs, beschreibt die unterschiedlichen Varianten und Gewinnformen und analysiert die Vor- und Nachteile der verschiedenen Arten. Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf den Grünen Wasserstoff. Es definiert den Begriff und grenzt ihn von anderen Wasserstoffarten ab. Anschließend werden die Möglichkeiten der regenerativen Energiegewinnung, die für die Produktion von grünem Wasserstoff eingesetzt werden können, vorgestellt. Darüber hinaus werden die Vor- und Nachteile des Grünen Wasserstoffs sowie die deutsche Wasserstoffstrategie behandelt.
Das sechste Kapitel analysiert die Einsatzmöglichkeiten des Grünen Wasserstoffs in der deutschen Industrie. Dabei werden die Nutzungspotenziale in verschiedenen Branchen wie dem Automobilsektor, der Schifffahrt, der Luftfahrt und der Stahlindustrie betrachtet. Es werden die Gründe für die Nutzung von grünem Wasserstoff in diesen Sektoren erläutert und innovative Wasserstoff-Projekte vorgestellt. Das siebte Kapitel bietet einen kritischen Ausblick auf alternative Energiequellen und ihre Bedeutung für die Zukunft. Es beleuchtet fossile Brennstoffe, Atomkraft und nachwachsende Rohstoffe.
Das achte Kapitel befasst sich mit der Beurteilung des Grünen Wasserstoffs aus ökologischer und ökonomischer Sicht. Es werden die Vor- und Nachteile des Grünen Wasserstoffs im Vergleich zu anderen Energiequellen analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Nachhaltigkeit, Industrie, Deutschland, Grüner Wasserstoff, Energiegewinnung, Chancen, Risiken, ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit, regenerative Energiequellen, Transport- und Logistikkonzepte, Automobilsektor, Schifffahrt, Luftfahrt, Stahlindustrie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist grüner Wasserstoff?
Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser gewonnen, wobei ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien (Wind, Sonne, Wasser) verwendet wird.
Warum ist Wasserstoff wichtig für den Industriestandort Deutschland?
Er ermöglicht die Dekarbonisierung energieintensiver Branchen wie der Stahl- und Chemieindustrie, in denen Strom allein oft nicht ausreicht.
Welche Chancen bietet die Umstellung auf Wasserstoff?
Chancen liegen in der ökologischen Nachhaltigkeit, der technologischen Marktführerschaft und der langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen in einer CO2-neutralen Wirtschaft.
Welche Risiken gibt es bei der Wasserstoffstrategie?
Zu den Risiken zählen die hohen Produktionskosten, die noch fehlende flächendeckende Infrastruktur und die Abhängigkeit von Energieimporten.
In welchen Branchen kann Wasserstoff eingesetzt werden?
Haupteinsatzgebiete sind der Automobilsektor (LKW/Busse), die Schifffahrt, die Luftfahrt und die Schwerindustrie (insb. Stahlherstellung).
Was ist das Sustainable Supply Chain Management?
Es ist ein Instrument, um Nachhaltigkeit über die gesamte Lieferkette hinweg sicherzustellen, was gerade bei der Beschaffung regenerativer Energieträger zentral ist.
- Citar trabajo
- Serhat Kanara (Autor), 2021, Nachhaltige Sicherung des Industriestandortes Deutschland im Kontext des Grünen Wasserstoffs. Chancen und Risiken einer ökologischen und ökonomischen Energiegewinnung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1149676