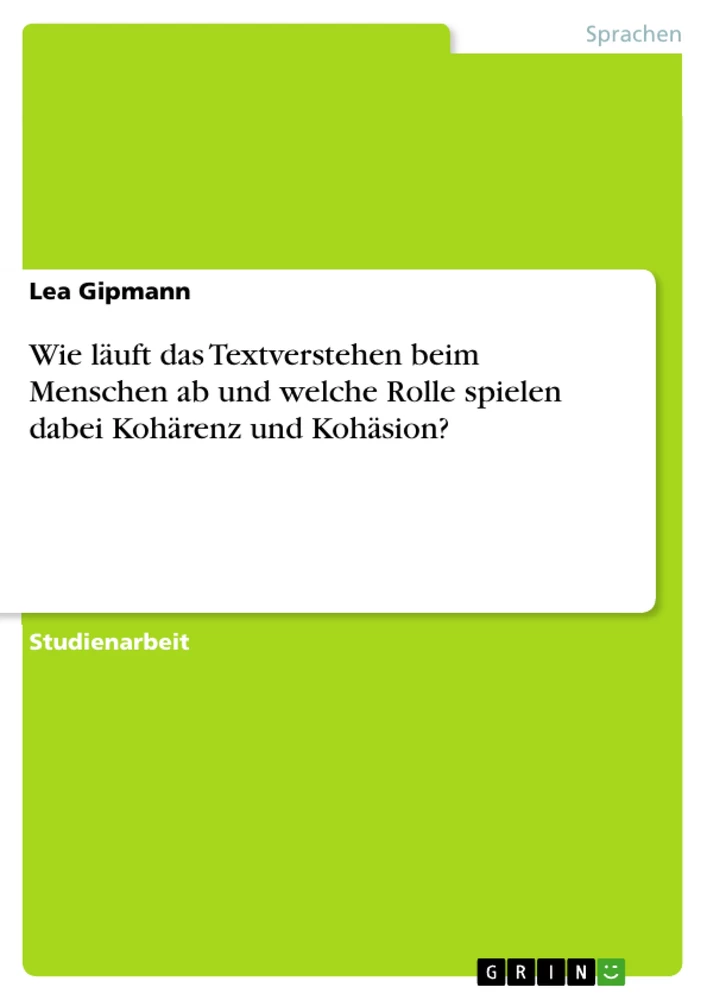In der Hausarbeit wird zum einen das Textverstehen, Kohäsion und Kohärenz definiert sowie auf dieser Grundlage der Ablauf des Textverstehens und die darauf einfließenden Prozesse beschrieben. Hierauf wird anschließend auf die Rolle der Kohäsion und Kohärenz beim Textverstehen genommen. Zusammenfassend wird dann die Frage "Wie läuft das Textverstehen beim Menschen ab und welche Rolle spielen dabei Kohärenz und Kohäsion?" beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Definition Textverstehen
- Kohäsion
- Kohärenz
- Textverstehen
- Wie läuft das Textverstehen ab?
- Modell Kintsch und van Dijk
- Welche Faktoren beeinflussen das Textverstehen?
- Welche Rolle spielen Kohäsion und Kohärenz beim Textverstehen?
- Wie läuft das Textverstehen ab?
- Ausblick: Relevanz für die Schule?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Prozess des Textverständnisses beim Menschen und die Rolle von Kohärenz und Kohäsion dabei. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis dieser komplexen kognitiven Leistung zu entwickeln und die Bedeutung der beiden Konzepte für das erfolgreiche Textverstehen zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung von Textverstehen, Kohäsion und Kohärenz
- Der Prozess des Textverständnisses und seine kognitiven Grundlagen
- Einflussfaktoren auf das Textverstehen
- Die Interaktion von Kohäsion und Kohärenz im Textverständnisprozess
- Relevanz der Erkenntnisse für den Schulunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit im Rahmen des Studiums der Germanistik und Didaktik und formuliert die Forschungsfrage nach dem Ablauf des Textverständnisses und der Rolle von Kohärenz und Kohäsion. Die Autorin erläutert ihre Motivation, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, bedingt durch ihr angestrebtes Berufsziel als Grundschullehrerin. Die Struktur der Arbeit wird skizziert, welche die Definitionen von Textverstehen, Kohäsion und Kohärenz als Grundlage nimmt, um den Prozess des Textverständnisses, seine Einflussfaktoren und die Rolle von Kohärenz und Kohäsion zu beleuchten.
Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beginnt mit einer Diskussion über die Bedeutung des Lesens in der Gesellschaft und die Herausforderungen, die Schüler beim Textverstehen haben. Anschließend werden Textverstehen, Kohäsion und Kohärenz definiert. Textverstehen wird als komplexe kognitive Leistung beschrieben, die von Vorwissen und dem Aufbau einer kohärenten mentalen Repräsentation abhängt. Kohäsion wird als sprachliche Verknüpfung von Sätzen und Textabschnitten definiert, während Kohärenz den inhaltlichen Zusammenhang im Text beschreibt, oft metaphorisch als „roter Faden“ bezeichnet. Sowohl lokale als auch globale Aspekte beider Konzepte werden erläutert.
Textverstehen: Aufbauend auf den im vorherigen Kapitel etablierten Definitionen, befasst sich dieses Kapitel mit dem Prozess des Textverständnisses. Es beantwortet die Fragen nach dem Ablauf des Textverständnisses, den Einflussfaktoren und der Rolle von Kohärenz und Kohäsion. Der Abschnitt verspricht eine ausführliche Auseinandersetzung mit diesen Aspekten, um schlussendlich die eingangs formulierte Forschungsfrage zu beantworten. Obwohl der Text hier endet, lässt sich vermuten, dass dieses Kapitel Modelle des Textverständnisses und empirische Befunde zu den Einflussfaktoren und der Bedeutung von Kohäsion und Kohärenz vorstellen wird.
Schlüsselwörter
Textverstehen, Kohäsion, Kohärenz, Lesekompetenz, kognitive Prozesse, mentale Repräsentation, Vorwissen, Textkohärenz, Textanalyse, Grundschulunterricht.
Häufig gestellte Fragen zum Text "Textverstehen: Kohäsion, Kohärenz und der Prozess des Lesens"
Was ist der allgemeine Inhalt des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Textverstehen. Er definiert zentrale Begriffe wie Kohäsion und Kohärenz, untersucht den Prozess des Textverständnisses und beleuchtet die Rolle von Kohäsion und Kohärenz dabei. Zusätzlich werden Einflussfaktoren auf das Textverstehen diskutiert und die Relevanz der Erkenntnisse für den Schulunterricht betrachtet. Der Text enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die Hauptthemen sind: Definition und Abgrenzung von Textverstehen, Kohäsion und Kohärenz; der Prozess des Textverständnisses und seine kognitiven Grundlagen; Einflussfaktoren auf das Textverstehen; die Interaktion von Kohäsion und Kohärenz im Textverständnisprozess; und die Relevanz der Erkenntnisse für den Schulunterricht.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text gliedert sich in Einleitung, Grundlagen (Definitionen von Textverstehen, Kohäsion und Kohärenz), Textverstehen (Prozess, Einflussfaktoren, Rolle von Kohäsion und Kohärenz), Ausblick (Relevanz für die Schule) und Fazit. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Was sind Kohäsion und Kohärenz im Kontext des Textverständnisses?
Kohäsion beschreibt die sprachliche Verknüpfung von Sätzen und Textabschnitten (z.B. durch Pronomen, Konjunktionen). Kohärenz hingegen bezieht sich auf den inhaltlichen Zusammenhang und die logische Struktur des Textes – den „roten Faden“. Beide sind essentiell für erfolgreiches Textverstehen.
Welche Faktoren beeinflussen das Textverstehen?
Der Text benennt verschiedene Einflussfaktoren, die im Detail im Kapitel „Textverstehen“ erläutert werden. Es wird jedoch angedeutet, dass Vorwissen und der Aufbau einer kohärenten mentalen Repräsentation eine wichtige Rolle spielen.
Welche Bedeutung hat der Text für den Schulunterricht?
Der Text untersucht die Relevanz der Erkenntnisse zum Textverstehen für den Unterricht, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen, denen Schüler beim Textverstehen begegnen. Es wird angedeutet, dass ein besseres Verständnis des Prozesses und der Einflussfaktoren helfen kann, den Unterricht effektiver zu gestalten.
Welche Modelle des Textverständnisses werden erwähnt?
Der Text erwähnt das Modell von Kintsch und van Dijk als ein Beispiel für ein Modell des Textverständnisses. Weitere Modelle werden wahrscheinlich im Kapitel "Textverstehen" detailliert behandelt.
Wer ist die Zielgruppe des Textes?
Die Zielgruppe ist primär akademisch, vermutlich Studierende der Germanistik und Didaktik. Die Autorin selbst strebt eine Tätigkeit als Grundschullehrerin an, was die Relevanz für den Schulunterricht besonders hervorhebt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Textverstehen, Kohäsion, Kohärenz, Lesekompetenz, kognitive Prozesse, mentale Repräsentation, Vorwissen, Textkohärenz, Textanalyse, Grundschulunterricht.
- Quote paper
- Lea Gipmann (Author), 2020, Wie läuft das Textverstehen beim Menschen ab und welche Rolle spielen dabei Kohärenz und Kohäsion?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1149788