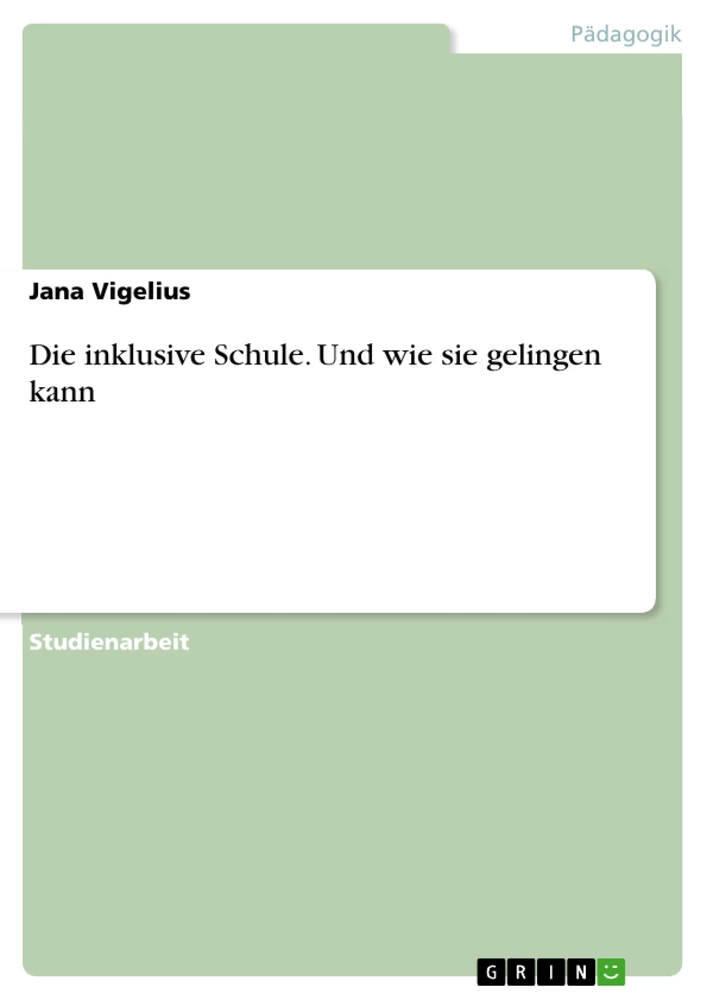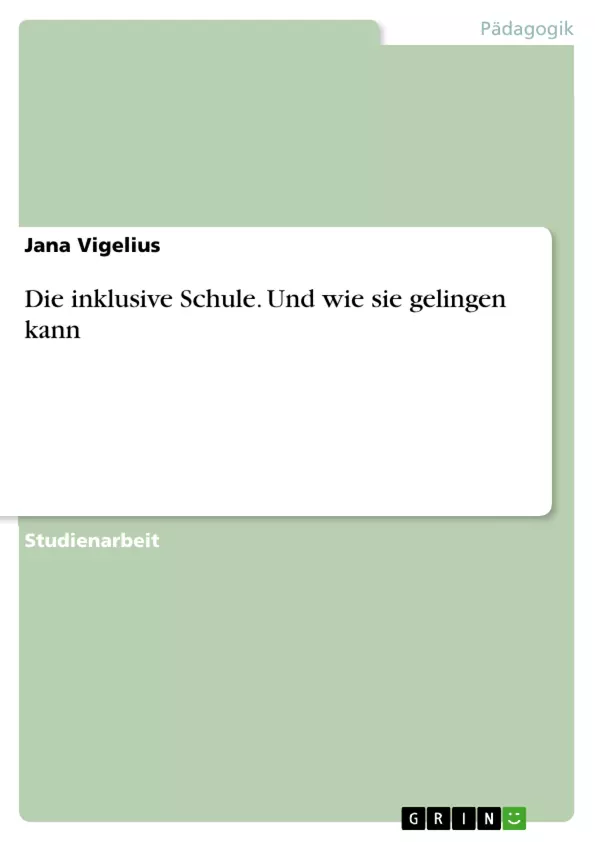In dieser Hausarbeit geht es um das Thema Inklusion in der schulischen Bildung und die Fragestellung, wie diese in unserem Schulsystem und unserer Gesellschaft gelingen kann. Um den Leser in das Thema einzuführen, werden im ersten Teil der Hausarbeit die Begriffe Inklusion, Exklusion, Integration und Heterogenität definiert beziehungsweise erklärt. Danach wird ein kurzer Rückblick in die Geschichte der Inklusion in Deutschland gegeben sowie die aktuelle Entwicklung thematisiert. Nachdem im Folgenden einige kritische Stimmen und Gedanken zum Thema Inklusion gehört werden, wird im nächsten Kapitel auf die Vorteile und Grenzen von Inklusion in Bezug auf Schule und die Gesamtgesellschaft eingegangen. Im Anschluss folgen dann einige Ausführungen bezüglich der Fragestellung wie Inklusion gelingen kann, bevor die Hausarbeit mit einem Resümee abgeschlossen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Begriffserklärung
- Inklusion
- Heterogenität
- Exklusion, Integration, Inklusion- Unterschiede
- Inklusion in der Schule
- Ein Rückblick
- Aktuelle Situation in Deutschland
- Kritische Stimmen
- Vorteile und Grenzen von Inklusion
- Vorteile für die Schule
- Vorteile für die Gesellschaft
- Grenzen von Inklusion
- Grenzen für Schule und Schüler
- Grenzen für die Gesellschaft
- Wie kann Inklusion gelingen?
- Resümee.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Inklusion in der schulischen Bildung und untersucht die Möglichkeiten, wie Inklusion im deutschen Schulsystem und in der Gesellschaft gelingen kann. Die Arbeit beleuchtet den Begriff der Inklusion und seine Abgrenzung zu den Begriffen Exklusion und Integration. Sie gibt einen Überblick über die historische Entwicklung der Inklusion in Deutschland und analysiert die aktuelle Situation. Des Weiteren werden kritische Stimmen zum Thema Inklusion beleuchtet, bevor die Vorteile und Grenzen der Inklusion für Schule und Gesellschaft diskutiert werden. Abschließend werden konkrete Ansätze zur Gestaltung einer inklusiven Schule vorgestellt.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Inklusion, Exklusion und Integration
- Historische Entwicklung und aktuelle Situation der Inklusion in Deutschland
- Kritische Stimmen zum Thema Inklusion
- Vorteile und Grenzen von Inklusion für Schule und Gesellschaft
- Konkrete Ansätze zur Gestaltung einer inklusiven Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Inklusion in der schulischen Bildung ein und stellt die Fragestellung der Hausarbeit dar. Im Anschluss erfolgt eine umfassende Begriffserklärung, die die Begriffe Inklusion, Exklusion, Integration und Heterogenität definiert und gegenüberstellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Inklusionsgedankens in der Schule. Es werden historische Aspekte beleuchtet und die aktuelle Situation in Deutschland analysiert.
Im vierten Kapitel werden die Vorteile und Grenzen von Inklusion für Schule und Gesellschaft diskutiert.
Im fünften Kapitel werden die Grenzen der Inklusion, sowohl für Schule und Schüler als auch für die Gesellschaft, aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit behandelt die zentralen Themen Inklusion, Exklusion, Integration, Heterogenität, schulische Bildung, deutsche Schulsystem, gesellschaftliche Teilhabe, Vielfalt, Diversität, Barrierefreiheit, Chancengleichheit, Menschenrechte und UN- Behindertenrechtskonvention.
- Quote paper
- Jana Vigelius (Author), 2020, Die inklusive Schule. Und wie sie gelingen kann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1149912