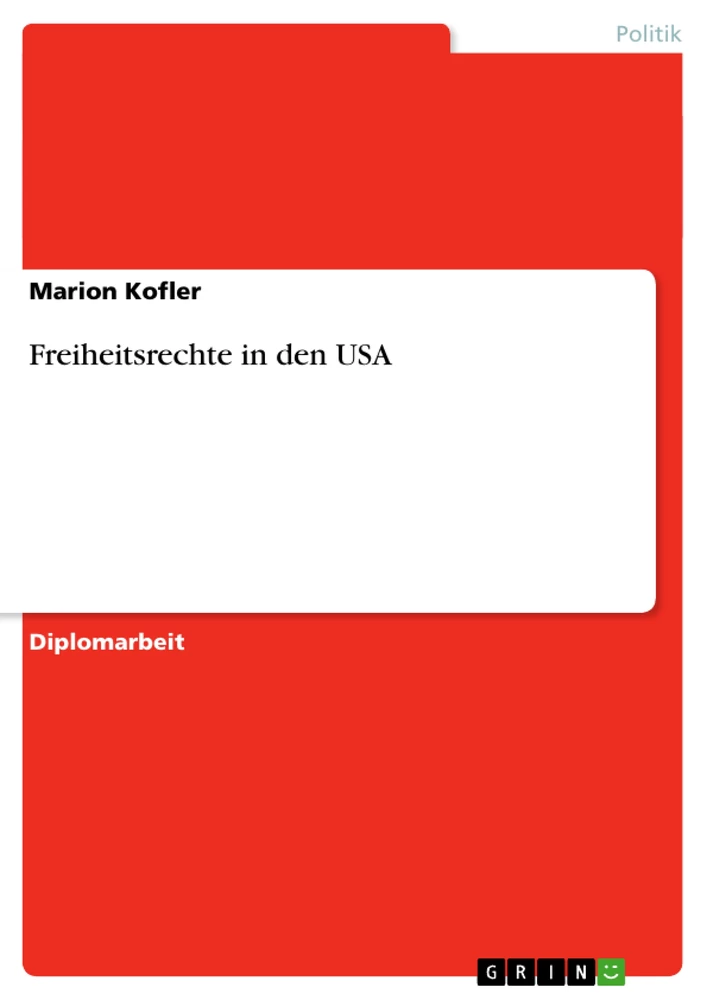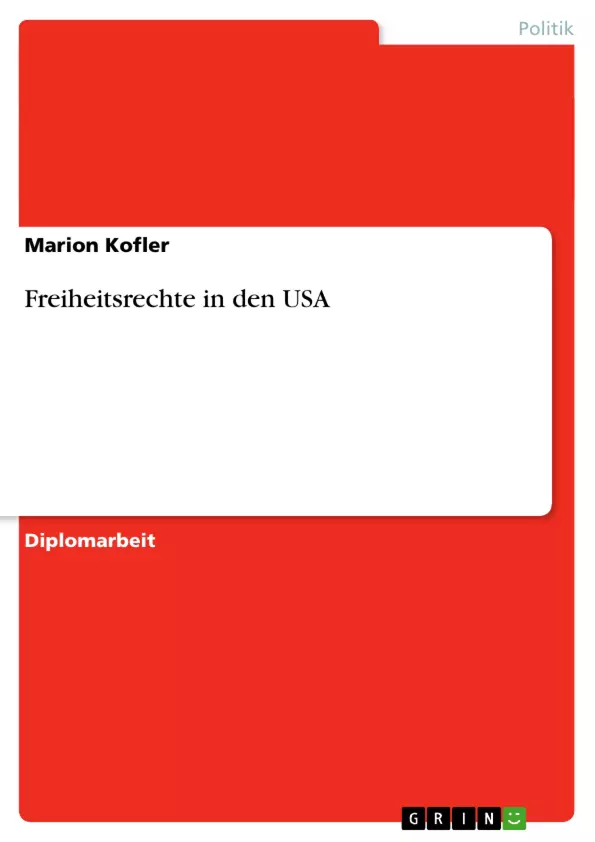„They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety“
(Benjamin Franklin)
Diesem Zitat von Benjamin Franklin begegnete ich anlässlich einer Recherche für eine Seminararbeit bereits vor einigen Jahren, und obwohl ich es für die damalige Arbeit nicht verwendete, hat es großen Eindruck auf mich gemacht. Wie weit können, müssen, sollen wir gehen können, um unsere Sicherheit zu ‚garantieren’. Bereits vor der Arbeit an meiner Diplomarbeit wurde mir im Laufe meines Studiums bewusst, dass sich Sicherheit nicht nur auf die persönliche, physische Sicherheit vor Waffengewalt erstreckt, sondern weit darüber hinausgeht. Wie weit sie reichen kann, wurde mir im Rahmen eines Hilfseinsatzes im der Region um die Bezirkshauptstand Galle in Sri Lanka nach dem Tsunami 2004 bewusst, als das Land durch die großen Zerstörungen der Umwelt und Infrastruktur, sowie dem Verlust tausender Menschenleben, auch im politischen und sozietalen Bereich massive Probleme ungeahnten Ausmaßes bewältigen musste: Nicht nur das nach wie vor strenge, von Indien übernommene Kastengesetz machte bei der Neuerrichtung von Dörfern und der Notversorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln große Probleme, sondern auch die durch die Regierung eingeschränkte Hilfe für die schwer getroffene Tamilen-Region Aceh setzten dem sozietalen Sektor zu, ebenso wie die Korruption und gegenseitige Schuldzuweisungen der Akteure innerhalb des politischen Sektors, um nur drei Aspekte zu nennen. Die Bedrohung des primären Sicherheitsaspektes des ökologischen Sektors, die intakte Umwelt, brachte also in direkter Beziehung auch massive Bedrohungen für den sozietalen und politischen Sektors mit sich. Eine Naturkatastrophe größeren Ausmaßes war also hier in der Lage, ein Land, sogar eine ganze Region in die Gefahr der Destabilisation auf mehreren Ebenen zu bringen. Diese persönlichen Erlebnisse in Sri Lanka ließen mich über Sicherheit und Stabilität eines Landes näher nachdenken und da mich die Bereiche „Internationale Politik“ und „Internationale Beziehungen“ fast seit Beginn meines Studiums bereits vorrangig interessiert hatten, begann ich mich hinsichtlich meines Themas für die Diplomarbeit in diese Richtung zu interessieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Theoretische Grundlagen
- Begriffsklärung
- Der Begriff der Sicherheit
- Der Begriff der Freiheit
- Historische Aspekte
- Sedition Act 1798
- Writ of Habeas Corpus - Silent Leges inter Arma 1861
- Espionage Act 1917
- Palmer Raids 1919
- Smith Act 1940
- Japanese Relocation Act 1942
- McCarthy Ära 1950-1954
- Counterintelligence Program COINTELPRO 1956-1971
- Exkurs: Levi-Guidelines
- Sektion 411 Definitions Relating to Terrorism
- Inhalt von Sektion 411 Patriot Act
- Historischer Rückbezug
- Sedition Act
- Espionage Act
- Smith Act/"Alien and Registration Act"
- Kritik an Sektion 411
- 'Racial Profiling'
- Vage Wortwahl und Guild by Association
- Aspekte von Sektion 411 im Gesetzesvollzug
- Barry Buzans ‘New Framework und Sektion 411
- Sektion 802 Patriot Act
- Inhalt von Sektion 802 Patriot Act
- Historischer Rückbezug
- Suspendierung des ‘Writ of Habeas Corpus'
- Japanese Relocation Act
- 'Red Scare' – Palmer Raids und McCarthy Ära
- Counterintelligence Program COINTELPRO
- Kritik an Sektion 802
- ‘Racial Profiling' und die Suspendierung des ‘Writ of Habeas Corpus'
- Vage Wortwahl
- Barry Buzans 'New Framework' und Sektion 802
- Freiheit versus Sicherheit
- Graphische Darstellung: Freiheit versus Sicherheit
- Sektorale Darstellung: Freiheit vs. Sicherheit
- Die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit
- Sedition Act 1798
- Suspendierung des Writ of Habeas Corpus 1861
- Espionage Act 1917
- Palmer Raids 1919
- Smith Act 1940
- Japanese Relocation Act 1942
- MaCarthy Ära 1950-1954
- Counterintelligence Progam COINTELPRO 1965-1971
- Leve-Guidelines 1976 bis heute und USA Patriot Act 2001
- Schlußbetrachtungen
- Anhang
- Abstract
- Quellenangaben
- Monographien
- Perdiodika
- Zeitungen
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, wie sich die Freiheitsrechte in den USA im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit entwickelt haben. Sie analysiert historische Ereignisse und Gesetzesentwürfe, die die Balance zwischen diesen beiden Werten verschoben haben, und untersucht, wie sich diese Entwicklung auf die amerikanische Gesellschaft ausgewirkt hat.
- Die historische Entwicklung der Freiheitsrechte in den USA
- Die Auswirkungen von Terrorismus auf die Freiheitsrechte
- Die Rolle des USA Patriot Act in der Balance zwischen Sicherheit und Freiheit
- Die Kritik an den Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung und deren Auswirkungen auf die Freiheitsrechte
- Die Bedeutung der historischen Perspektive für die aktuelle Debatte um Sicherheit und Freiheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die den Ausgangspunkt der Untersuchung, die Terroranschläge vom 11. September 2001, und die damit verbundenen Fragen nach der Balance zwischen Sicherheit und Freiheit beleuchtet. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit erläutert, wobei die Begriffe Sicherheit und Freiheit definiert und in ihren historischen Kontext eingebettet werden.
Im nächsten Kapitel werden historische Aspekte der Freiheitsrechte in den USA beleuchtet, wobei verschiedene Gesetzesentwürfe und Ereignisse, die die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit verschoben haben, analysiert werden. Dazu gehören der Sedition Act von 1798, die Suspendierung des Writ of Habeas Corpus im Bürgerkrieg, der Espionage Act von 1917, die Palmer Raids von 1919, der Smith Act von 1940, der Japanese Relocation Act von 1942, die McCarthy Ära von 1950-1954 und das Counterintelligence Program COINTELPRO von 1956-1971.
Die Kapitel 5 und 6 befassen sich mit dem USA Patriot Act, der nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verabschiedet wurde. Die Arbeit analysiert die Inhalte der Sektionen 411 und 802 des Patriot Act und setzt diese in einen historischen Kontext. Dabei werden die Kritikpunkte an den Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung, wie z.B. 'Racial Profiling' und vage Wortwahl, sowie die Auswirkungen auf die Freiheitsrechte beleuchtet.
Im Kapitel 7 wird die Frage nach der Balance zwischen Freiheit und Sicherheit im Kontext der Terrorismusbekämpfung diskutiert. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Argumente und Positionen in dieser Debatte und zeigt die Komplexität des Themas auf.
Das Kapitel 8 stellt die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit in einer graphischen Darstellung dar. Dabei werden die verschiedenen historischen Ereignisse und Gesetzesentwürfe in einem Diagramm visualisiert, um die Entwicklung der Balance zwischen Sicherheit und Freiheit zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Freiheitsrechte, Sicherheit, Terrorismus, USA Patriot Act, 'Racial Profiling', Vage Wortwahl, Historische Entwicklung, Balance, USA, Gesetzesentwürfe, Kritik, Auswirkungen, Debatte.
- Citar trabajo
- Mag.Phil. Marion Kofler (Autor), 2006, Freiheitsrechte in den USA, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114992