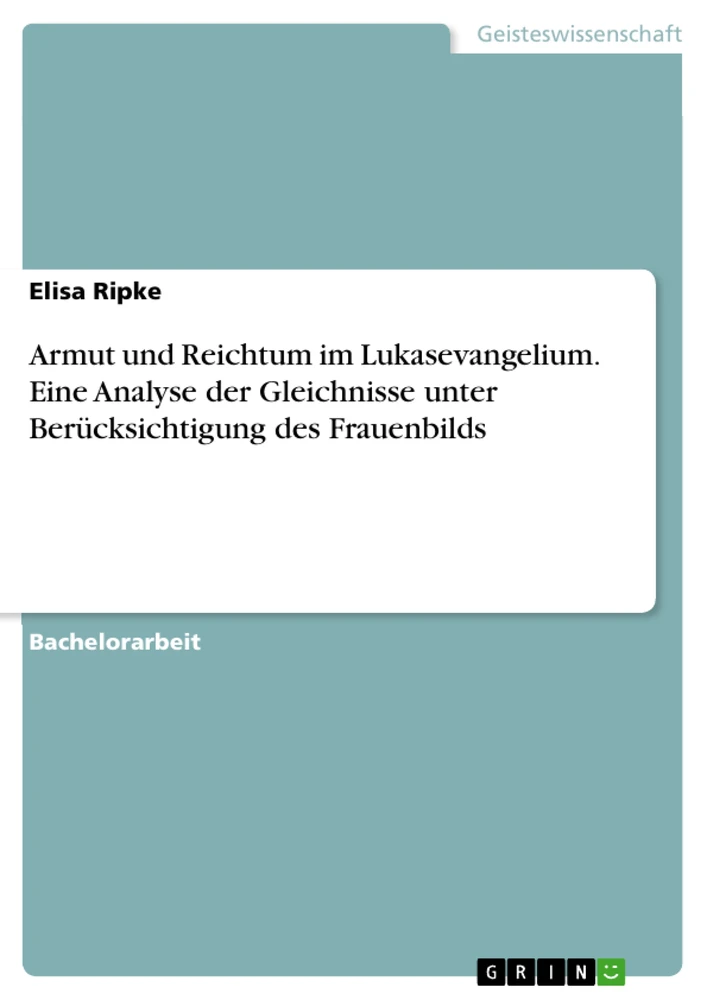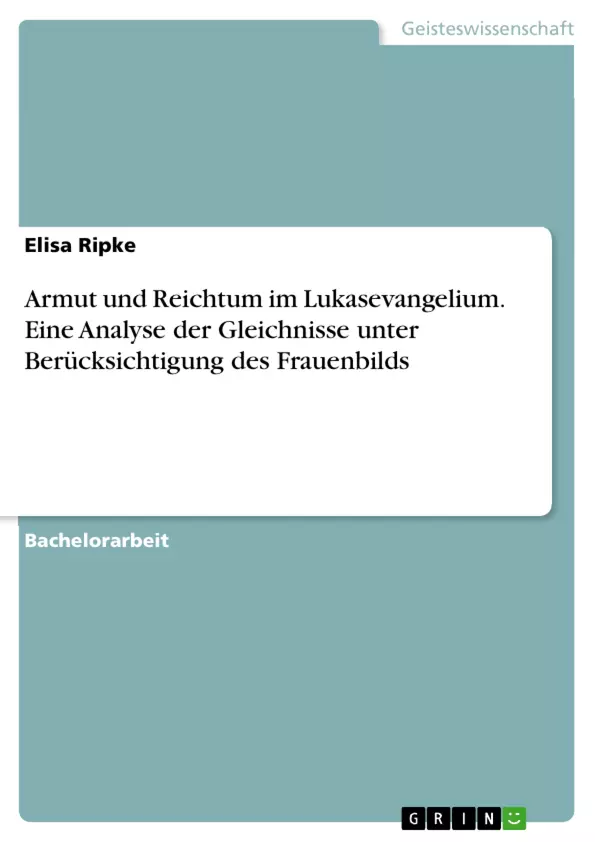Verkündet Lukas den Armen das Heil und straft die Reichen ab? Wie stellt Lukas Armut und Reichtum dar, warum macht er das so viel ausführlicher als die anderen Evangelisten und wen will er damit erreichen? Die folgende Arbeit soll eben dies prüfen. Nicht nur heute klafft eine gewaltige Lücke zwischen den reichen und den armen Menschen in der Gesellschaft. Auch in der Antike war die Differenz der wenigen Reichen und Mächtigen gegenüber der Masse an Mittellosen gewaltig. Zu den Obersten konnten sich nur wenige Prozent der Bevölkerung zählen, ähnlich wie heute. Jedoch gab es keine sogenannte Mittelschicht. In unserer heutigen Gesellschaft zählt eine breite Mittelschicht als Grundlage der Demokratie, der Friedlichkeit.
Doch diese Schicht schrumpft, die Schere öffnet sich. Die Angst vor sozialem Abstieg ist besonders bei der unteren Mittelschicht groß, da das System zurück nach oben kaum durchlässig ist. Durch die Angst vor dem Herunterrutschen in die Unterschicht wird eben diese isoliert. Kontakt zwischen den Schichten wird gemieden, ebenso die Wohngegenden und die schulischen Institutionen, zu deren Klientel Personen aus der Unterschicht gehören. Dies wiederum erschwert der unteren Schicht eine soziale Verbesserung. Was durch die Angst vor dem eigenen Abstieg und dem Leistungsdruck gemindert wird, ist die Solidarität denen gegenüber, die nicht weiter absteigen können. Die Unsicherheit der Mittelschicht vermehrt den Egoismus, getrieben von dem Kapitalismus. All dies führt dazu, dass der humanistische und der diesem vorhergehende christlichen Gedanke zur Fürsorge der Schwächeren abnimmt.
Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Dies funktioniert in der Praxis leider meist nicht so gut. In der Antike jedoch gab es weder eine sichere Mittelschicht, noch einen Sozialstaat, welcher für die mindeste Versorgung aufkam oder jegliche diakonischen oder caritative Gedanken, die institutionell in Formen von Tafeln etc. für die absolut Armen sorgte. Das frühe Christentum, hier besonders der Evangelist Lukas, widmet der Thematik Armut und Reichtum, neben den Themen Frauen und Mahl, ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit. Der Evangelist der Armen, ein Titel den man ihm dafür oft gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Exposé
- Das Lukasevangelium
- Entstehungsgeschichte
- Verfasser
- Zeit
- Ort
- Religiöser Hintergrund
- Quellen
- Sozialgeschichtliche Themen des LKs
- Historisches Umfeld
- Soziale Situation in den römisch-hellenistischen Städten
- Antike Ökonomie
- Die Frau in der städtischen Gemeinde
- Entstehungsgeschichte
- Gleichnisse
- Sprache der Gleichnisse
- Funktion der Gleichnisse
- Besitz & Armut
- Reiche und Arme - Darstellung im Lukasevangelium
- Arme
- Reiche
- Das Anhäufen von Besitz LK, 12, 13-21
- Form, Einordnung und Inhalt
- Der Reiche
- Funktion/Deutung
- Fazit
- Der Nutzen des Geldes LK 16, 1-13
- Form, Einordnung Inhalt
- (Sozial-)Geschichtlicher Hintergrund
- Deutung / Funktion
- Fazit
- Reiche in der Basileia? Lk. 18, 18-30
- Form, Einordnung, Inhalt
- Darstellung des reichen Mannes und Petrus
- Deutung/Funktion
- Fazit
- Reiche und Arme - Darstellung im Lukasevangelium
- Frauen
- Frauen in der Antike
- Das Vermögen dreier Frauen Lk. 8, 1-3
- Der Wert des Geldes Lk 15, 8-10
- Form, Einordnung, Inhalt
- Arme Frau
- Deutung/ Funktion
- Fazit
- Fazit
- Der Evangelist der Armen? Evangelist der Reichen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Reichtum und Armut im Lukasevangelium und untersucht, wie Lukas diese Themen behandelt und welche Botschaft er damit vermitteln möchte.
- Die Darstellung von Armut und Reichtum im Lukasevangelium im Vergleich zu anderen Evangelien
- Die soziale Situation der Armen und Reichen in der antiken Welt
- Die Funktion und Bedeutung von Gleichnissen im Lukasevangelium im Kontext von Armut und Reichtum
- Die Rolle von Frauen im Lukasevangelium im Kontext von Armut und Reichtum
- Die Frage, ob Lukas als „Evangelist der Armen“ oder „Evangelist der Reichen“ bezeichnet werden kann
Zusammenfassung der Kapitel
Das Exposé stellt die Problemstellung der Arbeit vor und führt in das Thema ein. Es wird deutlich, dass der Evangelist Lukas die Thematik Armut und Reichtum im Vergleich zu anderen Evangelisten besonders ausführlich behandelt.
Kapitel 1 beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Lukasevangeliums. Es werden die möglichen Verfasser, die Entstehungszeit, den Entstehungsort und den religiösen Hintergrund sowie die verwendeten Quellen untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage nach dem Autor und der Entstehung des Lukasevangeliums.
Kapitel 2 stellt die Funktion und Bedeutung von Gleichnissen im Lukasevangelium dar. Hierbei wird die besondere Sprache der Gleichnisse und deren Funktion im Kontext der Verkündigung Jesu analysiert.
Kapitel 3 befasst sich mit der Darstellung von Armut und Reichtum im Lukasevangelium. Es werden die verschiedenen Perspektiven auf die Armen und Reichen vorgestellt, sowie die zentralen Textstellen zu diesem Thema analysiert.
Kapitel 4 konzentriert sich auf die Rolle von Frauen im Lukasevangelium im Kontext von Armut und Reichtum. Hier werden ausgewählte Textstellen analysiert, um die Rolle und Bedeutung von Frauen in der Verkündigung Jesu zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Lukasevangelium, Armut, Reichtum, Gleichnisse, soziale Situation, antike Welt, Frauen, Theologie, Interpretation, Evangelium der Armen, Evangelium der Reichen.
Häufig gestellte Fragen
Warum widmet das Lukasevangelium dem Thema Armut und Reichtum so viel Aufmerksamkeit?
Lukas gilt als der „Evangelist der Armen“. Er thematisiert die soziale Kluft der Antike besonders stark, um die christliche Fürsorgepflicht und die Gefahren des Besitzes hervorzuheben.
Welche Rolle spielen Gleichnisse bei der Darstellung von Besitz?
Gleichnisse wie „Der reiche Kornbauer“ (Lk 12) oder „Der ungerechte Verwalter“ (Lk 16) dienen dazu, die moralischen Implikationen von Reichtum und den richtigen Umgang mit Geld zu verdeutlichen.
Wie wird das Frauenbild im Lukasevangelium mit der Besitzthematik verknüpft?
Die Arbeit untersucht unter anderem das Vermögen von Frauen (Lk 8, 1-3) und die Erzählung von der armen Witwe, um die soziale Stellung der Frau in der antiken Gemeinde und ihre Rolle im Christentum zu beleuchten.
Gab es in der Antike eine soziale Mittelschicht?
Nein, im Gegensatz zu heute gab es in der antiken Ökonomie kaum eine Mittelschicht. Es existierte eine gewaltige Lücke zwischen den wenigen Reichen und der Masse an Mittellosen.
Was ist das Fazit zur Bezeichnung „Evangelist der Armen“?
Die Arbeit prüft kritisch, ob Lukas einseitig die Armen bevorzugt oder ob seine Botschaft auch eine Mahnung und Handlungsanweisung an die Reichen der damaligen Gemeinden darstellt.
- Arbeit zitieren
- Elisa Ripke (Autor:in), 2019, Armut und Reichtum im Lukasevangelium. Eine Analyse der Gleichnisse unter Berücksichtigung des Frauenbilds, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1150043