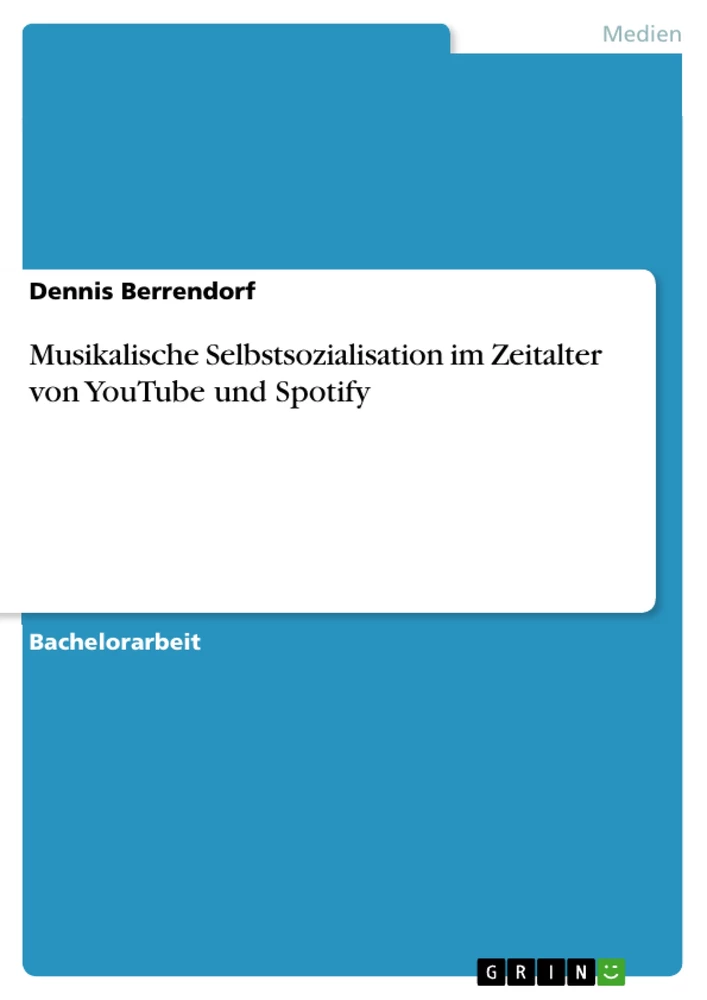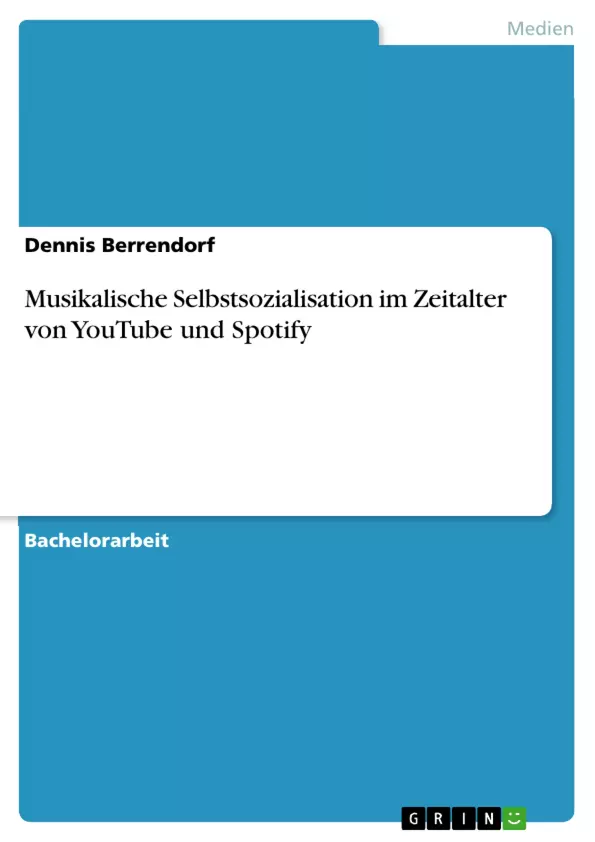Nahezu selbstverständlich sind Ende des 20. Jahrhunderts elektronische Medien wie das Internet, PCs und Handys zu unseren ständigen Begleitern geworden, wodurch der Wandel zu einer Informations- und Kommunikationsgesellschaft immer weiter vorangetrieben wurde. Verschiedenste Bereiche sind heute von diesen Kommunikationsträgern geprägt, welche sowohl unsere Freizeit als auch unser Denken und Handeln beeinflussen. Davon ist ebenso die Lebenswelt der Jugend mehr und mehr betroffen, was eine zunehmende Bedeutung der Medien für das Aufwachsen in unserer Gesellschaft nach sich zieht. Hier wird deutlich, dass es sich um einen komplexen Forschungsgegenstand handelt, der einen interdisziplinären Zugang erfordert. Vor diesem Hintergrund widmet sich die Bachelorarbeit dem Themenbereich der Jugend im Prozess der Sozialisation und der damit zusammenhängenden Bedeutung der Mediennutzung.
Es lässt sich eine Vielzahl von zunehmend differenzierten Alltagswelten der Jugendlichen vorfinden, die sich durch die Bevorzugung bestimmter Stilelemente ausdrücken. Bei der Hervorhebung ihrer Zugehörigkeit und gleichzeitiger Abgrenzung zu anderen Bereichen kommt nahezu keine der einzelnen Gruppierungen ohne mediale Ausdrucksmittel aus. Ihre Nutzung eröffnet auf dieser Weise den Zugang zu der Vielfalt an Jugendkulturen und bringt eine steigende Zahl von Selbstdarstellungsmöglichkeiten und verschiedensten Lebenswelten mit sich. Hieran anknüpfend lautet die Hypothese der Arbeit, dass sich das „produktiv-realitätsverarbeitende Subjekt“ (Hurrelmann) selbst sozialisiert, und durch den Mediengebrauch seine Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen ausdrückt. Ob Webportale wie Youtube und Spotify dabei das Potential zur Selbstsozialisation haben, wird im fünften Kapitel anhand zweier Hypothesen sowie in einem abschließenden, zusammenfassenden Resümee erörtert.
Das erste Ziel der Arbeit besteht allerdings zunächst darin, mittels einer gebündelten Darstellung der Theorie des symbolischen Interaktionismus nach George Herbert Mead eine sozialtheoretische Grundlage zur Identitätsentwicklung herauszuarbeiten. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass sich Identität durch Erfahrungs- und Entwicklungsprozesse innerhalb sozialer Instanzen ausbilden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- 2. Die Entwicklung der Identität nach George H. Mead
- 2.1. Vorüberlegungen
- 2.2. ,,I\", „Me“ und „Self“
- 3. Die Theorie musikalischer Selbstsozialisation
- 3.1. Theoriegeschichtliche Herleitung des Begriffs der Selbstsozialisation
- 3.2. Eine kritische Diskussion des Selbstsozialisationskonzeptes nach Jürgen Zinnecker
- 3.2.1. Zwischenfazit
- 3.3. Das Selbstsozialisationskonzept nach Renate Müller
- 3.4. Kritik am Konzept musikalischer Selbstsozialisation von Renate Müller
- 3.4.1. Zwischenfazit
- 4. Die digitale Mediamorphose
- 5. Musikalische Selbstsozialisation im Zeitalter von Youtube und Spotify?
- 5.1. Vorüberlegungen
- 5.2. Mediennutzung und Mediensozialisation
- 5.2.1. Hypothese I: Musikalische „Allesfresserei“ in Zusammenhang mit einem breiten Musikgeschmack?
- 5.2.2. Hypothese II: „Tags\" als Agenda-Setting-Effekt?
- 5.3. Zwischenfazit
- 6. Resümee: Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung von Musik im Prozess der Selbstsozialisation von Jugendlichen im Zeitalter von digitalen Medien wie Youtube und Spotify. Die Arbeit analysiert, wie sich der Einfluss des Internets und die Verfügbarkeit digitaler Musikangebote auf die Identitätsentwicklung und den Musikgeschmack von Jugendlichen auswirken.
- Entwicklung der Identität nach George H. Mead
- Theorie der musikalischen Selbstsozialisation
- Einfluss von digitalen Medien auf die Selbstsozialisation
- Mediennutzung und Musikpräferenzen
- Kritik am Konzept der musikalischen Selbstsozialisation
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Arbeit ein und stellt den Forschungsgegenstand sowie die Zielsetzung dar. Kapitel 2 beleuchtet die Theorie des symbolischen Interaktionismus nach George H. Mead als Grundlage für die Analyse der Identitätsentwicklung. Kapitel 3 diskutiert die Theorie der musikalischen Selbstsozialisation und beleuchtet die Konzepte von Jürgen Zinnecker und Renate Müller. Kapitel 4 erörtert die Entwicklungen in der digitalen Medienlandschaft und den Begriff der digitalen Mediamorphose. Kapitel 5 untersucht den Einfluss von Youtube und Spotify auf die Selbstsozialisation von Jugendlichen und diskutiert die Bedeutung von "Allesfresserei" und Agenda-Setting-Effekten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Selbstsozialisation, musikalische Identität, Mediennutzung, Musikgeschmack, Youtube, Spotify, digitale Mediamorphose, Identitätsentwicklung und Mediensozialisation.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet musikalische Selbstsozialisation?
Es beschreibt den Prozess, bei dem Jugendliche durch den eigenständigen Umgang mit Musik und Medien ihre Identität entwickeln und ihre Gruppenzugehörigkeit ausdrücken.
Welchen Einfluss haben YouTube und Spotify auf Jugendliche?
Diese Portale bieten Selbstdarstellungsmöglichkeiten und einen nahezu unbegrenzten Zugang zu Musikstilen, was die Identitätsbildung stark beeinflusst.
Was versteht man unter „musikalischer Allesfresserei“?
Die Hypothese besagt, dass moderne Mediennutzung zu einem sehr breiten Musikgeschmack führt, anstatt sich nur auf ein Genre zu beschränken.
Wer ist George Herbert Mead und welche Rolle spielt er in der Arbeit?
Meads Theorie des symbolischen Interaktionismus (I, Me, Self) dient als sozialtheoretische Grundlage für das Verständnis der Identitätsentwicklung.
Was ist der Agenda-Setting-Effekt bei Musik-Tags?
Die Arbeit untersucht, ob Schlagworte (Tags) und Algorithmen auf Plattformen vorgeben, welche Musik als relevant wahrgenommen wird.
- Citation du texte
- Dennis Berrendorf (Auteur), 2014, Musikalische Selbstsozialisation im Zeitalter von YouTube und Spotify, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1150090