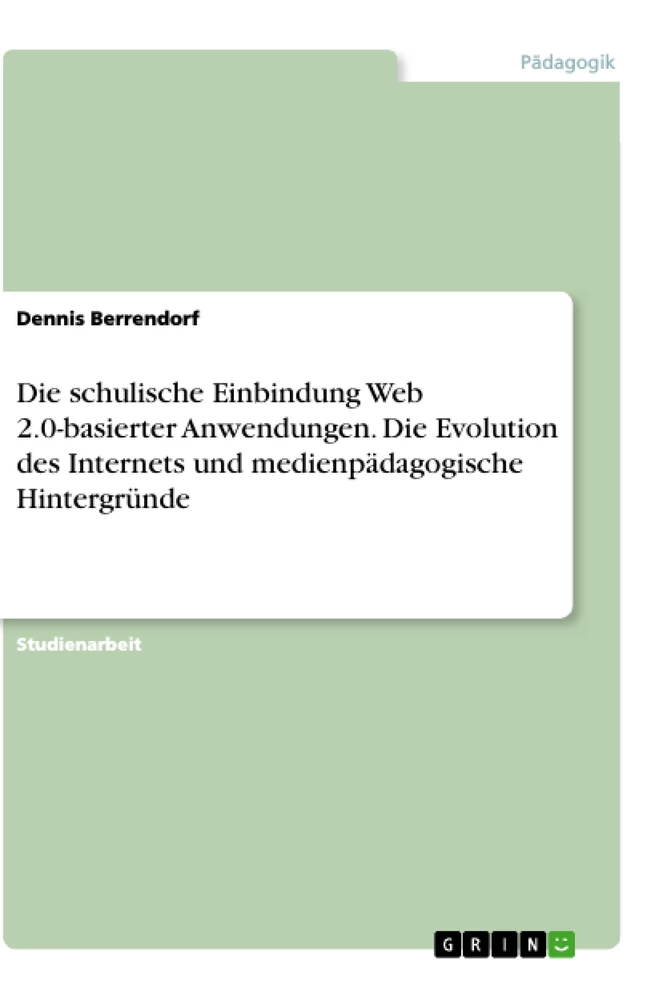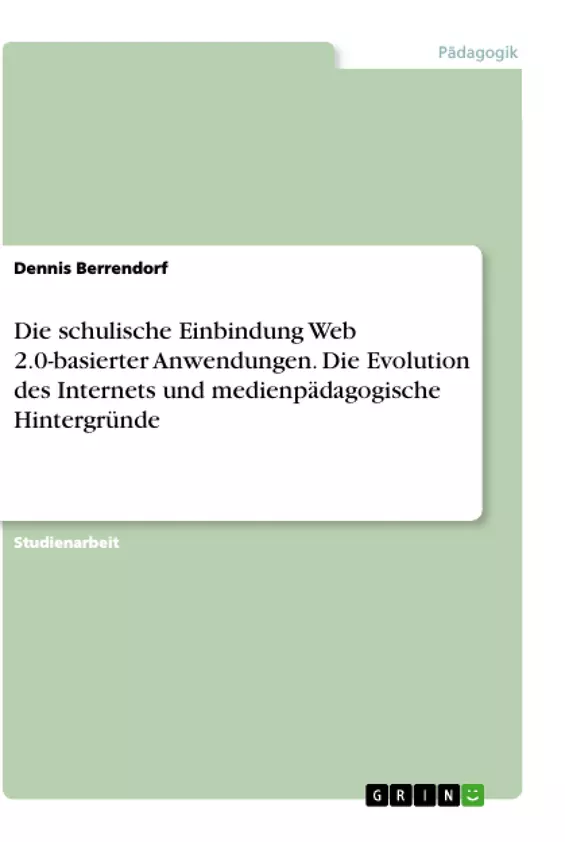Wie der Titel bereits erkennen lässt, widmet sich die Arbeit der Behandlung der Fragestellung, wie Web 2.0-basierte Anwendungen Platz in Schule und Unterricht finden können. Dabei werden folgende Schwerpunkte gesetzt: Das erste Kapitel ist ein technikgeschichtlicher Abriss, in welchem die „drei großen Phasen“ nachgezeichnet werden, in denen sich das Internet vom ARPANET, über das Web 1.0 (World Wide Web) bis hin zum Web 2.0 gewandelt hat. Korrespondierend hierzu werden wesentliche Charakteristika des Wandels vom Web 1.0 hin zum Web 2.0 vorgestellt, wobei insbesondere sowohl der höhere Partizipationsgrad von Web 2.0-Anwendungen als auch der damit verbundene Wandel der Sender- und Empfängerstruktur (vom one-to-many zum many-to-many) fokussiert werden. Daraufhin werden zwei kurze Beispiele aktueller Web 2.0-Anwendungen angerissen, die jedoch nur einen kleinen Ausschnitt aus dem großen Ganzen liefern können.
Teil zwei dieser Hausarbeit widmet sich ganz der medienpädagogischen Perspektive, wenn es darum geht, die Frage zu diskutieren, warum und wie Web 2.0-Anwendungen in den Unterricht integriert werden sollen bzw. können. Hierbei werden die Dimensionen der Veränderungen vom Web 1.0 zum Web 2.0 erläutert, woraufhin ein aktualisierter Begriff von Medienkompetenz ausgelotet wird, und anschließend einige Anforderungen für gelingende Lernprozesse auf Basis solcher Anwendungen beschrieben werden. Dabei steht insbesondere der Begriff der Selbstorganisation im Mittelpunkt, der in Kap 3.3 kurz erklärt sowie mit Leitideen für die Erziehung und Bildung in einer von Medien mitgestalteten Welt verbunden wird.
Der dritte Teil beschäftigt sich mit Möglichkeiten und Beispielen für die Integration von Web 2.0-Anwendungen in den Unterricht. Dabei wird von einer Festlegung auf eine bestimmte Unterrichtsreihe, auf eine bestimmte Jahrgangsstufe oder gar Schulform abgesehen, da das Ermitteln eines angemessenen Komplexitätsgrades, die Verständigung über Ziele und Vorgehensweisen sowie die Planung einer Unterrichtsreihe insgesamt in hohem Maß von der Lerngruppe abhängig ist. Die in diesem Teil aufgezeigten Möglichkeiten stellen nur einige Web 2.0-basierte Anwendungen vor, mit denen beispielsweise in (Klein)gruppen gearbeitet werden kann. Neben zwei Zwischenfaziten, welche die wesentlichen Aussagen der Kapitel zwei und drei zusammenfassen, erfolgt im letzten Teil ein Überblick über die gesamte Arbeit sowie ein Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- 2. Die Entwicklungsgeschichte des Internets
- 2.1. Vorläufer des Internets: Über die Entwicklung des ARPANET
- 2.2. Tim Berners-Lee und das World Wide Web
- 2.3. Einbahnstraße Web 1.0 oder: one-to-many
- 2.4. Evolution Web 2.0 oder: many-to-many
- 2.5. Beispiele aktueller Web 2.0-Anwendungen
- 2.5.1. Wikipedia
- 2.5.2. Facebook
- 2.6. Zwischenfazit
- 3. Medienpädagogische Hintergründe
- 3.1. Medienkompetenz 1.0
- 3.2. Medienkompetenz 2.0
- 3.3. Voraussetzungen zur didaktischen Planung eines Web 2.0-basierten Lernportals
- 3.4. Zwischenfazit
- 4. Web 2.0 in der schulischen Praxis
- 4.1. Eine Projektarbeit als Ausgangslage
- 4.2. Beispiele für Web 2.0-Anwendungen
- 4.2.1. Erstellen eines Wikis
- 4.2.2. Lernplattformen
- 5. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Integration von Web 2.0-Anwendungen in den schulischen Kontext. Das Ziel ist es, konkrete Ideen für die Anwendbarkeit von Web 2.0-basierten Anwendungen im Unterricht zu entwickeln und die dafür notwendigen medienpädagogischen Grundlagen zu beleuchten.
- Die Entwicklung des Internets von den Vorläufern über das Web 1.0 bis hin zum Web 2.0
- Die Charakteristika des Wandels vom Web 1.0 zum Web 2.0, insbesondere der höhere Partizipationsgrad und die veränderte Sender-Empfänger-Struktur (von one-to-many zu many-to-many)
- Medienkompetenz im Kontext von Web 2.0 und die Anforderungen für gelingende Lernprozesse auf Basis von Web 2.0-Anwendungen
- Möglichkeiten und Beispiele für die Integration von Web 2.0-Anwendungen in den Unterricht
- Zusammenfassende Analyse der Ergebnisse und Ausblick auf weitere Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Gegenstand der Arbeit und legt die Zielsetzung fest. Es werden die Herausforderungen der Integration von Web 2.0-Anwendungen in den schulischen Alltag beleuchtet und die Relevanz dieser Thematik hervorgehoben.
Kapitel zwei beleuchtet die Entwicklungsgeschichte des Internets, von den Vorläufern über das Web 1.0 bis hin zum Web 2.0. Es werden wichtige Meilensteine der technischen Entwicklung sowie die Veränderungen in der Struktur der Kommunikation hervorgehoben.
Kapitel drei beleuchtet die medienpädagogischen Hintergründe der Web 2.0-Anwendungen. Es werden die Dimensionen der Veränderungen vom Web 1.0 zum Web 2.0 erläutert und der Begriff der Medienkompetenz im Kontext des Web 2.0 diskutiert. Die Voraussetzungen für gelingende Lernprozesse auf Basis von Web 2.0-Anwendungen werden analysiert und der Begriff der Selbstorganisation im Zusammenhang mit der Bildung in einer mediengesteuerten Welt erläutert.
Kapitel vier beschäftigt sich mit der Integration von Web 2.0-Anwendungen in den Unterricht. Es werden verschiedene Beispiele und Möglichkeiten aufgezeigt, wie Web 2.0-basierte Anwendungen in (Klein)gruppenarbeit eingesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Web 2.0, Internet, Medienpädagogik, Medienkompetenz, Partizipation, one-to-many, many-to-many, Lernplattform, Wiki, Digitalisierung, Unterricht, Schulische Praxis, Selbstorganisation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Web 1.0 und Web 2.0?
Web 1.0 war eine „Einbahnstraße“ (one-to-many), während Web 2.0 durch Partizipation und eine many-to-many-Struktur geprägt ist, in der Nutzer selbst zu Sendern werden.
Wie kann Web 2.0 im Unterricht eingesetzt werden?
Beispiele sind das Erstellen von schuleigenen Wikis, die Nutzung von Lernplattformen oder die Arbeit in digitalen Kleingruppen zur Förderung der Selbstorganisation.
Was bedeutet Medienkompetenz 2.0?
Es ist ein aktualisierter Begriff von Medienkompetenz, der über das reine Konsumieren hinausgeht und die aktive Gestaltung, Partizipation und Reflexion in sozialen Netzwerken umfasst.
Welche Rolle spielt Wikipedia in der schulischen Bildung?
Wikipedia wird als Beispiel für eine Web 2.0-Anwendung genannt, die zeigt, wie kollaboratives Wissen entsteht und wie Schüler kritisch mit solchen Quellen umgehen müssen.
Warum ist Selbstorganisation für das Lernen mit Web 2.0 wichtig?
Web 2.0-Anwendungen erfordern von Schülern ein hohes Maß an Eigenverantwortung und die Fähigkeit, Lernprozesse selbstständig zu strukturieren.
- Quote paper
- Dennis Berrendorf (Author), 2016, Die schulische Einbindung Web 2.0-basierter Anwendungen. Die Evolution des Internets und medienpädagogische Hintergründe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1150095