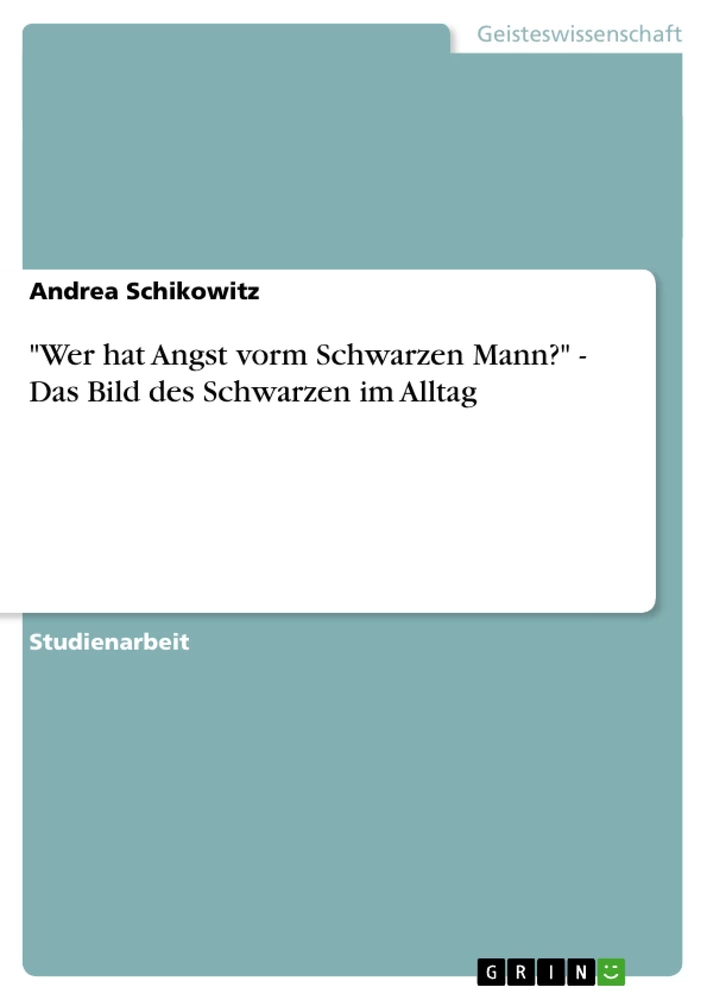Über Migranten, besonders über solche dunkler Hautfarbe, bestehen eine Menge Vorurteile, und das, obwohl Schwarze im deutschsprachigen Raum erst seit sehr kurzer Zeit zum Straßenbild gehören. Das bedeutet, dass lange Zeit jeder von uns Bilder von Schwarzen im Kopf hatte, ohne jemals selbst einen dunkelhäutigen Menschen persönlich gekannt zu haben.1 Die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit lauten daher: Wenn nicht aus der eigenen Erfahrung, woher kommen dann diese Bilder? Und haben sie sich im Laufe der Zeit verändert? Stereotype über fremde Menschen und fremde Länder werden tagtäglich vermittelt und weiterverbreitet. Sie begegnen uns auf Firmenschildern, in Kinderbüchern und in Schlagertexten. Eine eingehendere Untersuchung dieses Phänomens ist daher meiner Meinung nach sehr wichtig, um das Bewusstsein dafür zu stärken. Denn nur wenn wir Stereotype bewusst wahrnehmen, sind wir ihrer Wirkung nicht mehr schutzlos ausgesetzt. Im Folgenden möchte ich zuerst versuchen, die Ursprünge der Darstellungen von Schwarzen im Mittelalter aufzuzeigen und dann auf aktuellere Bilder eingehen. Dabei lege ich den Fokus auf den deutschsprachigen Raum. Die Beispiele, die ich geben werde, sind eine willkürliche Auswahl besonders anschaulicher Fälle, ähnliche Bilder ließen sich wohl in fast jedem Bereich unseres Alltags finden. Sie sind uns oft so vertraut, dass sie uns nicht einmal mehr auffallen, aber gerade das macht sie so gefährlich. Wenn sich die Vorurteile einer bewussten Reflexion entziehen, können sie unbehindert ihre Wirkung entfalten. Darum hoffe ich ein wenig das Bewusstsein für die unzähligen Quellen zu schärfen, die unsere Vorurteile speisen.
1 „Dabei wurde – historisch betrachtet – ein sehr widersprüchliches Bild vom Fremden gezeichnet. Stichpunktartig seien hier folgende Konturen dieses Bildes umrissen: Nahrungskonkurrent, Handelspartner, „Objekt sexueller Begierde“, Zu-Missionierender, Überbrunger technologischer Innovationen und neuer Lebensstile, nützlicher Kooperationspartner, verbündeter Krieger, Feind, Flüchtling, Eroberer, dumpfe Bedrohung, Leitbild, verachtete Existenz, Fremder im eigenen Land, bewunderter und bestaunter Exote oder auch Störgröße wissenschaftlicher Theorien.“, aus: Hegel, Ralf-Dietmar; Müller, Martin: Einleitung – Wie fremd sind uns die Fremden?, in: Hegel, Ralf-Dietmar (Hg.): Der Name des Fremden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Erkenntnisinteresse und Fragestellung
- 1.2 Definitionen
- 1.2.1 Stereotyp
- 1.2.2 Vorurteil
- 1.2.3 Diskriminierung
- 1.2.4 „Schwarzer“
- 2.1 Überblick
- 2.2 Ursprünge
- 2.2.1 Die Heiligen drei Könige
- 2.2.2 Der Heilige Mauritius
- 2.3 Exoten im kirchlichen Hilfsprogramm – „Entwicklungshilfe“
- 2.3.1 Kolonisation und Missionierung
- 2.3.2 „Entwicklungshilfe“
- 2.4 Exoten im Dienste der Werbung
- 2.4.1 Produkte aus den Kolonien
- 2.4.2 Schwarze in der Werbung seit den 1960ern
- 2.4.3 „United Colors of Benetton“
- 2.5 Schwarze im deutschen Schlager
- 2.5.1 Der deutsche Schlager vor 1933/38
- 2.5.2 Der deutsche Schlager seit 1945
- 2.6 Kinder- und Jugendlieder
- 2.6.1 „Zehn kleine Negerlein“
- 2.6.2 „Negeraufstand ist in Kuba“
- 2.7 Kinder- und Jugendbücher
- 2.7.1 „Onkel Tom's Hütte“
- 2.7.2 „Tim und Struppi“
- 2.8 Das Bild des Fremden in der Wissenschaft
- 2.8.1 Begriffsklärungen
- 2.8.2 „Rassentheorien“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entstehung und den Wandel von Bildern Schwarzer im deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, die Quellen dieser Bilder aufzuzeigen und deren Einfluss auf die Wahrnehmung von Schwarzen zu beleuchten. Die Arbeit fragt, woher Stereotype über Schwarze kommen, da diese oft schon vor persönlicher Begegnung existieren.
- Entwicklung und Wandel von Stereotypen über Schwarze in der deutschen Gesellschaft
- Der Einfluss von Medien (Werbung, Schlager, Kinderliteratur) auf die Konstruktion dieser Bilder
- Die Rolle von Kolonialismus und Missionierung in der Formierung der Wahrnehmung Schwarzer
- Die Bedeutung von „Rassentheorien“ in der wissenschaftlichen Betrachtung des „Fremden“
- Die Wirkung von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung im Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Ursprung und Wandel von Bildern Schwarzer im deutschen Kontext in den Mittelpunkt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass diese Bilder oft vor persönlicher Begegnung mit Schwarzen existieren. Es werden zentrale Begriffe wie Stereotyp, Vorurteil und Diskriminierung definiert und die Methodik der Arbeit skizziert, die auf einer Auswahl anschaulicher Beispiele aus verschiedenen Bereichen des Alltags beruht, um das oft unbewusste Wirken von Vorurteilen aufzuzeigen.
2. Bilder von Schwarzen im Wandel der Zeit: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Darstellung Schwarzer in verschiedenen Medien und Kontexten im Laufe der Geschichte. Es beginnt mit der Analyse historischer Ursprünge, etwa der Darstellung der Heiligen Drei Könige und des Heiligen Mauritius, um dann die Entwicklung in der kolonialen und postkolonialen Ära zu verfolgen, unter anderem durch die Betrachtung von Werbung, Schlagern, Kinderliedern und -büchern. Die Analyse zeigt, wie sich die Darstellung von Schwarzen im Laufe der Zeit veränderte, aber auch die anhaltende Präsenz von Stereotypen und Vorurteilen aufzeigt. Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage gewidmet, wie diese Darstellungen zu Vorurteilen beitragen und wie sie unser Verständnis von „Fremdheit“ beeinflussen. Die Untersuchung der „Rassentheorien“ im wissenschaftlichen Diskurs bildet einen weiteren Schwerpunkt.
Schlüsselwörter
Stereotyp, Vorurteil, Diskriminierung, Schwarze, Bilder, Medien, Werbung, Schlager, Kinderliteratur, Kolonialismus, Missionierung, Rassentheorien, Fremdenbild, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zu: Bilder von Schwarzen im deutschsprachigen Raum
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entstehung und den Wandel von Bildern Schwarzer im deutschsprachigen Raum. Sie analysiert die Quellen dieser Bilder und deren Einfluss auf die Wahrnehmung von Schwarzen. Ein zentrales Anliegen ist die Frage, woher Stereotype über Schwarze stammen, die oft schon vor einer persönlichen Begegnung existieren.
Welche Quellen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert eine breite Palette von Quellen, darunter historische Darstellungen (z.B. die Heiligen Drei Könige, der Heilige Mauritius), Werbung, Schlager, Kinderlieder und -bücher, sowie wissenschaftliche Texte. Der Fokus liegt auf der Darstellung Schwarzer in verschiedenen Medien und Kontexten im Laufe der Geschichte.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet einen langen Zeitraum, beginnend mit historischen Ursprüngen und der Entwicklung über die Kolonial- und Postkolonialzeit bis in die Gegenwart. Es wird die Entwicklung der Darstellung Schwarzer im Laufe der Zeit untersucht und die anhaltende Präsenz von Stereotypen und Vorurteilen aufgezeigt.
Welche konkreten Beispiele werden genannt?
Die Arbeit nennt zahlreiche konkrete Beispiele, wie z.B. „Zehn kleine Negerlein“, „Negeraufstand ist in Kuba“, „Onkel Toms Hütte“, „Tim und Struppi“, die Werbung von „United Colors of Benetton“, und die Darstellung Schwarzer im deutschen Schlager. Diese Beispiele dienen dazu, das oft unbewusste Wirken von Vorurteilen aufzuzeigen.
Welche Rolle spielen Kolonialismus und Missionierung?
Kolonialismus und Missionierung werden als wichtige Faktoren für die Formierung der Wahrnehmung Schwarzer im deutschsprachigen Raum analysiert. Die Arbeit untersucht, wie diese historischen Prozesse die Entstehung und Persistenz von Stereotypen beeinflusst haben.
Welche Bedeutung haben „Rassentheorien“?
Die Arbeit untersucht die Rolle von „Rassentheorien“ im wissenschaftlichen Diskurs und deren Einfluss auf die Konstruktion des „Fremdenbildes“. Es wird analysiert, wie wissenschaftliche Konzepte zu Vorurteilen und Diskriminierung beigetragen haben.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert zentrale Begriffe wie Stereotyp, Vorurteil und Diskriminierung. Die Definitionen bilden die Grundlage für die Analyse der verschiedenen Quellen und Beispiele.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung und den Wandel von Stereotypen über Schwarze in der deutschen Gesellschaft aufzuzeigen und deren Einfluss auf die Wahrnehmung von Schwarzen zu beleuchten. Sie möchte die Quellen dieser Bilder aufzeigen und die Wirkung von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung im Alltag verdeutlichen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in Einleitung, Hauptteil (Bilder von Schwarzen im Wandel der Zeit) und Schlussbemerkungen gegliedert. Der Hauptteil analysiert die Darstellung Schwarzer in verschiedenen Medien und Kontexten. Die Einleitung definiert die Forschungsfrage und die Methodik. Die Schlussbemerkungen fassen die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stereotyp, Vorurteil, Diskriminierung, Schwarze, Bilder, Medien, Werbung, Schlager, Kinderliteratur, Kolonialismus, Missionierung, Rassentheorien, Fremdenbild, Deutschland.
- Arbeit zitieren
- Mag. Andrea Schikowitz (Autor:in), 2003, "Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?" - Das Bild des Schwarzen im Alltag, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115070