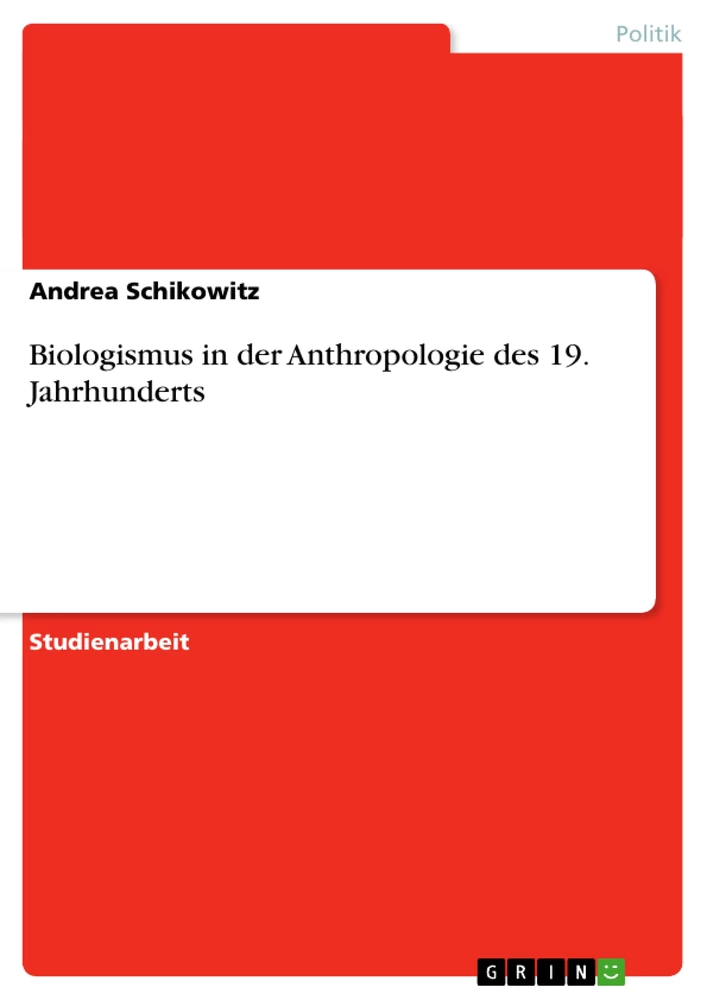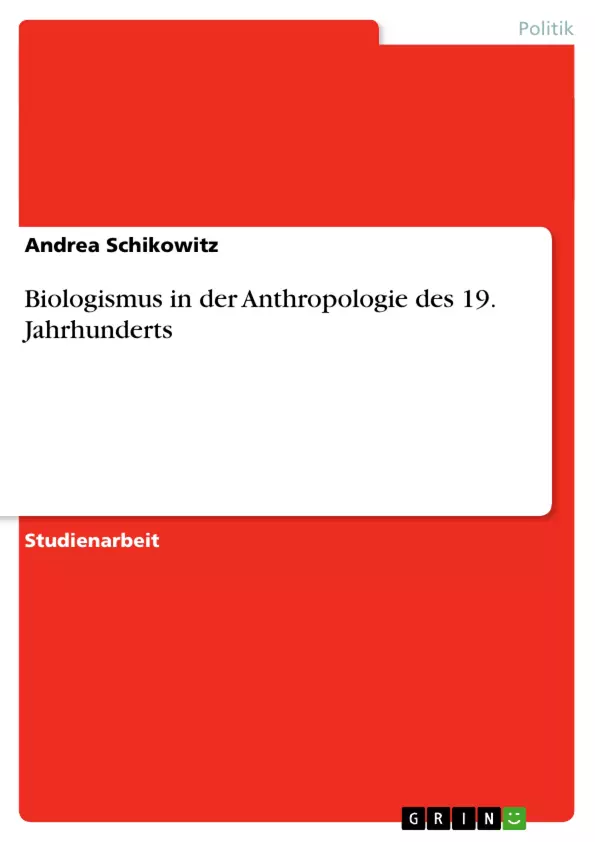Mit der wissenschaftlichen Kritik von Biologismus kam ich das erste Mal im Rahmen des Wahlfaches „Einführung in die Sozialpsychologie“ in Berührung. Dadurch wurde mein Interesse an diesem Thema geweckt und als ich begann, darauf zu achten, entdeckte ich immer häufiger kaum verhohlene biologistische und deterministische Argumentationsweisen in den Medien und im Alltagsdiskurs. Besonders erschreckend erschien mir vor kurzem ein Beitrag in einem Boulevardmagazin im deutschen Privatfernsehen, in dem die Methoden der Physiognomik beschrieben und deren praktische Anwendung zur Beurteilung von Menschen angeregt wurden. Dass derartiges heute noch ernst genommen und so unreflektiert verbreitet wird, machte mich von neuem darauf aufmerksam, wie anfällig unsere Gesellschaft auch heute noch für so gefährliches „Gedankengut“ ist. In mehreren Seminaren über Wissenschaftssoziologie wurde auch über die Gefahren der Wissenschaft und ihrer unreflektierten Rezeption gesprochen. Wie gefährlich als Wissenschaft verpackte Vorurteile in Wechselwirkung mit der Politik sein können, zeigt sich an zahllosen Beispielen - von Militär-Technologie bis zu Gesellschaftspolitik. Biologismus in seinen verschiedenen Formen war und ist meiner Meinung nach dafür ein besonders plakatives Beispiel, weil er Wissenschaftlichkeit vorgaukelt, um bestimmte politische und soziale Maßnahmen zu legitimieren. 1.2. Fragestellung und Arbeitsplan In der vorliegenden Arbeit möchte ich versuchen, die (wissenschaftliche) Entwicklung biologistischer Erklärungsansätze in der Anthropologie des 19. Jahrhunderts nachzuvollziehen und damit die ideologischen Grundlagen dieser Denkweise aufzuzeigen. Dabei möchte ich besonders darauf eingehen, wie die Arbeiten biologistischer Wissenschaftler politisch als Waffen gegen Minderheiten verwendet wurden und so die Gefahren und die immanente Gewalt derartiger Ansätze offen legen. Durch die Bewusstwerdung der Argumentationsstrategien, der falschen Prämissen und verwandter Denkmuster soll die Sensibilität in Bezug auf biologische Determiniertheit geschärft werden und in einigen kurzen Beispielen auf aktuelle Fälle angewendet werden. Die konkrete Frage, die ich daher in der vorliegenden Arbeit stellen möchte lautet: Wie kann biologistisches Denken politisch als Waffe eingesetzt werden?
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Erkenntnisinteresse
- Fragestellung und Arbeitsplan
- Begriffsklärungen
- Anthropologie
- Physiognomik
- Biologischer Determinismus
- Biologismus
- Vulgärdarwinismus oder Sozialdarwinismus
- Biologismus in der Anthropologie des 19. Jahrhunderts
- 18. Jahrhundert
- Gesellschaftliche Voraussetzungen
- Monogenismus und Polygenismus
- 19. Jahrhundert
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Die „wissenschaftliche“ Begründung der Rassentheorie
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Die Entwicklung biologistischer Erklärungsansätze in der Anthropologie des 19. Jahrhunderts
- Die ideologischen Grundlagen des Biologismus
- Die Verwendung biologistischer Theorien zur Rechtfertigung von Diskriminierung und Gewalt
- Die Gefahren des biologistischen Denkens
- Die Sensibilisierung für biologische Determiniertheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung biologistischer Erklärungsansätze in der Anthropologie des 19. Jahrhunderts. Sie analysiert die ideologischen Grundlagen dieser Denkweise und untersucht, wie biologistische Theorien zur Rechtfertigung von Diskriminierung und Gewalt gegen Minderheiten eingesetzt wurden. Die Arbeit zielt darauf ab, die Gefahren des biologistischen Denkens aufzuzeigen und die Sensibilität für biologische Determiniertheit zu schärfen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Erkenntnisinteresse und die Fragestellung der Arbeit dar. Sie beleuchtet die Aktualität des Themas und die Gefahren des biologistischen Denkens. Im Anschluss werden wichtige Begriffe wie Anthropologie, Physiognomik, Biologischer Determinismus, Biologismus und Vulgärdarwinismus definiert und erläutert. Das Hauptkapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung des Biologismus in der Anthropologie des 19. Jahrhunderts. Es analysiert die gesellschaftlichen Voraussetzungen und die wissenschaftlichen Argumente, die zur Begründung der Rassentheorie führten. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Strömungen des Biologismus, wie den Monogenismus und den Polygenismus, und beleuchtet die Rolle der Naturwissenschaften in der Entwicklung des Rassendenkens. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Bedeutung des Themas für die Gegenwart.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Biologismus, Anthropologie, Rassentheorie, 19. Jahrhundert, Determinismus, Physiognomik, Monogenismus, Polygenismus, Diskriminierung, Gewalt, Wissenschaft, Ideologie, Gesellschaft, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Biologismus in der Anthropologie des 19. Jahrhunderts?
Biologismus bezeichnet die Tendenz, menschliches Verhalten und soziale Hierarchien ausschließlich durch biologische Faktoren zu erklären und als unabänderlich (determiniert) darzustellen.
Wie wurden biologistische Theorien politisch als Waffe eingesetzt?
Wissenschaftlich verpackte Vorurteile dienten dazu, die Diskriminierung von Minderheiten, Kolonialismus und soziale Ungerechtigkeit als "natürliche Gegebenheiten" zu legitimieren.
Was ist der Unterschied zwischen Monogenismus und Polygenismus?
Monogenisten gehen von einem gemeinsamen Ursprung aller Menschen aus, während Polygenisten behaupten, verschiedene "Rassen" hätten unterschiedliche Ursprünge, was oft zur Begründung von Rassentheorien genutzt wurde.
Welche Rolle spielt die Physiognomik in diesem Kontext?
Die Physiognomik versuchte, vom äußeren Erscheinungsbild auf den Charakter eines Menschen zu schließen. Im 19. Jahrhundert wurde dies genutzt, um rassistische und klassistische Vorurteile "wissenschaftlich" zu untermauern.
Was versteht man unter Sozialdarwinismus?
Sozialdarwinismus überträgt Darwins Prinzip der "natürlichen Selektion" fälschlicherweise auf menschliche Gesellschaften, um das Recht des Stärkeren und soziale Ausgrenzung zu rechtfertigen.
Warum ist die Kritik am biologischen Determinismus heute noch aktuell?
Auch heute finden sich in Medien und Alltagsdiskursen oft deterministische Argumente, die soziale Probleme biologisieren, weshalb eine kritische Sensibilität gegenüber solchen Denkmustern wichtig bleibt.
- Arbeit zitieren
- Mag. Andrea Schikowitz (Autor:in), 2002, Biologismus in der Anthropologie des 19. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115071