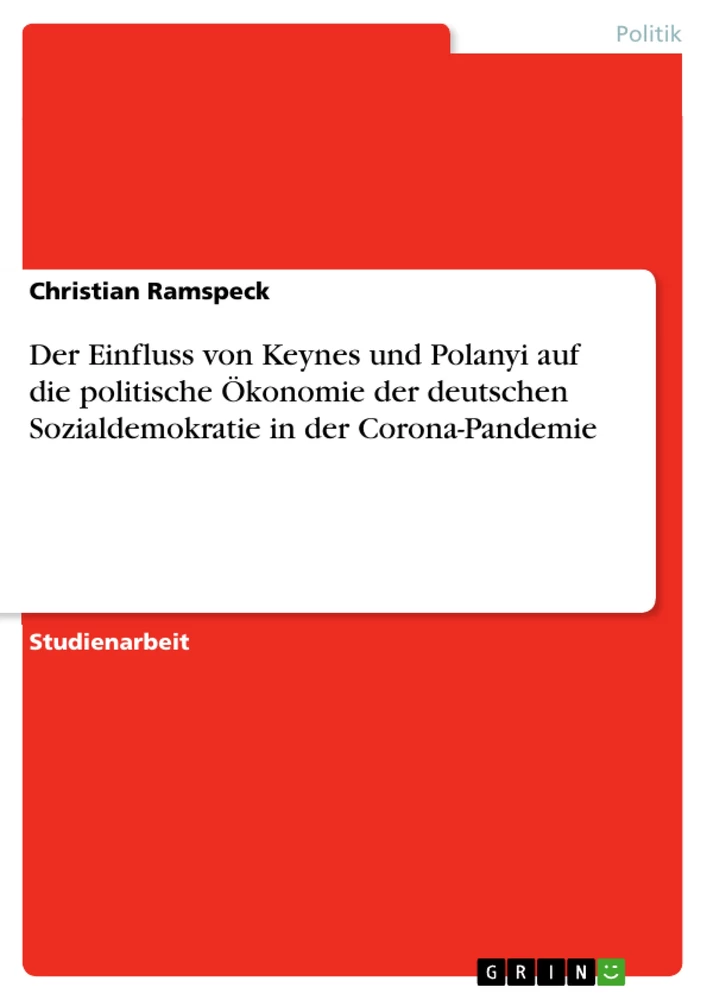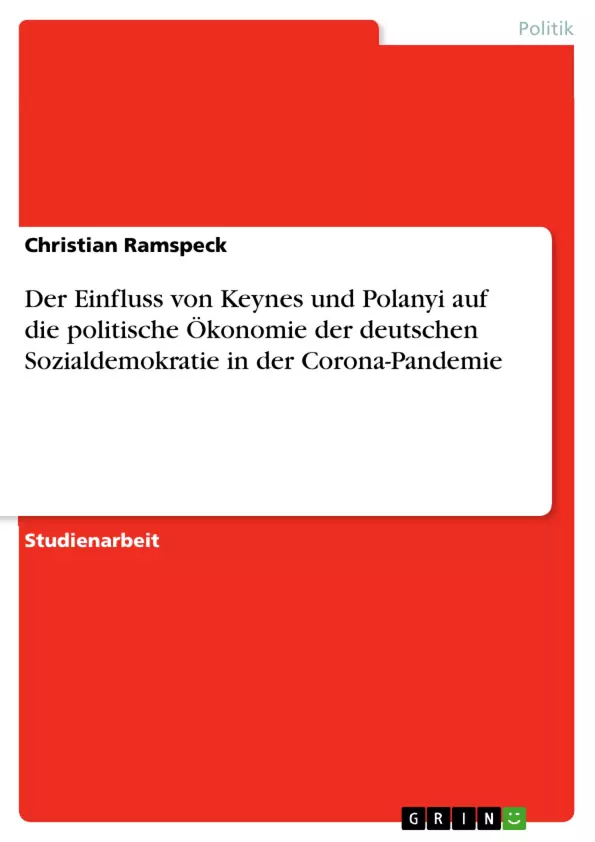Diese Arbeit geht der Frage nach, in welchem Ausmaß die politische Ökonomie der SPD in der Corona-Pandemie von nachfrageorientierten Policies nach Keynes und Polanyi geprägt ist. Durch Darlegung der Thesen und Empfehlungen dieser Ökonomen und einer Analyse der formulierten und implementierten Policies seit Ausbruch der Pandemie wird deutlich, dass Denkmuster von Polanyi, in Bezug auf die fiktiven Waren im Kapitalismus im Bereich Gesundheitspolitik und der Frage des Wertes der Arbeit, durch die Pandemie in der SPD wiederzufinden sind. Darüber hinaus sind die Maßnahmen der Bundesregierung, vor allem in den SPD-Ministerien Finanzen, Arbeit & Soziales und Familie, Senioren, Frauen & Jugend, keynesianisch geprägt. Besonders auffällig ist das vorübergehende Aufgeben der „schwarzen Null“, also erstmalige Nettokreditaufnahmen durch den Bund seit 2014. Außerdem wird durch einen Vergleich der Policies der SPD vor der Pandemie mit denen danach, deutlich, dass ein grundsätzlicher Wandel in der Ausrichtung der, vor allem ökonomischen, Policies erfolgte.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung: Wissenschaftliche Relevanz, Vorstellung des Themas, der Forschungsfrage und des aktuellen Forschungsstands; Erläuterung Vorgehensweise
- Theoretische Grundlagen
- Karl Polanyi
- John M. Keynes
- Bisheriger Einfluss von Keynes & Polanyi auf sozialdemokratische Wirtschaftspolitik in Deutschland
- Bisherige ökonomische Ausrichtung der SPD & Auswirkungen der Pandemie
- Ökonomische Policies der SPD vor der Corona-Pandemie
- Auswirkung der Pandemie auf die konjunkturelle Entwicklung
- Analyse
- Ökonomische Policies der SPD seit Ausbruch der Krise
- Einfluss Polanyi auf ökonomische Policies der SPD
- Einfluss Keynes auf ökonomische Policies der SPD
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss der wirtschaftspolitischen Theorien von Karl Polanyi und John M. Keynes auf die politische Ökonomie der deutschen Sozialdemokratie während der Corona-Pandemie. Sie analysiert, inwieweit die von der SPD in dieser Zeit formulierten und implementierten Policies von den Lehren dieser beiden Ökonomen geprägt sind.
- Analyse des Einflusses von Polanyi und Keynes auf die deutsche Sozialdemokratie
- Bewertung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen der SPD im Kontext der Pandemie
- Untersuchung des Wandels in der ökonomischen Ausrichtung der SPD vor und nach der Pandemie
- Bedeutung von nachfrageorientierten Policies in der Corona-Krise
- Relevanz von wirtschaftspolitischen Theorien für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt die wissenschaftliche Relevanz des Themas, die Forschungsfrage und den aktuellen Forschungsstand dar. Sie erläutert die Vorgehensweise der Arbeit. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit behandelt, indem die Thesen von Karl Polanyi und John M. Keynes sowie deren bisherigen Einfluss auf die sozialdemokratische Wirtschaftspolitik in Deutschland beleuchtet werden.
Das zweite Kapitel widmet sich der ökonomischen Ausrichtung der SPD vor der Corona-Pandemie und den Auswirkungen der Pandemie auf die konjunkturelle Entwicklung. Hier werden die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der SPD vor der Pandemie und die durch die Pandemie bedingten Herausforderungen für die Wirtschaft beleuchtet.
Im dritten Kapitel werden die ökonomischen Policies der SPD seit Ausbruch der Krise analysiert. Dabei wird der Einfluss von Polanyi und Keynes auf die politischen Entscheidungen der SPD untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der politischen Ökonomie der deutschen Sozialdemokratie in der Corona-Pandemie. Die Kernthemen umfassen den Einfluss von Keynes und Polanyi auf die Wirtschaftspolitik, die Analyse der politischen Maßnahmen der SPD, den Wandel in der ökonomischen Ausrichtung der Partei, die Bedeutung von nachfrageorientierten Policies und die Relevanz von wirtschaftspolitischen Theorien für die Praxis. Wesentliche Begriffe sind: Sozialdemokratie, Corona-Pandemie, Keynesianismus, Polanyianismus, Wirtschaftspolitik, nachfrageorientierte Policies, politische Ökonomie, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste Keynes die SPD-Politik in der Corona-Pandemie?
Die Maßnahmen der SPD-geführten Ministerien waren stark keynesianisch geprägt, insbesondere durch die nachfrageorientierte Politik und das vorübergehende Aufgeben der „schwarzen Null“ zur Finanzierung von Rettungspaketen.
Welche Rolle spielen Karl Polanyis Thesen in der Krise?
Polanyis Konzepte der „fiktiven Waren“ finden sich in der Gesundheitspolitik und der Debatte um den Wert der Arbeit wieder. Die SPD besann sich darauf, dass Gesundheit und Arbeit keine reinen Marktgüter sein dürfen.
Gab es einen Wandel in der ökonomischen Ausrichtung der SPD?
Ja, der Vergleich der Policies vor und nach Ausbruch der Pandemie zeigt einen deutlichen Wandel hin zu aktiveren staatlichen Eingriffen und einer Abkehr von rein fiskalischer Zurückhaltung.
Was sind nachfrageorientierte Policies?
Dies sind wirtschaftspolitische Maßnahmen, die darauf abzielen, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stärken (z. B. durch Kurzarbeitergeld oder Familienbeihilfen), um die Konjunktur in Krisenzeiten zu stabilisieren.
Welche Ministerien waren für die Umsetzung dieser Theorien zentral?
Zentral waren die SPD-Ministerien für Finanzen, Arbeit & Soziales sowie Familie, Senioren, Frauen & Jugend, die durch massive Ausgabenprogramme die sozialen Folgen der Pandemie abfederten.
- Citar trabajo
- Christian Ramspeck (Autor), 2020, Der Einfluss von Keynes und Polanyi auf die politische Ökonomie der deutschen Sozialdemokratie in der Corona-Pandemie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1150916