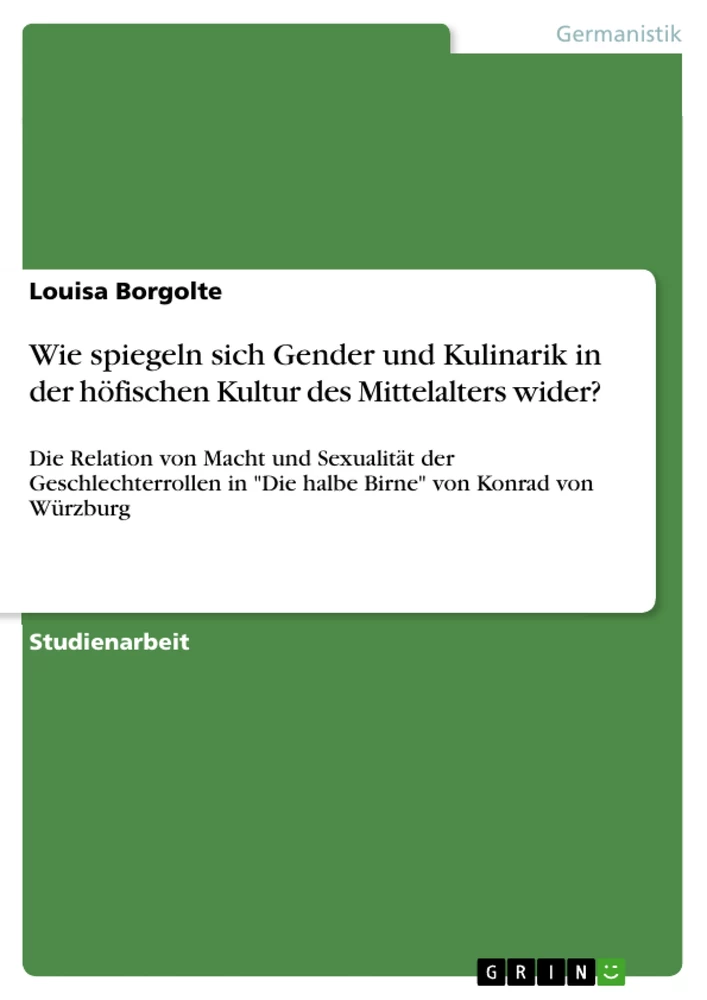Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Gender und Kulinarik im Mittelalter anhand Konrad von Würzburgs „Die halbe Birne“ mit der Fragestellung, in welcher Relation Sexualität und Macht das weibliche und männliche Geschlecht zueinanderstehen. Im Weiteren wie die Rittermahle zu Hofe - und die Nahrung, welche dort angereicht wurde - als sexuelles Zeichen fungierte. „Die halbe Birne“ ist eine Märe, welche circa 1300 von dem mittelalterlichen Autor, welcher auch als Lyriker, Dichter und Epiker bekannt war, verfasst wurde.
Das Zubereiten von Mahlzeiten und der gemeinsame Verzehr dieser ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil aller Kulturen und Gesellschaften der Welt. Somit ist die Kulinarik also nicht nur eine lebensnotwendige Pflicht. Sie hat auch andere Zwecke, wenn man einen Blick in die höfische Kultur des Mittelalters wirft. Denn dort wurde das gemeinsame Verspeisen von Lebensmitteln auch als Einleitung eines folgenden Sexualakts zwischen einem Paar angesehen. Dabei geht es auf der einen Seite um das gemeinsame Essen als Akt der Intimität, der an der Tafel und im Schlafzimmer erlebt werden kann und auf der anderen Seite um die Funktion von Nahrung als Metapher der Intimität.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gender
- Untersuchung des Textes
- Kulinarische Szene
- Sexeskapade
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verbindung zwischen Gender und Kulinarik im Mittelalter, insbesondere im Kontext von Konrad von Würzburgs „Die halbe Birne“. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Sexualität und Macht die Geschlechterrollen im höfischen Kontext beeinflussen und wie Rittermahlzeiten als sexuelles Zeichen fungierten. Im Fokus stehen die Beziehung zwischen gemeinsamen Essen und Intimität sowie die Nutzung von Nahrung als Metapher der Intimität.
- Die Rolle von Essen und Trinken in der höfischen Kultur des Mittelalters
- Die Bedeutung von Nahrung als Ausdruck von Macht und Status
- Die Verbindung zwischen Kulinarik und Sexualität in der höfischen Kultur
- Die Darstellung von Geschlechterrollen in Konrad von Würzburgs „Die halbe Birne“
- Die Analyse von symbolischen Bedeutungen in der kulinarischen Szene des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung behandelt die alltägliche Bedeutung von Ernährung und Essen als Grundbedürfnis und Kulturphänomen. Sie stellt die Kulinarik als interdisziplinäres Forschungsfeld vor und betont die vielfältigen Aspekte des Essens und Trinkens in verschiedenen Kulturen. Außerdem wird die Verbindung von Essen und Sexualität in der höfischen Kultur des Mittelalters als zentrale Thematik der Arbeit eingeführt.
Gender
Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle von Gender in der höfischen Kultur des Mittelalters. Es analysiert die Geschlechterrollen und die damit verbundenen Machtverhältnisse sowie die Interaktion zwischen den Geschlechtern im Kontext von Kulinarik.
Untersuchung des Textes
Kulinarische Szene
Dieser Abschnitt analysiert die kulinarischen Szenen in Konrad von Würzburgs „Die halbe Birne“. Er befasst sich mit der Art und Weise, wie Essen präsentiert und konsumiert wird, und untersucht die symbolischen Bedeutungen der Speisen im Kontext der Handlung.
Sexeskapade
Dieser Abschnitt untersucht die sexuelle Szene im Text und analysiert die Beziehung zwischen Kulinarik und Sexualität. Er beleuchtet die Verbindung von Essen und Intimität und untersucht die Rolle von Nahrung als Metapher für sexuelle Begierde.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Gender, Kulinarik, höfische Kultur, Mittelalter, Konrad von Würzburg, „Die halbe Birne“, Sexualität, Macht, Rittermahlzeiten, Symbolismus, Metapher und Interdisziplinarität.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Märe „Die halbe Birne“?
Es handelt sich um eine Erzählung von Konrad von Würzburg (um 1300), die den Zusammenhang zwischen höfischer Kultur, Essen und Sexualität thematisiert.
Wie wird Nahrung als sexuelles Zeichen genutzt?
In der höfischen Literatur dient das gemeinsame Einnehmen von Speisen oft als Metapher für Intimität oder als direkte Einleitung eines folgenden Sexualakts.
Welche Rolle spielt „Gender“ in diesem Kontext?
Die Arbeit untersucht, wie Macht und Sexualität das Verhältnis zwischen Mann und Frau an der höfischen Tafel und im Schlafzimmer bestimmen.
War Kulinarik im Mittelalter mehr als nur Ernährung?
Ja, Rittermahle zu Hofe waren hochsymbolische Akte, die den sozialen Status demonstrierten und als ritueller Raum für die Interaktion zwischen den Geschlechtern dienten.
Wer war Konrad von Würzburg?
Konrad von Würzburg war ein bedeutender mittelalterlicher Autor, der als Lyriker, Dichter und Epiker bekannt war und für seine kunstvolle Sprache geschätzt wurde.
Was ist das Fazit der Untersuchung von „Die halbe Birne“?
Die Erzählung verdeutlicht, dass Kulinarik und Erotik im Mittelalter untrennbar miteinander verwoben waren und Nahrung als mächtiges Symbol für Begehren und Macht fungierte.
- Arbeit zitieren
- Louisa Borgolte (Autor:in), 2021, Wie spiegeln sich Gender und Kulinarik in der höfischen Kultur des Mittelalters wider?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1151192