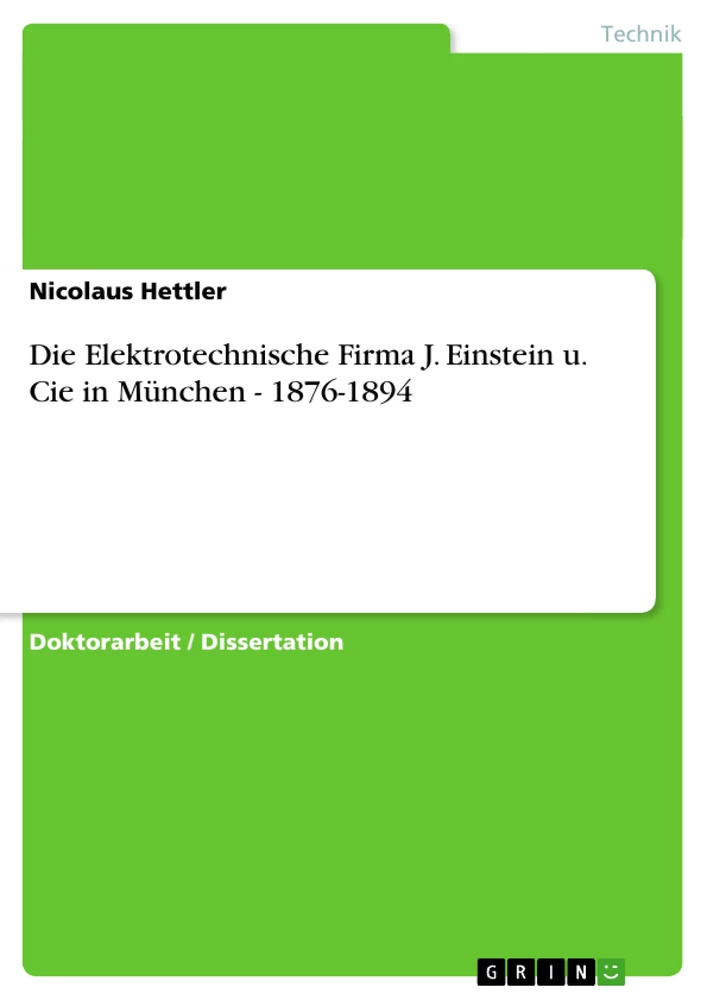Die Entdeckung und Nutzbarmachung einer neuen Technikart, die dazu noch zu einem bedeutenden eigenständigen Wirtschaftszweig wird, führt früher oder später zwangsläufig zu einer Beschreibung ihrer Entstehungsgeschichte. Dies gilt selbstverständlich auch für die Elektrotechnik.
Die Geburtsstunde dieser Branche wurde zunächst durch die Biographien ihrer großen Pioniere skizziert, so zum Beispiel durch die „Lebenserinnerungen“ von Werner von Siemens, die 1893 erschienen. Die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichten der großen Firmen, die sich auf dem deutschen und dem Weltmarkt durchsetzen konnten, wurden mit Akribie recherchiert. Dies ging zwangsläufig mit der Beschreibung des Umfeldes, also der gesamten Branche, einher.
So entstanden nach und nach die Firmengeschichten der Siemens AG, der AEG oder der BBC. Dagegen gerieten kleinere Firmen, die wenig erfolgreich waren oder von den Großen der Branche geschluckt wurden, schnell wieder in Vergessenheit. Es sei nur an die Kölner Helios oder die Firma Kummer aus Dresden erinnert.
Noch weniger oder gar keine Beachtung fanden bisher die kleinen mittelständischen Unternehmen, die ebenso ihren Teil zu der Entwicklungsgeschichte dieser neuen Technikform beigetragen haben, und deren heute nicht mehr so bekannte Forscher und Firmengründer versuchten, dem Beispiel Werner von Siemens´ zu folgen.
enn zu Beginn der neuen Ära standen die meisten der Pioniere vor den gleichen Problemen. Eine sehr aussagekräftige Beschreibung dieser Epoche finden wir bei Heinrich Voigt, dem Mitinhaber der Firma Staudt&Voigt:
„Und so war es für viele damals der einzige Gedanke, der sie Tag und Nacht verfolgte, auch eine Dynamomaschine bauen zu können, gerade wie jetzt für die Erfindertätigkeit der jungen Leute das Flugzeug oder die Funkentelegraphie im Mittelpunkt des Interesses steht. Welcher Unterschied aber zwischen damals und heute! Während für die letztgenannten Probleme Literatur in Hülle und Fülle vorliegt, Material gegen Geld für alle Ansprüche zu haben ist, standen die Dynamo-Autodidakten gewissermaßen mit völlig leeren Händen da. Kaum, da[ß] man umsponnenen Kupferdraht kaufen konnte. Man wußte aber wenig oder nichts über Leitfähigkeit, und Widerstandsmessungen konnten die wenigsten machen, weil gerade diejenigen, die sich an das Problem heranwagten, nur Mechaniker und keine Physiker waren, die selbst, wenn sie ein Siemensches Torsionsgalvanometer gehabt hätten, kaum etwas damit anfangen konnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Abgrenzung des Themas
- 3 Quellenlage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Geschichte der Elektrotechnischen Firma J. Einstein & Cie. in München (1876-1894) zu rekonstruieren und sie in den Kontext der frühen Elektrotechnik in Bayern und des Lebensumfelds des jungen Albert Einstein einzuordnen. Der Fokus liegt auf der Firmengeschichte, beleuchtet aber auch die Herausforderungen und den rasanten Wandel der Branche Ende des 19. Jahrhunderts.
- Die Entwicklung der Elektrotechnischen Firma J. Einstein & Cie.
- Die Herausforderungen des frühen Elektrotechnik-Marktes.
- Der Einfluss des technischen Wandels auf kleine und mittlere Unternehmen.
- Das Umfeld der Elektrotechnik in München um 1890.
- Die Rolle von Fachvereinen und Messen in der Branche.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung skizziert den Kontext der Entstehung der Elektrotechnik als eigenständiger Wirtschaftszweig und hebt die Bedeutung kleiner und mittelständischer Unternehmen hervor, die oft in Vergessenheit geraten sind. Sie illustriert die anfänglichen Herausforderungen für Elektrotechnik-Pioniere anhand eines Zitats von Heinrich Voigt, welches die mangelnde Verfügbarkeit von Materialien und Instrumenten beschreibt und den hohen Grad an Improvisation verdeutlicht, der notwendig war. Die Einleitung führt schließlich zur Elektrotechnischen Fabrik J. Einstein & Cie. als Beispiel für ein solches Unternehmen und kündigt die Zielsetzung der Arbeit an: die Darstellung der Firmengeschichte und deren Einbettung in das Umfeld des jungen Albert Einstein.
2 Abgrenzung des Themas: Dieses Kapitel definiert den Gegenstand der Arbeit: die Geschichte der Elektrotechnischen Firma J. Einstein & Cie. von 1876 bis 1894 in München. Es wird betont, dass der Schwerpunkt auf der Firmengeschichte und ihrem Umfeld liegt, wobei der Fokus auf dem bayerischen Raum liegt und ausländische Aktivitäten nur am Rande betrachtet werden, da eine umfassende Darstellung den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Das Kapitel beschreibt die Grenzen der Quellenlage und die daraus resultierenden Einschränkungen der Untersuchung, insbesondere bezüglich kleinerer Projekte und der frühen Jahre der Firma vor 1885.
3 Quellenlage: Dieses Kapitel beschreibt die Quellen, die für die Arbeit herangezogen wurden. Es unterscheidet zwischen allgemeinen Quellen zur Geschichte der Elektrotechnik (Bücher, Fachzeitschriften wie das „Centralblatt für Elektrotechnik“) und firmenspezifischen Quellen. Die Bedeutung von Fachzeitschriften, Festschriften und Erinnerungen führender Persönlichkeiten wird hervorgehoben. Die Quellenlage wird als unterschiedlich bewertet, wobei die Dokumentation von größeren Projekten als besser eingeschätzt wird als die von kleineren Privatinstallationen.
Schlüsselwörter
Elektrotechnik, J. Einstein & Cie., München, Bayern, Firmengeschichte, Albert Einstein, 19. Jahrhundert, Starkstromtechnik, Technische Entwicklung, Mittelständische Unternehmen, Quellenlage, Fachvereine, Internationale Messen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Firmengeschichte von J. Einstein & Cie.
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit rekonstruiert die Geschichte der Elektrotechnischen Firma J. Einstein & Cie. in München (1876-1894) und ordnet sie in den Kontext der frühen Elektrotechnik in Bayern und des Lebensumfelds des jungen Albert Einstein ein. Der Fokus liegt auf der Firmengeschichte, beleuchtet aber auch die Herausforderungen und den rasanten Wandel der Branche Ende des 19. Jahrhunderts.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Firma J. Einstein & Cie., die Herausforderungen des frühen Elektrotechnik-Marktes, den Einfluss des technischen Wandels auf kleine und mittlere Unternehmen, das Umfeld der Elektrotechnik in München um 1890 und die Rolle von Fachvereinen und Messen in der Branche.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf allgemeine Quellen zur Geschichte der Elektrotechnik (Bücher, Fachzeitschriften wie das „Centralblatt für Elektrotechnik“) und firmenspezifische Quellen wie Festschriften und Erinnerungen führender Persönlichkeiten. Die Quellenlage wird als unterschiedlich bewertet, wobei die Dokumentation größerer Projekte besser ist als die kleinerer Projekte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die den Kontext der Elektrotechnik und die Herausforderungen für Pioniere beschreibt. Es folgt ein Kapitel zur Abgrenzung des Themas und die Definition des Untersuchungszeitraums (1876-1894). Ein weiteres Kapitel behandelt die Quellenlage. Die Arbeit enthält außerdem eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Einschränkungen gibt es?
Die Arbeit konzentriert sich auf den bayerischen Raum und betrachtet ausländische Aktivitäten nur am Rande. Die Quellenlage begrenzt die Untersuchung, insbesondere bezüglich kleinerer Projekte und der frühen Jahre der Firma vor 1885.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht keine expliziten Schlussfolgerungen im FAQ, aber die detaillierte Rekonstruktion der Firmengeschichte und ihre Einordnung in den historischen Kontext ermöglicht es dem Leser, eigenständig Schlussfolgerungen zu ziehen bezüglich der Entwicklung der Elektrotechnik, der Herausforderungen für kleine und mittelständische Unternehmen und der Rolle von J. Einstein & Cie. in diesem Umfeld.
Wer ist die Zielgruppe?
Die Zielgruppe dieser Arbeit sind Personen, die sich für die Geschichte der Elektrotechnik, die Geschichte kleiner und mittelständischer Unternehmen und die Geschichte Bayerns im 19. Jahrhundert interessieren. Die Arbeit ist insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise konzipiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Elektrotechnik, J. Einstein & Cie., München, Bayern, Firmengeschichte, Albert Einstein, 19. Jahrhundert, Starkstromtechnik, Technische Entwicklung, Mittelständische Unternehmen, Quellenlage, Fachvereine, Internationale Messen.
- Quote paper
- Nicolaus Hettler (Author), 1996, Die Elektrotechnische Firma J. Einstein u. Cie in München - 1876-1894, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11512