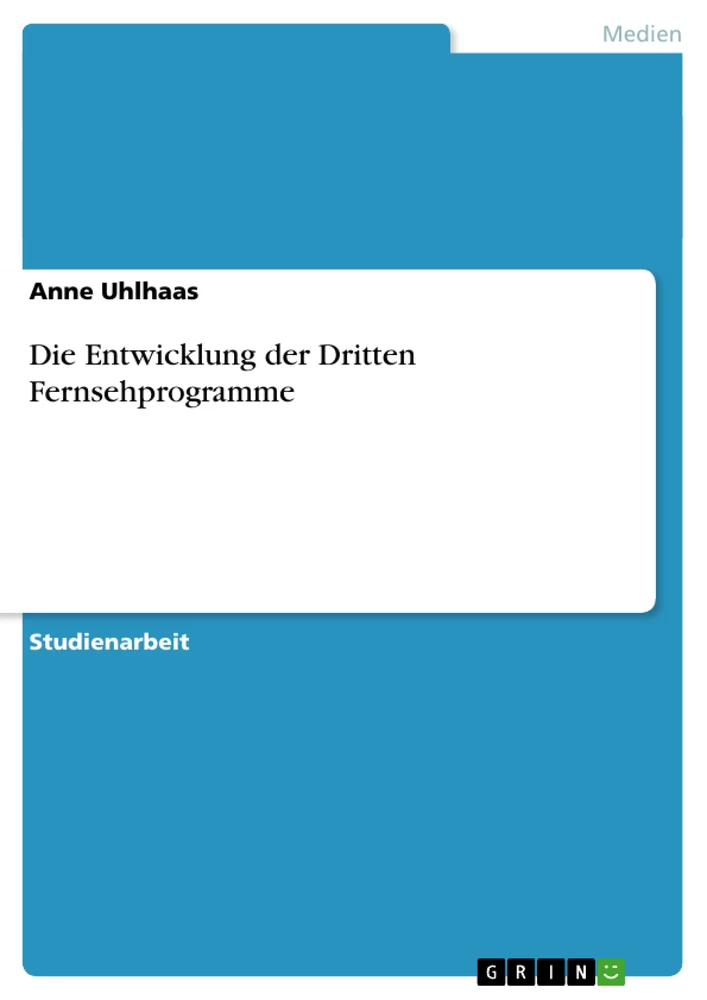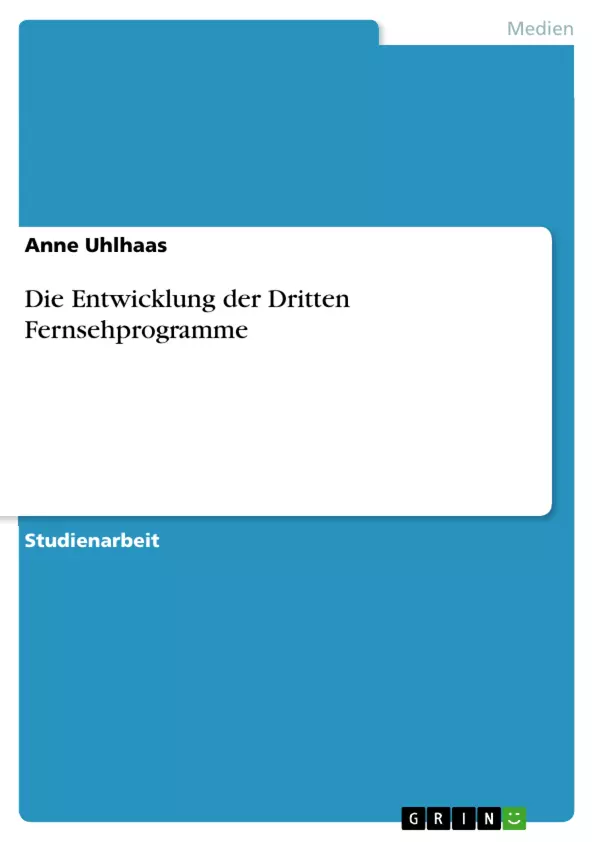Das Fernsehen ist, wie alle Medien, nicht nur Vermittler, sondern auch Bestandteil des kulturellen Lebens, gleichgültig, ob man einen engen oder weiteren Kulturbegriff zugrunde legt.
Die rechtliche Grundlage der Bildung und Kultur im Fernsehen bildet der „Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland“ vom 31. August 1991, der mit seiner vierten Änderung am 1. Januar 2001 in Kraft getreten ist. In ihm heißt es sowohl für öffentlich-rechtliche als auch für private Programme: „Die Rundfunkprogramme sollen zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen und europäischen Raum mit einem angemessenen Anteil an Information, Kultur und Bildung beitragen.“
Im Nationalsozialismus waren Bildung und Information zu Propagandainstrumenten der Machthaber verkommen. Deshalb wiesen die Westalliierten den neu zugelassenen Rundfunkanstalten eine hervorragende Aufgabe bei der reeducation zu, der Erziehung der Deutschen zur Demokratie. Die Bedeutung, die die Siegermächte der Bildung beimaßen, zeigt sich auch daran, dass Bildung neben Unterhaltung und Information in den Rundfunkgesetzen der Länderparlamente der BRD als verbindlicher Programmauftrag der öffentlich-rechtlichen Anbieter definiert ist.
Der Programmauftrag der Bildung und Kulturvermittlung wurde in Deutschland auf verschiedene Weise umgesetzt. Deshalb kann man in der BRD nicht nur von einem Bildungs- und Kulturfernsehen sprechen, da verschiedene Programmansätze und Organisationsformen möglich sind.
Die Entwicklung der Bildung und Kultur im Fernsehen soll hier deshalb am Beispiel der Gründung und Entwicklung der Dritten Fernsehprogramme deutlich gemacht werden. An den Veränderungen der Ansprüche und den daraus folgenden Änderungen im Programmschema der Dritten kann man die Wandlung der Bildung und des Bildungsbedarfs im deutschen Fernsehen am besten beispielhaft darstellen. Die Entwicklung der Dritten soll anhand der Frage behandelt werden, ob sie an ihrem Bildungsauftrag gescheitert sind, oder ob sie – dem geänderten Bildungsbedürfnis Rechnung tragend – mit der Zeit gegangen sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bildung und Kultur im deutschen Fernsehen
- 3. Die dritten Fernsehprogramme
- 3.a. Die Gründung der dritten Programme - Voraussetzungen und Erwartungen
- 3.b. Das Programmschema der Dritten Programme in den 60er Jahren
- 3.c. Die Abkehr vom reinen Bildungsfernsehen und die Verflachung des Programms in den 70ern und 80ern
- 3.d. Die heutige Bildungssituation der Dritten Programme
- 4. Zusammenfassung und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der dritten Fernsehprogramme in Deutschland. Ziel ist es, zu analysieren, inwieweit diese Programme ihrem ursprünglichen Bildungsauftrag gerecht geworden sind und wie sich ihr Programmschema im Laufe der Zeit verändert hat. Die Arbeit beleuchtet die Anpassung an ein sich veränderndes Bildungsbedürfnis der Gesellschaft.
- Bildungsauftrag der dritten Programme
- Entwicklung des Programmschemas im Zeitverlauf
- Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Programmausrichtung
- Vergleich öffentlich-rechtlicher und privater Programme
- Bewertung der heutigen Relevanz der dritten Programme
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Erfolg der dritten Programme in der Erfüllung ihres Bildungsauftrags. Sie skizziert den rechtlichen Rahmen (Rundfunkstaatsvertrag) und die historische Bedeutung von Bildung im Fernsehen, insbesondere im Kontext der Nachkriegszeit und der Reeducation. Der Fokus wird auf die Analyse der dritten Programme als Beispiel für die Umsetzung des Bildungsauftrags gelegt.
2. Bildung und Kultur im deutschen Fernsehen: Dieses Kapitel beleuchtet den generellen Kontext von Bildung und Kultur im deutschen Fernsehen, indem es die verschiedenen Programmansätze und Organisationsformen der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender beschreibt. Es betont die unterschiedlichen Ansätze in der Vermittlung von Bildung und Kultur und legt den Grundstein für die spätere detaillierte Betrachtung der dritten Programme.
3. Die dritten Fernsehprogramme: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert die Entwicklung der dritten Programme in mehreren Unterkapiteln. Es untersucht die Entstehung der Programme, ihre anfänglichen Ziele und Erwartungen, ihr Programmschema in den 60er Jahren und die spätere Abkehr vom reinen Bildungsfernsehen. Die Entwicklung in den 70er und 80er Jahren wird untersucht, sowie die heutige Rolle der dritten Programme in Bezug auf Bildung und Kultur. Dabei wird die Frage nach dem Erfolg des Bildungsauftrags kontinuierlich beleuchtet.
Schlüsselwörter
Dritte Fernsehprogramme, Bildungsauftrag, Programmentwicklung, Rundfunkstaatsvertrag, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Bildungsfernsehen, Kulturvermittlung, gesellschaftliche Veränderungen, Programmgeschichte, Reeducation.
Häufig gestellte Fragen zur Entwicklung der dritten Fernsehprogramme in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der dritten Fernsehprogramme in Deutschland. Im Fokus steht die Untersuchung, inwieweit diese Programme ihrem ursprünglichen Bildungsauftrag gerecht geworden sind und wie sich ihr Programmschema im Laufe der Zeit verändert hat. Die Anpassung an ein sich veränderndes Bildungsbedürfnis der Gesellschaft wird dabei beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu Bildung und Kultur im deutschen Fernsehen, ein umfangreiches Kapitel zu den dritten Fernsehprogrammen (mit Unterkapiteln zur Gründung, Programmschema in den 60ern, Entwicklung in den 70ern/80ern und der heutigen Situation) und eine Zusammenfassung mit Schlussbetrachtung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Bildungsauftrag der dritten Programme, die Entwicklung ihres Programmschemas, den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Programmausrichtung, einen Vergleich öffentlich-rechtlicher und privater Programme und die Bewertung der heutigen Relevanz der dritten Programme.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Entwicklung der dritten Fernsehprogramme im Hinblick auf ihren Bildungsauftrag zu analysieren und zu bewerten, wie erfolgreich sie diesen Auftrag über die Jahre hinweg erfüllt haben. Die Arbeit untersucht die Veränderungen des Programmschemas im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen.
Wie wird die Entwicklung der dritten Programme dargestellt?
Das Kapitel zu den dritten Fernsehprogrammen analysiert die Entstehung der Programme, ihre anfänglichen Ziele und Erwartungen, das Programmschema der 60er Jahre, die Abkehr vom reinen Bildungsfernsehen in den 70er und 80er Jahren und die heutige Rolle der Programme im Kontext von Bildung und Kultur. Die Frage nach dem Erfolg des Bildungsauftrags wird dabei kontinuierlich beleuchtet.
Welchen Kontext stellt die Arbeit her?
Die Arbeit stellt den Kontext von Bildung und Kultur im deutschen Fernsehen allgemein dar, indem sie verschiedene Programmansätze und Organisationsformen der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender beschreibt. Sie betont die unterschiedlichen Ansätze in der Vermittlung von Bildung und Kultur.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Dritte Fernsehprogramme, Bildungsauftrag, Programmentwicklung, Rundfunkstaatsvertrag, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Bildungsfernsehen, Kulturvermittlung, gesellschaftliche Veränderungen, Programmgeschichte, Reeducation.
Welche Bedeutung hat die Einleitung?
Die Einleitung führt in das Thema ein, stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Erfolg der dritten Programme in der Erfüllung ihres Bildungsauftrags und skizziert den rechtlichen Rahmen (Rundfunkstaatsvertrag) und die historische Bedeutung von Bildung im Fernsehen, insbesondere im Kontext der Nachkriegszeit und der Reeducation.
- Arbeit zitieren
- Anne Uhlhaas (Autor:in), 2001, Die Entwicklung der Dritten Fernsehprogramme, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11515