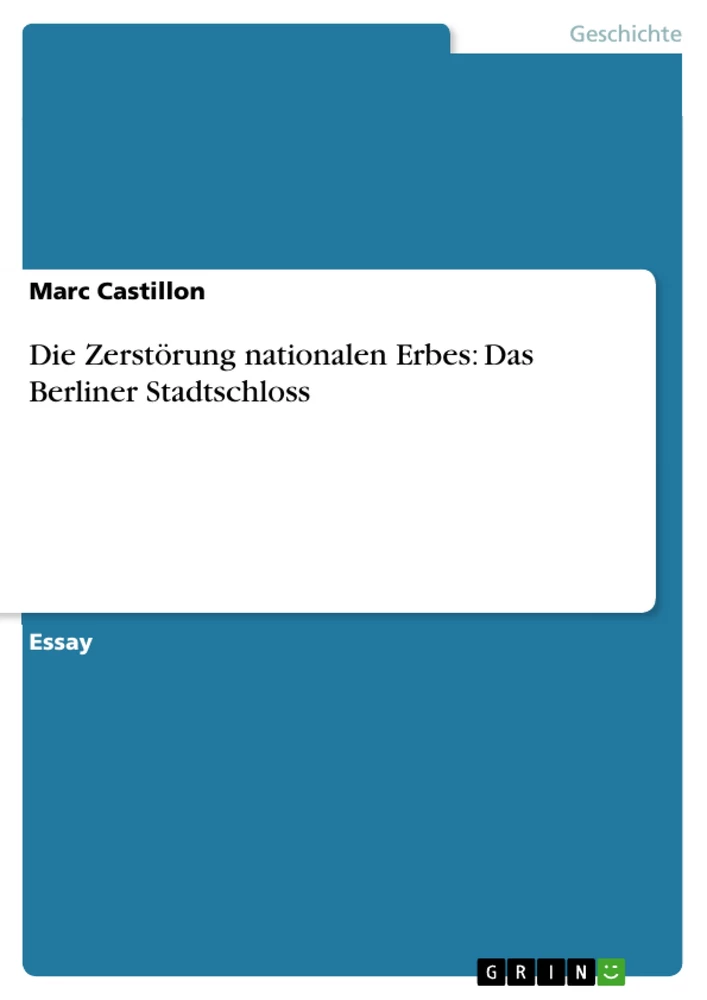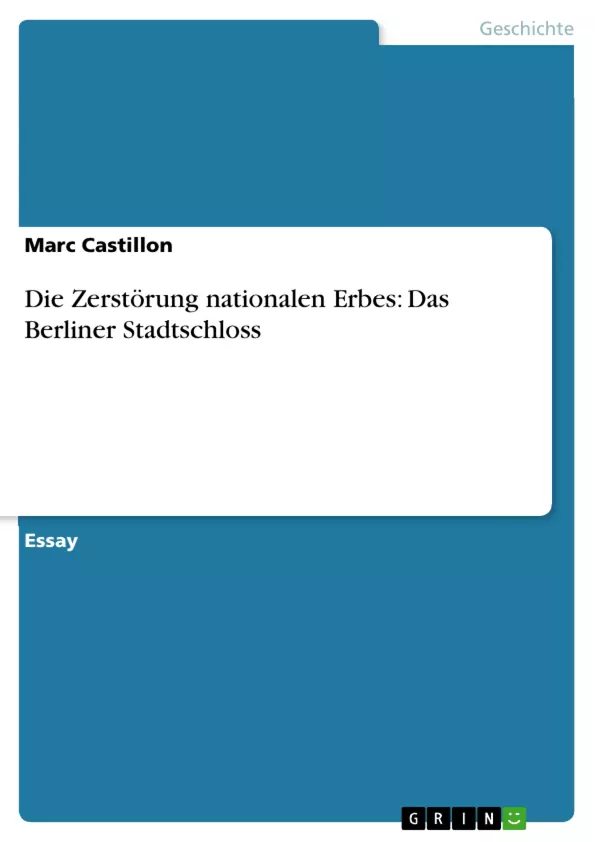Die Sprengung des Berliner Schlosses wird in der Literatur oft als reiner Willkürakt beschrieben. Dem war nicht so: Die DDR-Führung wollte die preußische Geschichte aus ideologischen Gründen tilgen. Das Berliner Schloss (und beispielsweise auch das Potsdamer Schloss sowie die Potsdamer Garnisonskirche) wurden gesprengt, obwohl sein Wiederaufbau – wie u. a. das Schloss Charlottenburg beweißt – möglich gewesen wäre, und dass obwohl das Schloss nach den Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg (im November 1943, im Mai 1944 und vor allen im Februar 1945) immerhin sogar noch 5 ½ Jahre schutzlos der Witterung ausgesetzt war. Auf einen schlechten baulichen Zustand als Grund für den Abriss des Schlosses konnte sich also niemand berufen. Laurenz Demps bring es auf dem Punkt: „Die Ruine des Schlosses konnte im Selbstverständnis der Handelnden keine Sinnstiftung mehr übernehmen, sie konnte auch nicht Sinnstiftung sein. Nur ihre Vernichtung machte den Weg frei für eine Neuordnung der Stadt und eine neue Sinnstiftung.“ Zeitzeugen wussten jedoch schon vor dem eigentlichen Abriss des Schlosses das Motiv zu benennen: „Mit dem Schloss wollte man eine monarchistische und aristokratische ‚Tradition’ vernichten.“ Genau dieses nationale Erbe und nationale Symbolhaftigkeit des Schlosses und seine Bedeutung für die nationale, gesamtdeutsche Identifikation nach der Wiedervereinigung waren Hauptargumente für den Beschluss zum Wiederaufbau des Berliner Schlosses im Jahre 2002. Der kunsthistorische Aspekt des Schlosses tangierte die SED-Regierung nicht, sie entschieden aus rein politisch-ideologischem Kalkül über die Vernichtung von nationalem Erbe. Das Schloss sollte nach den politischen Vorstellungen Ulbrichts & Co unter dem vordergründigen Argument städtebaulicher Belange einem zentralen Demonstrationsplatz für bis zu 300.000 Menschen weichen. Dieser uferlose Aufmarschplatz, ansonsten ohne Funktion, wurde 1951 Realität: Der Marx-Engels-Platz. Im Jahre 1976 wurde durch den Palast der Republik, dem „Palast für das Volk“ anstelle des Hohenzollernschlosses, in der sozialistischen Stadtmitte ein neues bedeutungsschwangeres Symbol gesetzt. Der Palast sollte eine enge Verbundenheit zwischen dem Volk und dem politischen Regime demonstrieren. Wie wir wissen symbolhafte Blüten, die rasch verwelkten.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Nachwendediskussion: Nationale Identitätsstiftung des Berliner Schlosses
- Abrisswelle 1945 bis 1950
- Beseitigung des Doms oder des Berliner Schlosses?
- Der Weg zum und die Gründe für den Abriss des Berliner Stadtschlosses 1950
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Debatte um den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses nach dem Zweiten Weltkrieg und der Wende. Er analysiert die Argumente für und gegen den Wiederaufbau, insbesondere im Kontext der nationalen Identitätsstiftung und der sowjetisch beeinflussten Stadtplanung der DDR.
- Nationale Identitätsstiftung durch das Berliner Stadtschloss
- Die Rolle des Schlosses in der sowjetischen Stadtplanung
- Politische Opportunismus und Propaganda in Bezug auf den Abriss
- Der Konflikt zwischen Geschichtsbewusstsein und sozialistischer Stadtplanung
- Die Zerstörung des Berliner Stadtschlosses im Kontext der Abrisspolitik nach 1945
Zusammenfassung der Kapitel
Zur Nachwendediskussion: Nationale Identitätsstiftung des Berliner Schlosses: Dieser Abschnitt behandelt die Bedeutung des Berliner Stadtschlosses als nationales Symbol in der Nachwendezeit. Es wird argumentiert, dass der Wiederaufbau des Schlosses als Mittel zur Schaffung einer gemeinsamen gesamtdeutschen Identität nach der Wiedervereinigung gesehen wurde. Zitate von Politikern wie Günter Rexrodt unterstreichen die Hoffnung auf einen historischen Identifikationspunkt, der die Sehnsucht nach Einheit und einem gemeinsamen Erbe repräsentiert. Der Abriss des Palastes der Republik und der anschließende Beschluss zum Wiederaufbau des Stadtschlosses werden als Ausdruck dieses Strebens nach einer gemeinsamen Identität interpretiert, die auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückgreift.
Abrisswelle 1945 bis 1950: Dieser Teil beschreibt die systematische Beseitigung von Erinnerungszeichen des Nationalsozialismus und des preußisch-deutschen Militarismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Die anfängliche Zurückhaltung der SMAD (Sowjetische Militäradministration in Deutschland) gegenüber dem Abriss von Denkmälern wird mit dem späteren Drängen der Politik auf die Beseitigung unerwünschter Geschichtszeichen kontrastiert. Das Berliner Schloss stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Fokus des Abrissinteresses, obwohl die Frage nach einem Raum für die politische Willensbildung im Zentrum Berlins bereits diskutiert wurde.
Beseitigung des Doms oder des Berliner Schlosses?: Dieser Abschnitt beleuchtet die Überlegungen zur Beseitigung des Berliner Doms oder des Schlosses zur Schaffung eines Aufmarschplatzes. Die Zerstörung beider Bauwerke im Zweiten Weltkrieg wird beschrieben. Es wird deutlich, dass die Entscheidung für den Abriss des Schlosses anstatt des Doms aus politischen Gründen getroffen wurde, um mögliche negative Reaktionen im Westen zu vermeiden. Die Aussage von Wilhelm Girnus, einem späteren Staatssekretär der DDR, veranschaulicht diese pragmatische, politische Kalkulation.
Der Weg zum und die Gründe für den Abriss des Berliner Stadtschlosses 1950: Dieser Abschnitt detailliert den Prozess, der zum Abriss des Berliner Stadtschlosses führte. Obwohl Gutachten den Wiederaufbau als möglich erachteten, dominierten politische und ideologische Faktoren die Entscheidung. Der politische Opportunismus der SED-Führung wird anhand der unterschiedlichen Behandlung des östlichen und westlichen Teils des Schlosses deutlich gemacht. Die zunehmende Einflussnahme Walter Ulbrichts und die Orientierung an der sowjetischen Stadtplanung führten schließlich zur endgültigen Entscheidung gegen den Erhalt des Schlosses. Die beschlossenen Grundsätze des Städtebaus unterstreichen den Willen zur Gestaltung eines sozialistischen Stadtbildes, das mit der historischen Bausubstanz des Schlosses nicht vereinbar war.
Schlüsselwörter
Berliner Stadtschloss, Nationale Identität, Stadtplanung DDR, Sowjetische Besatzungszone, Wiedervereinigung, Abrisspolitik, Sozialistische Stadtgestaltung, Politische Symbolik, Geschichtsbewusstsein, Walter Ulbricht.
Häufig gestellte Fragen zum Essay: Der Abriss des Berliner Stadtschlosses
Was ist der Gegenstand des Essays?
Der Essay untersucht die Debatte um den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses nach dem Zweiten Weltkrieg und der Wende. Er analysiert die Argumente für und gegen den Wiederaufbau, insbesondere im Kontext der nationalen Identitätsstiftung und der sowjetisch beeinflussten Stadtplanung der DDR.
Welche Themen werden im Essay behandelt?
Der Essay behandelt die nationale Identitätsstiftung durch das Berliner Stadtschloss, die Rolle des Schlosses in der sowjetischen Stadtplanung, politischen Opportunismus und Propaganda in Bezug auf den Abriss, den Konflikt zwischen Geschichtsbewusstsein und sozialistischer Stadtplanung sowie die Zerstörung des Berliner Stadtschlosses im Kontext der Abrisspolitik nach 1945.
Welche Kapitel umfasst der Essay?
Der Essay gliedert sich in vier Kapitel: "Zur Nachwendediskussion: Nationale Identitätsstiftung des Berliner Schlosses", "Abrisswelle 1945 bis 1950", "Beseitigung des Doms oder des Berliner Schlosses?" und "Der Weg zum und die Gründe für den Abriss des Berliner Stadtschlosses 1950".
Was ist die Kernaussage des Kapitels "Zur Nachwendediskussion: Nationale Identitätsstiftung des Berliner Schlosses"?
Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung des Berliner Stadtschlosses als nationales Symbol in der Nachwendezeit und argumentiert, dass der Wiederaufbau als Mittel zur Schaffung einer gemeinsamen gesamtdeutschen Identität gesehen wurde. Zitate von Politikern unterstreichen die Hoffnung auf einen historischen Identifikationspunkt.
Worüber handelt das Kapitel "Abrisswelle 1945 bis 1950"?
Dieses Kapitel beschreibt die systematische Beseitigung von Erinnerungszeichen des Nationalsozialismus und des preußisch-deutschen Militarismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Die anfängliche Zurückhaltung der SMAD gegenüber dem Abriss von Denkmälern wird mit dem späteren Drängen der Politik kontrastiert. Das Berliner Schloss stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Fokus.
Was wird im Kapitel "Beseitigung des Doms oder des Berliner Schlosses?" erläutert?
Dieses Kapitel beleuchtet die Überlegungen zur Beseitigung des Berliner Doms oder des Schlosses zur Schaffung eines Aufmarschplatzes. Die Entscheidung für den Abriss des Schlosses anstatt des Doms wird als politisch motiviert dargestellt, um negative Reaktionen im Westen zu vermeiden.
Welche Informationen enthält das Kapitel "Der Weg zum und die Gründe für den Abriss des Berliner Stadtschlosses 1950"?
Dieses Kapitel detailliert den Prozess des Abrisses. Obwohl Gutachten den Wiederaufbau als möglich erachteten, dominierten politische und ideologische Faktoren die Entscheidung. Der politische Opportunismus der SED-Führung und die zunehmende Einflussnahme Walter Ulbrichts führten zur endgültigen Entscheidung gegen den Erhalt.
Welche Schlüsselwörter sind für den Essay relevant?
Schlüsselwörter sind: Berliner Stadtschloss, Nationale Identität, Stadtplanung DDR, Sowjetische Besatzungszone, Wiedervereinigung, Abrisspolitik, Sozialistische Stadtgestaltung, Politische Symbolik, Geschichtsbewusstsein, Walter Ulbricht.
Welche Schlussfolgerung lässt sich aus dem Essay ziehen?
Der Essay zeigt, dass die Entscheidung zum Abriss des Berliner Stadtschlosses nicht allein auf bautechnischen oder städteplanerischen Aspekten beruhte, sondern maßgeblich von politischen und ideologischen Faktoren der DDR-Führung geprägt war. Der Abriss steht im Kontext der sowjetischen Stadtplanung und des Strebens nach einem sozialistischen Stadtbild.
- Quote paper
- Marc Castillon (Author), 2007, Die Zerstörung nationalen Erbes: Das Berliner Stadtschloss, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115172