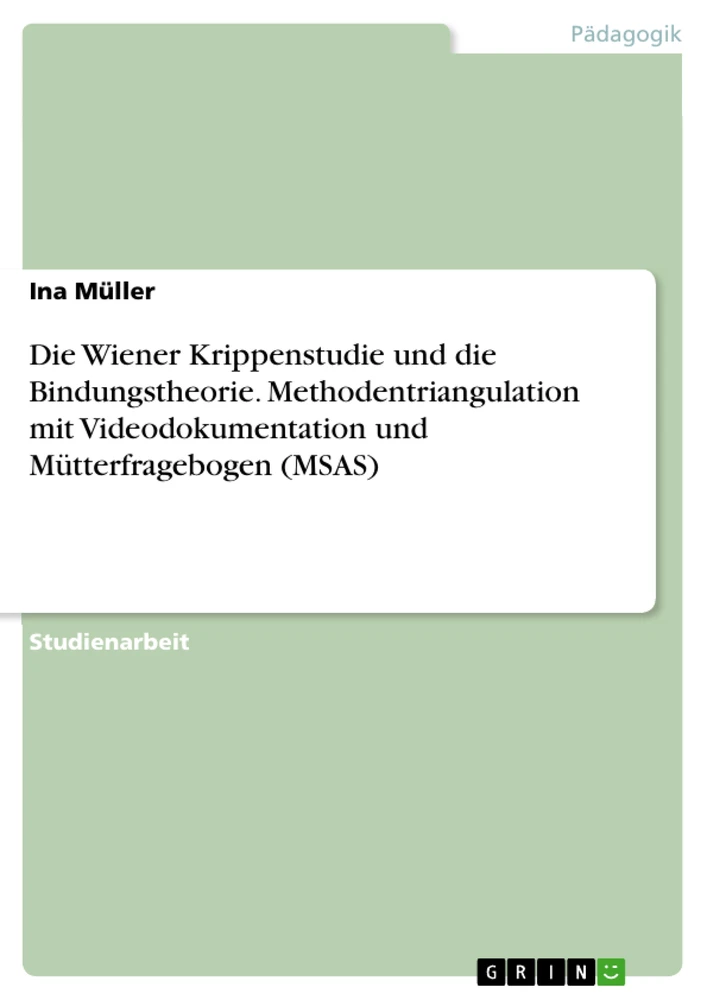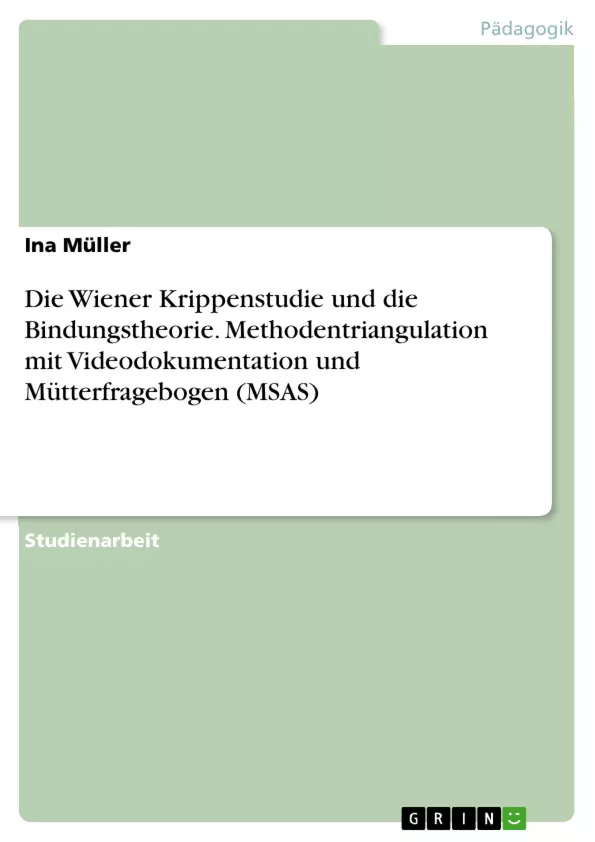Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Wiener-Krippenstudie mit Bezug auf die Bindungstheorie. Die gedankliche Herangehensweise dieser Hausarbeit möchte eine kindbezogene sein. Dabei bezieht sie sich maßgeblich auf die biologischen und psychologischen Zusammenhänge früher Trennungserfahrung von Kindern unter drei Jahren. Die soziologische, rein wirtschaftliche Sicht ist nicht Thema dieser Arbeit, sie soll daher, in ihrer Unabhängigkeit zu wirtschaftlichen Zusammenhängen, das Kind in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken und sucht allein Antworten auf die Vor- und Nachteile außerfamiliärer frühkindlicher Betreuung.
Der Säugling, als psychophysiologische Neugeburt, bringt ein evolutionär vorgegebenes Grundgerüst an Handlungs- und Überlebensstrategien mit in das Leben, welches ihn dazu befähigt, deutlich anzuzeigen, was er zum Überleben benötigt und was seine Entwicklung maßgeblich hemmt. Diese entwicklungsfördernden- oder hemmenden Signale zu erkennen, angemessen zu deuten und zu reagieren, das ist die Aufgabe der Person (-en), die dem kleinen Kind am nächsten stehen. Im Gegensatz zu anderen sozialwissenschaftlichen Themata befindet sich die Untersuchung des Einflusses auf die, vor allem sozial-emotionale Entwicklung des Kindes im Säuglings- und Kleinkindalter, noch nicht lange, unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit, im Fokus empirischer Erforschung.
Es kristallisieren sich zwei gesellschaftliche Fronten heraus, die der Befürworter, meist staatlicherseits und die der Gegner der frühkindlichen Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Je jünger das Kind, desto wichtiger ist eine verlässliche Bezugsperson, die es pflegt, ernährt, beschützt und berührt. Denn ein Kleinstkind hat noch kein Zeitgefühl und verbindet das allgemeine Unlustgefühl Hunger und dem Erscheinen eines bekannten Gesichts mit der Erfahrung der Bedürfnisbefriedigung und emotionalem Wohlbefinden. Daraus entsteht eine erste Bindung zu einem anderen Menschen, die für die Entwicklung jenes Urvertrauens wichtig ist, mit welchem ein Mensch später psychisch gesund durch die Welt kommen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bindungstheoretische Grundlagen – John Bowlby
- Die Wiener Krippenstudie
- Methodenvielfalt der Studie
- Videodokumentation
- Mütterfragebogen (MSAS)
- Bewertung der angewandten Methoden
- Stressoren im Kleinkindalter
- Krippenreife
- Ergebnisse der Studie- ein Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen außerfamiliärer frühkindlicher Betreuung auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern unter drei Jahren, insbesondere im Hinblick auf die Bindungstheorie. Die Arbeit konzentriert sich auf die kindbezogene Perspektive und analysiert Vor- und Nachteile der Krippenbetreuung, ohne den wirtschaftlichen Aspekt im Vordergrund zu stellen.
- Auswirkungen außerfamiliärer Betreuung auf die Bindungsentwicklung
- Relevanz der Bindungstheorie für die frühkindliche Entwicklung
- Analyse der Methoden der Wiener Krippenstudie
- Identifizierung von Stressoren im Kleinkindalter im Krippenkontext
- Der Begriff der Krippenreife
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der frühkindlichen Betreuung und deren Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern unter drei Jahren ein. Sie betont die Bedeutung einer verlässlichen Bezugsperson für die Bindungsentwicklung und das Urvertrauen des Kindes. Die Arbeit fokussiert auf die biologischen und psychologischen Zusammenhänge früher Trennungserfahrungen und vermeidet eine rein sozioökonomische Betrachtungsweise. Der evolutionäre Aspekt der Bindung und die Bedeutung der Bedürfnisbefriedigung für die Entwicklung werden hervorgehoben. Die Einleitung stellt die Forschungslücke bezüglich des Einflusses frühkindlicher Betreuung auf die sozial-emotionale Entwicklung heraus und erwähnt die gegensätzlichen gesellschaftlichen Positionen zu diesem Thema.
Bindungstheoretische Grundlagen – John Bowlby: Dieses Kapitel beschreibt die Bindungstheorie nach John Bowlby. Es erläutert das biologisch festgelegte Bindungsverhaltenssystem des Kindes als Reaktion auf Stressoren wie Müdigkeit, Hunger, Schmerzen, unbekannte Umgebungen und Trennung von der Bezugsperson. Der Aufbau der Bindung in den ersten Lebensjahren wird als genetisch vorprogrammiert beschrieben, mit weitreichenden Folgen für die spätere Beziehungsfähigkeit. Das Kapitel behandelt die Entwicklung des Kindes, von der anfänglichen Unaustauschbarkeit der Bindung bis zur zunehmenden Fähigkeit, weitere Beziehungen aufzubauen. Der Zusammenhang zwischen Bindungssicherheit und Explorationsverhalten wird ebenfalls thematisiert, sowie die Rolle des "inneren Arbeitsmodells" und dessen Verbindung zu kognitiven Fähigkeiten wie der Objektpermanenz.
Die Wiener Krippenstudie: Dieses Kapitel beschreibt die Wiener Krippenstudie und ihre Methodenvielfalt. Es geht detailliert auf die angewandten Methoden wie Videodokumentationen und den Mütterfragebogen (MSAS) ein, wobei die Stärken und Schwächen der Methodik bewertet werden. Der Fokus liegt auf der Erfassung von Stressoren im Kleinkindalter im Krippenkontext und der Frage nach der Krippenreife. Der Abschnitt synthetisiert die Ergebnisse der verschiedenen methodischen Ansätze, um ein umfassendes Bild der Studie zu geben. Wichtige Aspekte werden beleuchtet, wie die Interpretation der Daten und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen über die Entwicklung von Kindern in Krippen.
Schlüsselwörter
Bindungstheorie, Bowlby, frühkindliche Entwicklung, außerfamiliäre Betreuung, Wiener Krippenstudie, Stressoren, Krippenreife, sozial-emotionale Entwicklung, Bindungsverhalten, Urvertrauen, Explorationsverhalten.
Häufig gestellte Fragen zur Wiener Krippenstudie
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Auswirkungen außerfamiliärer frühkindlicher Betreuung auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern unter drei Jahren, insbesondere im Hinblick auf die Bindungstheorie. Der Fokus liegt auf der kindbezogenen Perspektive und analysiert Vor- und Nachteile der Krippenbetreuung, ohne den wirtschaftlichen Aspekt zu priorisieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Auswirkungen außerfamiliärer Betreuung auf die Bindungsentwicklung, die Relevanz der Bindungstheorie für die frühkindliche Entwicklung, eine Analyse der Methoden der Wiener Krippenstudie, die Identifizierung von Stressoren im Kleinkindalter im Krippenkontext und den Begriff der Krippenreife.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den bindungstheoretischen Grundlagen nach John Bowlby, ein Kapitel zur Wiener Krippenstudie mit detaillierter Methodenbeschreibung und Ergebniszusammenfassung, und abschließend ein Literaturverzeichnis.
Wie wird die Bindungstheorie nach Bowlby dargestellt?
Das Kapitel zur Bindungstheorie erläutert Bowlbys Konzept des biologisch festgelegten Bindungsverhaltenssystems des Kindes als Reaktion auf Stressoren. Es beschreibt den Aufbau der Bindung in den ersten Lebensjahren, die Entwicklung vom anfänglichen unaustauschbaren Bindungsverhältnis zur Fähigkeit, weitere Beziehungen aufzubauen, den Zusammenhang zwischen Bindungssicherheit und Explorationsverhalten, sowie die Rolle des "inneren Arbeitsmodells".
Wie wird die Wiener Krippenstudie beschrieben?
Das Kapitel zur Wiener Krippenstudie beschreibt die Methodenvielfalt der Studie, detailliert die angewandten Methoden (Videodokumentationen und Mütterfragebogen (MSAS)), bewertet deren Stärken und Schwächen, fokussiert auf die Erfassung von Stressoren im Krippenkontext und die Frage der Krippenreife. Es synthetisiert die Ergebnisse der verschiedenen methodischen Ansätze, um ein umfassendes Bild der Studie zu geben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bindungstheorie, Bowlby, frühkindliche Entwicklung, außerfamiliäre Betreuung, Wiener Krippenstudie, Stressoren, Krippenreife, sozial-emotionale Entwicklung, Bindungsverhalten, Urvertrauen, Explorationsverhalten.
Welche Forschungslücke wird adressiert?
Die Arbeit adressiert die Forschungslücke bezüglich des Einflusses frühkindlicher Betreuung auf die sozial-emotionale Entwicklung und die gegensätzlichen gesellschaftlichen Positionen zu diesem Thema.
Welche Perspektive wird eingenommen?
Die Arbeit nimmt eine kindbezogene Perspektive ein und vermeidet eine rein sozioökonomische Betrachtungsweise. Der evolutionäre Aspekt der Bindung und die Bedeutung der Bedürfnisbefriedigung für die Entwicklung werden hervorgehoben.
- Arbeit zitieren
- Ina Müller (Autor:in), 2021, Die Wiener Krippenstudie und die Bindungstheorie. Methodentriangulation mit Videodokumentation und Mütterfragebogen (MSAS), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1151729