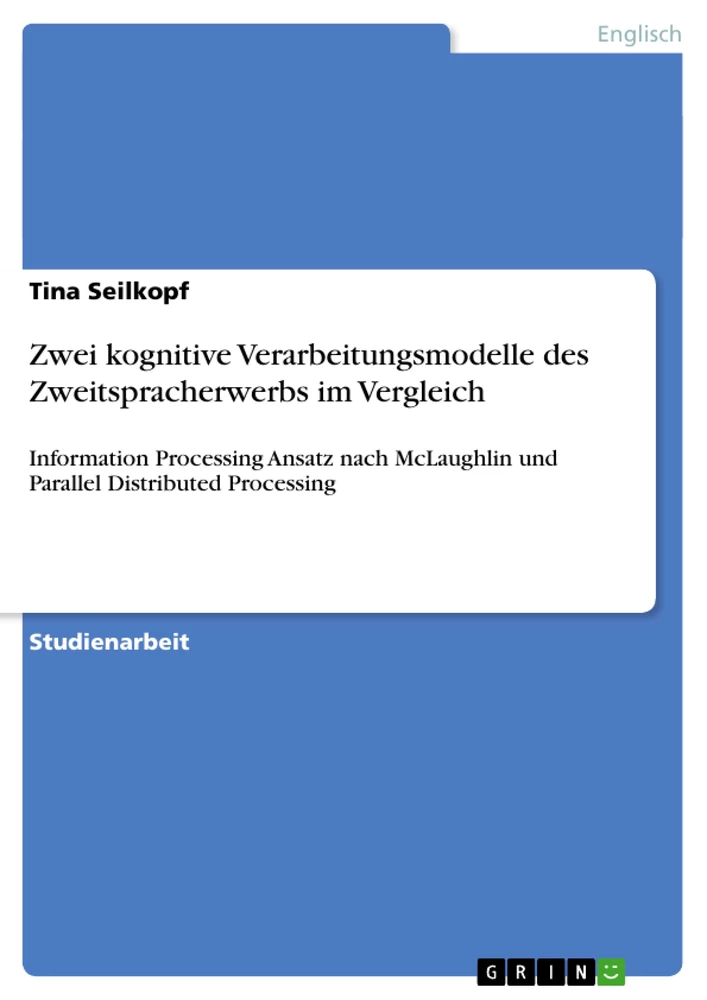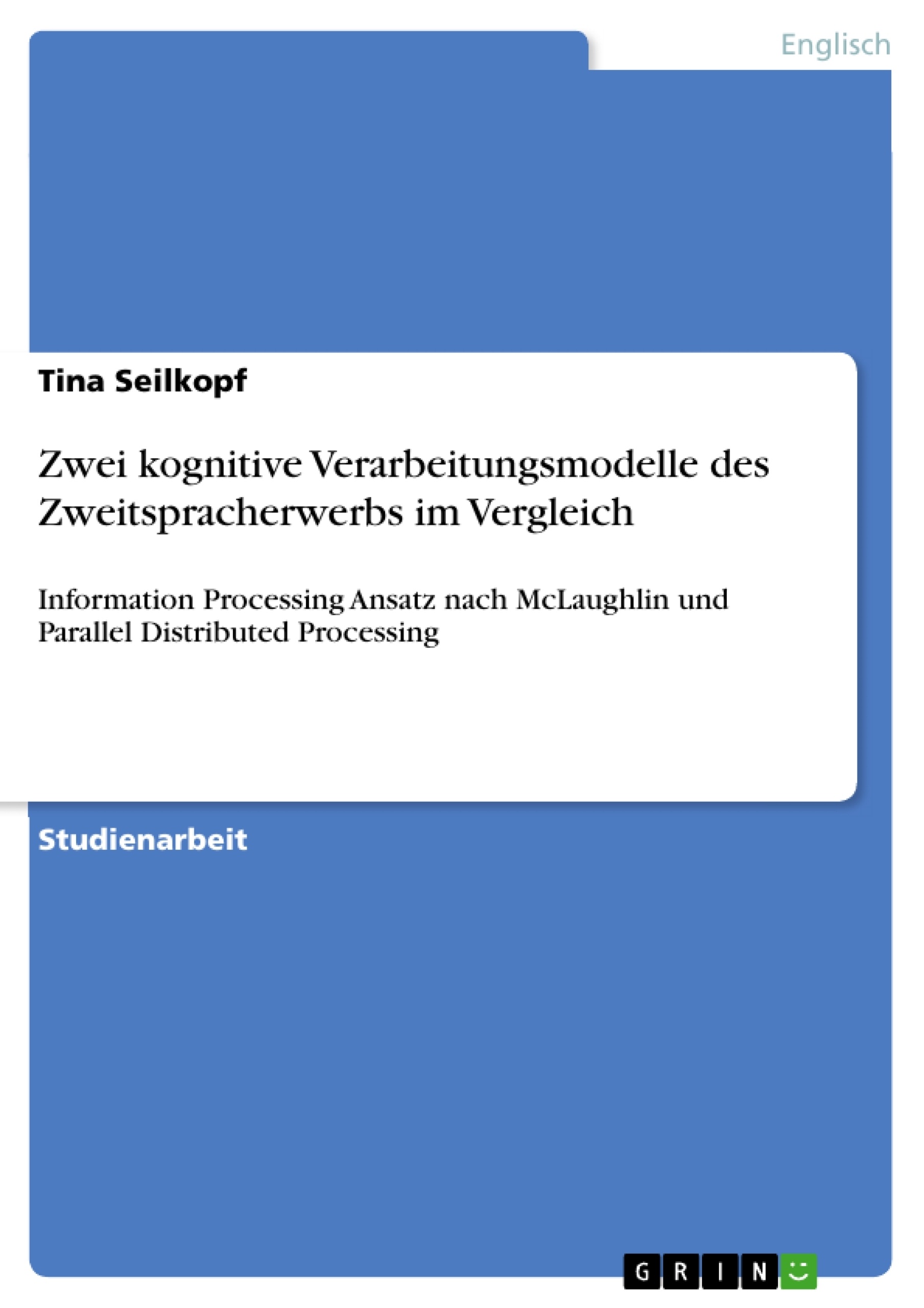Bis heute gibt es keine Theorie des Zweitspracherwerbs, die umfassend alle Bereiche beschreiben und beim Erwerb auftretende Phänomene erklären kann. Meist bieten die verschiedenen Ansätze lediglich punktuell für einzelne Bereiche wie zum Beispiel zum Verhältnis von Erst- und Zweitsprache Erklärungen an.
In dieser Arbeit soll Zweitspracherwerb auf kognitiver Ebene betrachtet werden. Mit den Worten der Behavioristen wird also versucht, das Innere der black box zu betrachten, um zu klären, wie Zweitsprache gelernt wird. Dazu sollen zwei Theorien näher betrachtet werden die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Beide Ansätze betrachten das menschliche Gehirn als eine Art Computer, der Informationen verarbeitet. Dennoch vertreten beide doch deutlich voneinander abweichende Vorstellungen, wie diese Verarbeitung im Zusammenhang mit Spracherwerb abläuft. Das erste kognitive Verarbeitungsmodell geht dabei grundsätzlich von serieller, das zweite Modell von paralleler Verarbeitung aus. Im Folgenden sollen nun beide Theorien vergleichend betrachtet werden, um daraus Rückschlüsse auf ihre Bedeutung für den Zweitspracherwerb zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Zwei kognitive Verarbeitungsmodelle des Zweitspracherwerbs
2. Der Information Processing Ansatz nach McLaughlin
2.1 Aufmerksamkeit
2.2 Von kontrollierter zu automatisierter Verarbeitung
2.3 Hierarchie
2.4 Reorganisation
2.5 Schlussfolgerungen für den Zweitspracherwerb
3. Parallel Distributed processing nach McClelland, Rumelhart und Hinton
3.1 Impulse zwischen Einheiten
3.2 Parallele Verarbeitung
3.3 Repräsentation von Wissen
3.4 Lernen
3.5 Lernen ohne Regeln
3.6 Schlussfolgerungen für den Zweitspracherwerb
4. Vergleich beider Modelle
5. Zusammenfassung
Quellenverzeichnis
Einleitung
Bis heute gibt es keine Theorie des Zweitspracherwerbs, die umfassend alle Bereiche beschreiben und beim Erwerb auftretende Phänomene erklären kann. Meist bieten die verschiedenen Ansätze lediglich punktuell für einzelne Bereiche wie zum Beispiel zum Verhältnis von Erst- und Zweitsprache Erklärungen an.
In dieser Arbeit soll Zweitspracherwerb auf kognitiver Ebene betrachtet werden. Mit den Worten der Behavioristen wird also versucht, das Innere der black box zu betrachten, um zu klären, wie Zweitsprache gelernt wird. Dazu sollen zwei Theorien näher betrachtet werden die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben.
Beide Ansätze betrachten das menschliche Gehirn als eine Art Computer, der Informationen verarbeitet. Dennoch vertreten beide doch deutlich voneinander abweichende Vorstellungen, wie diese Verarbeitung im Zusammenhang mit Spracherwerb abläuft. Das erste kognitive Verarbeitungsmodell geht dabei grundsätzlich von serieller, das zweite Modell von paralleler Verarbeitung aus.
Im Folgenden sollen nun beide Theorien vergleichend betrachtet werden, um daraus Rückschlüsse auf ihre Bedeutung für den Zweitspracherwerb zu ziehen.
1. Zwei kognitive Verarbeitungsmodelle des Zweitspracherwerbs
Der Begriff „Zweitspracherwerb“ (ZSE) wird in dieser Arbeit ähnlich des Begriffs „Second Language Acquisition“ im Englischen verwendet. Er gilt sowohl für den Prozess als auch für die Forschung über Zweitspracherwerb. Im ZSE werden im Wesentlichen zwei verschiedene kognitive Verarbeitungsprozesse beschrieben: Zum einen serielle Verarbeitungsmodelle, wie beispielsweise das „Information Processsing Modell“ nach McLaughlin. Diese Modelle basieren auf der Vorstellung, dass das Gehirn Informationen nacheinander verarbeitet und während des Spracherwerbsprozesses eine Stufe nach der anderen erreicht wird. Dabei ist die Erreichung der nächsten Stufe erst möglich, wenn die vorherige erfolgreich gemeistert wurde.
Neben den seriellen gibt es zum anderen auch parallele Verarbeitungsprozesse. Dazu gehört beispielsweise das „Parallel Distributed Processing Modell“. Bei ihm wird davon ausgegangen, dass der Spracherwerb durch die gleichzeitige Verarbeitung von Informationen erfolgt, wobei Entwicklungsstufen übersprungen oder ausgelassen werden können. Hierbei wird entgegen den meisten Auffassungen nicht davon ausgegangen, dass Zweitspracherwerb immer regelgeleitet ist.
Bei beiden Modellarten handelt es sich jedoch um Ansätze, die versuchen, die allgemeine Informationsverarbeitung während des Zweitspracherwerbs des Menschen näher zu erklären. Es geht also darum, wie aus kognitiver Perspektive eine Zweitsprache gelernt wird. Charakteristisch ist dabei, dass solche Konzepte zumeist von Psychologen oder Neurologen entwickelt und erst im Nachhinein auf Fragestellungen des Zweitspracherwerbs angewendet wurden.
Grundlage beider Theorien ist die Annahme, dass der Prozess des Zweitspracherwerbs dem allgemeinen Prozess „lernen“ gleichzusetzen ist. Eine Zweitsprache ist demnach eine Fähigkeit, die wie jede andere gelernt werden kann. Das heißt, dass Zweitspracherwerb wie jeder andere Erwerb von Fähigkeiten erfolgt, beispielsweise das Auto fahren. Ellis betitelt diese Modelle mit der Überschrift „Skill learning models of second language acquisition“ (Ellis 1996: 388) aufgrund der Anwendbarkeit auf jegliches Lernen.
Ebenfalls gemeinsam haben beide Ansätze die Betrachtung des Menschen als einen Prozessor mit einer beschränkten Verarbeitungskapazität. Ellis sowie auch McLaughlin oder McClelland, Rumelhart und Hinton sind sich in diesem Zusammenhang darin einig, dass „Learners are limited in how much information they are able to process by both the nature of the task and their own information-processing ability“ (Ellis 1996: 390). Häufig wird deshalb das menschliche Gehirn als eine Art Computer mit beschränktem Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher betrachtet. Diese Analogie ist der Grund, weshalb Verarbeitungsmodelle auch unter der Überschrift „computational model“ oder „processing“ zu finden sind.
2. Der Information Processing Ansatz nach McLaughlin
Die Grundannahme des Ansatzes ist, dass Sprache ein regelgeleitetes System ist, das im Langzeitgedächtnis des Lerners als Interlanguage-System repräsentiert wird. Nach dem Information Processing (IP) Ansatz nach McLaughlin weist der Zweitspracherwerb einige charakteristische Merkmale auf:
- Aufmerksamkeit
- Automatisierung
- Hierarchische/Serielle Verarbeitung
- Reorganisation
Diese werden nun im Folgenden genauer besprochen und erläutert.
2.1 Aufmerksamkeit
Ein Lerner kann nur Informationen weiterverarbeiten, die er zuvor aufgenommen hat. Da der Mensch aber hier als Prozessor mit begrenzter Verarbeitungskapazität betrachtet wird, ist er auch im Hinblick auf die Aufnahmen der ihm dargebotenen Informationen begrenzt. Niemand kann demnach alle Informationen aufnehmen, die ihm in Form von Input dargeboten werden. Voraussetzung für die Aufnahme bzw. den Intake von Informationen ist, dass der Lerner aufmerksam ist. Einige Informationen werden mit größerer Aufmerksamkeit wahrgenommen als andere. Das wird im Allgemeinen als Selektive Wahrnehmung bezeichnet wird.
Weiterhin spielt Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit der Automatisierung von Prozessen eine Rolle. Ein neuer Prozess bzw. ein neuer Teil einer Fähigkeit die erlernt wird, nimmt viel Aufmerksamkeit des Lerners in Anspruch. McLaughlin nennt diese Form der Verarbeitung, die bewusst vom Lerner gesteuert werden muss, „Controlled Processing“ (McLaughlin, 1993). Dass sowohl Verarbeitungskapazität als auch die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen begrenzt sind, wird deutlich, wenn der Lerner beginnt, neue Fähigkeiten auszubilden. Ein Beispiel dafür ist das Buchstabieren von Wörtern. Hat der Lerner zuvor die Aussprache der Buchstaben des Alphabets kennengelernt, so wird er beim Buchstabieren einen Großteil seiner Aufmerksamkeit darauf richten, die einzelnen Buchstaben richtig auszusprechen. Dementsprechend langsam wird der Lerner buchstabieren. Ziel ist nun, den Verarbeitungsprozess effizienter zu gestalten, um Kapazitäten für die nächsten Schritte im Lernprozess frei zu setzen.
Aufmerksamkeit kann jedoch auch Interferenzen verursachen, wenn sie auf bereits automatisierte Abläufe gelenkt wird. McLaughlin beschreibt dies wie folgt: „When the learner direkts attention to speech, controlled processes come into play and performance is likely to be interfered with“ (1993:139). So kann die Kommunikation in der Zielsprache erheblich erschwert werden, wenn der Lerner über jedes Wort nachdenkt, das er sagen will. Und das, obwohl er die entsprechenden Prozesse bereits automatisiert hat.
Dieser Umstand lässt sich damit erklären, dass sich automatisierte und kontrollierte Verarbeitung überschneiden und dadurch Fehler verursachen können. Ähnlich verhält es sich beispielsweise beim Autofahren: Sobald sich jemand, der bereits seit Jahren Auto fährt, darauf konzentriert, wie und wann er welches Fußpedal bedienen muss, wird er unsicher. Dadurch macht er eventuell Fehler, die er nicht gemacht hätte, wenn er gefahren wäre ohne darüber nachzudenken.
2.2 Von kontrollierter zu automatisierter Verarbeitung
Nach McLaughlin ist die Automatisierung von Prozessen notwendig, damit sich der Lerner weiterentwickeln kann. Ist ein Prozess automatisiert, so muss der Lerner nur noch wenig oder gar keine Aufmerksamkeit mehr aufbringen um ihn durchzuführen. Diese Form der Verarbeitung nennt McLaughlin „Automatic Processing“. Die zu erlernende Fähigkeit wird dazu in kleinere Einheiten von Unterfähigkeiten zerlegt, da wie bereits erwähnt die Verarbeitungskapazität sowie Aufmerksamkeitsspanne des Menschen begrenzt ist. Die untergeordneten Fähigkeiten müssen der Reihe nach erlernt und automatisiert werden, wobei die Automatisierung einer niedrigeren Entwicklungsstufe die Voraussetzung für die Erreichung der nächst höheren Stufe darstellt.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text?
Der Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die sich mit kognitiven Verarbeitungsmodellen des Zweitspracherwerbs auseinandersetzt. Er vergleicht zwei Modelle: den Information Processing Ansatz nach McLaughlin und das Parallel Distributed Processing Modell nach McClelland, Rumelhart und Hinton.
Was sind die Hauptziele des Textes?
Das Ziel ist, den Zweitspracherwerb auf kognitiver Ebene zu betrachten und zu untersuchen, wie Zweitsprache gelernt wird. Dazu werden zwei Theorien vorgestellt und verglichen, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben.
Welche beiden kognitiven Verarbeitungsmodelle werden im Text verglichen?
Der Text vergleicht den Information Processing Ansatz nach McLaughlin, der von serieller Verarbeitung ausgeht, und das Parallel Distributed Processing Modell nach McClelland, Rumelhart und Hinton, das von paralleler Verarbeitung ausgeht.
Was sind die Kernpunkte des Information Processing Ansatzes nach McLaughlin?
Der Information Processing Ansatz betont die Bedeutung von Aufmerksamkeit, Automatisierung, hierarchischer Verarbeitung und Reorganisation beim Zweitspracherwerb. Die Automatisierung von Prozessen ist notwendig, damit sich der Lerner weiterentwickeln kann. Bevor Prozesse automatisiert sind, müssen sie bewusst und mit viel Aufmerksamkeit durchgeführt werden. Durch Übung und Wiederholung wird so bei der Darbietung eines bestimmten Reizes automatisch eine entsprechende Reaktion abgerufen.
Was versteht McLaughlin unter "Controlled Processing" und "Automatic Processing"?
McLaughlin bezeichnet die Form der Verarbeitung, die bewusst vom Lerner gesteuert werden muss, als "Controlled Processing". "Automatic Processing" beschreibt Prozesse, die ohne viel Aufmerksamkeit ablaufen, nachdem sie durch Übung automatisiert wurden.
Was sind die wesentlichen Merkmale des Parallel Distributed Processing Modells?
Obwohl das Parallel Distributed Processing Modell nicht so detailliert im vorliegenden Text beschrieben wird, wird es als ein Modell dargestellt, das von der gleichzeitigen Verarbeitung von Informationen ausgeht und Entwicklungsstufen überspringen oder auslassen kann. Es geht entgegen der meisten Auffassungen nicht davon aus, dass Zweitspracherwerb immer regelgeleitet ist.
Was bedeutet "Zweitspracherwerb" (ZSE) im Kontext des Textes?
Der Begriff "Zweitspracherwerb" wird ähnlich des Begriffs "Second Language Acquisition" im Englischen verwendet und bezieht sich sowohl auf den Prozess als auch auf die Forschung über den Erwerb einer Zweitsprache.
Inwiefern wird das menschliche Gehirn im Text mit einem Computer verglichen?
Das menschliche Gehirn wird als ein Prozessor mit beschränkter Verarbeitungskapazität betrachtet, ähnlich einem Computer mit beschränktem Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher. Dies ist die Grundlage für die Verarbeitungsmodelle.
Was ist die Bedeutung von Aufmerksamkeit im Information Processing Ansatz?
Aufmerksamkeit ist entscheidend, da Lerner nur Informationen verarbeiten können, die sie zuvor aufgenommen haben. Da die Verarbeitungskapazität begrenzt ist, ist selektive Wahrnehmung notwendig. Aufmerksamkeit spielt auch eine Rolle bei der Automatisierung von Prozessen.
Warum ist die Automatisierung von Prozessen wichtig nach McLaughlin?
Die Automatisierung von Prozessen ist notwendig, damit der Lerner sich weiterentwickeln kann, da automatisierte Prozesse weniger Aufmerksamkeit erfordern und Kapazitäten für neue Lernschritte freisetzen.
- Quote paper
- Tina Seilkopf (Author), 2007, Zwei kognitive Verarbeitungsmodelle des Zweitspracherwerbs im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115173