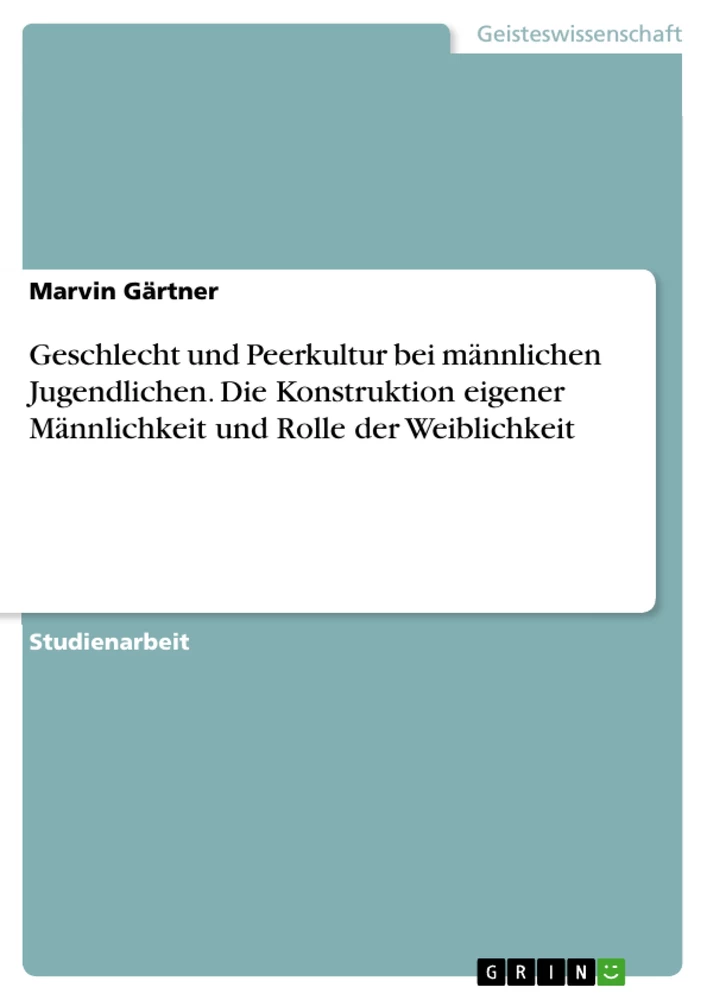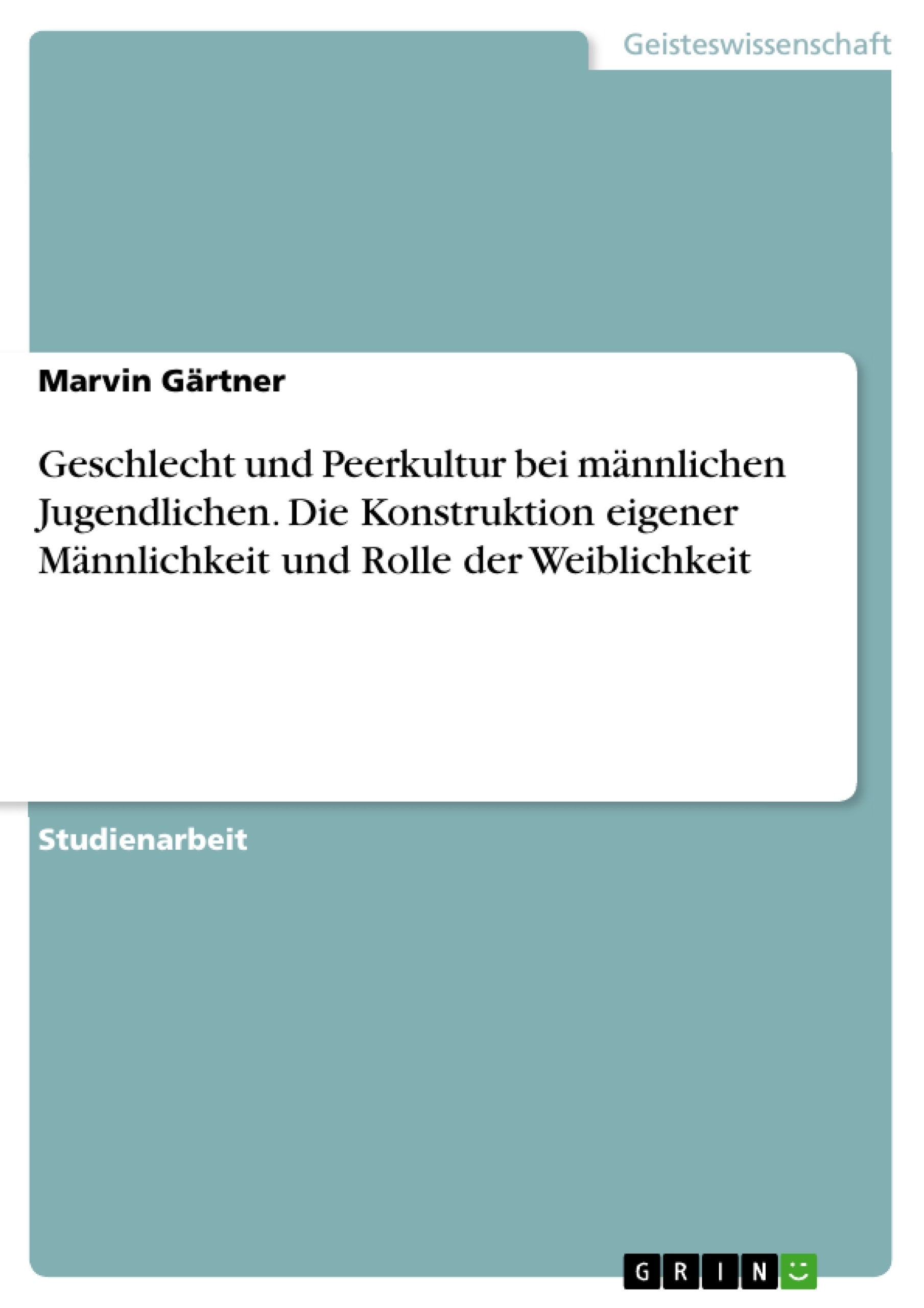Diese Arbeit betrachtet die Dynamiken in Gruppen männlicher Jugendliche mit einem geschlechtsspezifischen Fokus darauf, wie die eigene Männlichkeit konstruiert wird und welche Rolle Weiblichkeit in diesem Prozess spielt. Männlichkeit ist immer wieder und immer öfter Thema in öffentlichen Diskursen. Insgesamt stellt sich die Frage, welche Bedeutung die Ablehnung, sowie Abwertung, von Weiblichkeit in der Konstruktion eigener Männlichkeit in geschlechtshomogenen Peergroups bei Jugendlichen hat. Zur Beantwortung der Frage muss zuerst grundsätzlich geklärt werden, in welchem Zusammenhang Geschlecht und Peer-Kultur stehen und wie beides in diesem Kontext zu verstehen ist.
Danach steht die Behandlung der obigen Frage im Zentrum, die sich einerseits als Frage nach der Funktion innerhalb der Konstruktion und andererseits als Frage nach dem Telos der Abwertung von Weiblichkeit behandeln lässt. Beide Aspekte müssen betrachtet werden, um die Frage der Arbeit vollständig beantworten zu können. Methodologisch muss schließlich noch gesagt werden, dass in dieser Arbeit keine eigene empirische Untersuchung unternommen wurde, sondern die theoretische Konzeption von Männlichkeit betrachtet wird, unter der Zuhilfenahme schon existierenden und durchgeführten empirischen Befragungen und Analysen.
Vor allem in der gegenwärtigen Me-too-Debatte geistert das Schlagwort toxic masculinity umher. Ein anderer Aspekt, der auch unter diesem Begriff diskutiert wird, ist die Abwertung und Ablehnung von Weiblichkeit bei und von Männern. In den Gender Studies wird dieses Phänomen auch unter den Begriffen Transmisogyny und Femmephobia verhandelt. Auf der Suche nach dem Ursprung dieses Phänomen muss ein Blick in die Konstruktion von Männlichkeit an sich geworfen werden – vor allem zum Zeitpunkt der Kindheit und Jugend, wenn sich die männliche Geschlechtsidentität formt. In der Forschung von Michael Meuser stand dabei vor allem die selbstgefährdende Körperkultur von Jungen im Zentrum. Jedoch spricht er nebenher auch von der Abwertung von Weiblichkeit innerhalb dieses Prozesses an. Das Phänomen bedarf also weiterer Untersuchung.
Inhaltsverzeichnis
- Männlichkeit heute
- Geschlecht und Peerkultur
- Geschlecht als Projekt
- Peers und Peer-Groups
- Konstruktion von Männlichkeit
- Männlichkeit(en)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Ablehnung und Abwertung von Weiblichkeit bei der Konstruktion männlicher Identität in geschlechtshomogenen Jugendgruppen. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen Geschlecht, Peerkultur und der Herausbildung männlicher Geschlechtsidentität. Die Arbeit stützt sich auf bestehende Forschung und theoretische Konzepte.
- Konstruktion von Männlichkeit in der Jugend
- Der Einfluss von Peergroups auf die Geschlechtsidentitätsentwicklung
- Die Abwertung von Weiblichkeit als Mechanismus der Männlichkeitskonstruktion
- Das Konzept von „toxic masculinity“ und seine Manifestationen
- Geschlecht als soziales Konstrukt
Zusammenfassung der Kapitel
Männlichkeit heute: Der Text beginnt mit einer Einführung in die aktuelle Debatte um Männlichkeit, insbesondere im Kontext der #MeToo-Bewegung und dem Begriff "toxic masculinity". Es wird auf die Abwertung von Weiblichkeit durch Männer eingegangen, ein Phänomen, das in den Gender Studies unter den Begriffen Transmisogyny und Femmephobia diskutiert wird. Die Arbeit stellt die Frage nach der Bedeutung der Ablehnung und Abwertung von Weiblichkeit bei der Konstruktion männlicher Identität in Jugendgruppen und kündigt den methodologischen Ansatz an: eine theoretische Betrachtung bestehender empirischer Forschung.
Geschlecht und Peerkultur: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Peerkultur in der Jugend. Es wird betont, dass die Jugendphase einen Übergang zum Erwachsensein darstellt, in dem Jugendliche in Bezug auf Sexualität und Geschlechtsidentität die geschützten Räume der Kindheit verlassen. Die Peergroup wird als Kontrollinstanz sozialer Praktiken beschrieben, in der Jugendliche ihr Verhalten und ihre Ausdrucksweisen auf ihre gesellschaftliche Angemessenheit bezüglich Alter, Geschlecht und anderer Kategorien beurteilen. Es folgt eine genauere Betrachtung der Begriffe "Geschlecht" und "Peer-Group", wobei Geschlecht als soziales Konstrukt verstanden wird, welches durch Handlungen und Praktiken innerhalb eines heterosexuellen Rahmens konstituiert wird. Die Peergroup wird als der Ort identifiziert, an dem die gemeinsame Konstruktion männlicher Geschlechtsidentität stattfindet.
Konstruktion von Männlichkeit: Dieses Kapitel analysiert empirische Untersuchungen zur Konstruktion von Männlichkeit bei Jugendlichen. Es werden die vier Elemente des normativen Leitbildes für Männlichkeit nach Deborah David und Robert Brannon vorgestellt, wobei "No Sissy Stuff" im Zentrum der Analyse steht. Die Ablehnung von Weiblichkeit in männlichen Peergroups wird als ein Mechanismus beschrieben, um die eigene Männlichkeit zu konstruieren und andere, als nicht-männlich markierte Jugendliche, auszuschließen. Es werden Beispiele aus empirischen Studien genannt, die zeigen, wie die Verbindung von Eigenschaften wie Sportlichkeit mit Männlichkeit dazu führt, dass Jugendliche, die diese Eigenschaften nicht aufweisen, als feminin bezeichnet und ausgegrenzt werden. Der Ausschluss von Weiblichkeit dient somit der Konstruktion und Stärkung der eigenen Männlichkeit innerhalb der Gruppe.
Schlüsselwörter
Männlichkeit, Weiblichkeit, Peergroup, Jugend, Geschlechtsidentität, soziale Konstruktion, toxic masculinity, Transmisogyny, Femmephobia, Geschlechterrollen, Ausschluss, Mobbing, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Konstruktion männlicher Identität in geschlechtshomogenen Jugendgruppen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Ablehnung und Abwertung von Weiblichkeit bei der Konstruktion männlicher Identität in geschlechtshomogenen Jugendgruppen. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen Geschlecht, Peerkultur und der Herausbildung männlicher Geschlechtsidentität, basierend auf bestehender Forschung und theoretischen Konzepten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Konstruktion von Männlichkeit in der Jugend, den Einfluss von Peergroups auf die Geschlechtsidentitätsentwicklung, die Abwertung von Weiblichkeit als Mechanismus der Männlichkeitskonstruktion, das Konzept von „toxic masculinity“ und seine Manifestationen sowie Geschlecht als soziales Konstrukt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu „Männlichkeit heute“, „Geschlecht und Peerkultur“, „Konstruktion von Männlichkeit“ und „Fazit“. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik, beginnend mit einer Einführung in die aktuelle Debatte um Männlichkeit und der Bedeutung von Begriffen wie Transmisogyny und Femmephobia, über die Analyse des Zusammenhangs zwischen Geschlecht und Peerkultur bis hin zur detaillierten Betrachtung der Mechanismen der Männlichkeitskonstruktion in Jugendgruppen.
Wie wird Männlichkeit in dieser Arbeit konstruiert?
Die Arbeit analysiert die Konstruktion von Männlichkeit anhand empirischer Forschung. Dabei wird insbesondere das Modell der vier Elemente des normativen Leitbildes für Männlichkeit nach Deborah David und Robert Brannon herangezogen, mit dem Schwerpunkt auf "No Sissy Stuff". Die Ablehnung von Weiblichkeit wird als zentraler Mechanismus dargestellt, um die eigene Männlichkeit zu konstruieren und andere auszuschließen.
Welche Rolle spielt die Peerkultur?
Die Peerkultur wird als entscheidende Einflussgröße auf die Geschlechtsidentitätsentwicklung in der Jugend beschrieben. Die Peergroup fungiert als Kontrollinstanz, in der Jugendliche ihr Verhalten und ihre Ausdrucksweisen auf ihre gesellschaftliche Angemessenheit bezüglich Alter, Geschlecht und anderer Kategorien prüfen. Die gemeinsame Konstruktion männlicher Geschlechtsidentität findet in der Peergroup statt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe der Arbeit sind Männlichkeit, Weiblichkeit, Peergroup, Jugend, Geschlechtsidentität, soziale Konstruktion, toxic masculinity, Transmisogyny, Femmephobia, Geschlechterrollen, Ausschluss und Mobbing.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine theoretische Betrachtung bestehender empirischer Forschung, um die Rolle der Ablehnung und Abwertung von Weiblichkeit bei der Konstruktion männlicher Identität zu untersuchen.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Der HTML-Auszug enthält kein Fazit. Diese Frage kann erst nach dem Lesen des vollständigen Textes beantwortet werden.)
- Citation du texte
- Marvin Gärtner (Auteur), 2019, Geschlecht und Peerkultur bei männlichen Jugendlichen. Die Konstruktion eigener Männlichkeit und Rolle der Weiblichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1151765