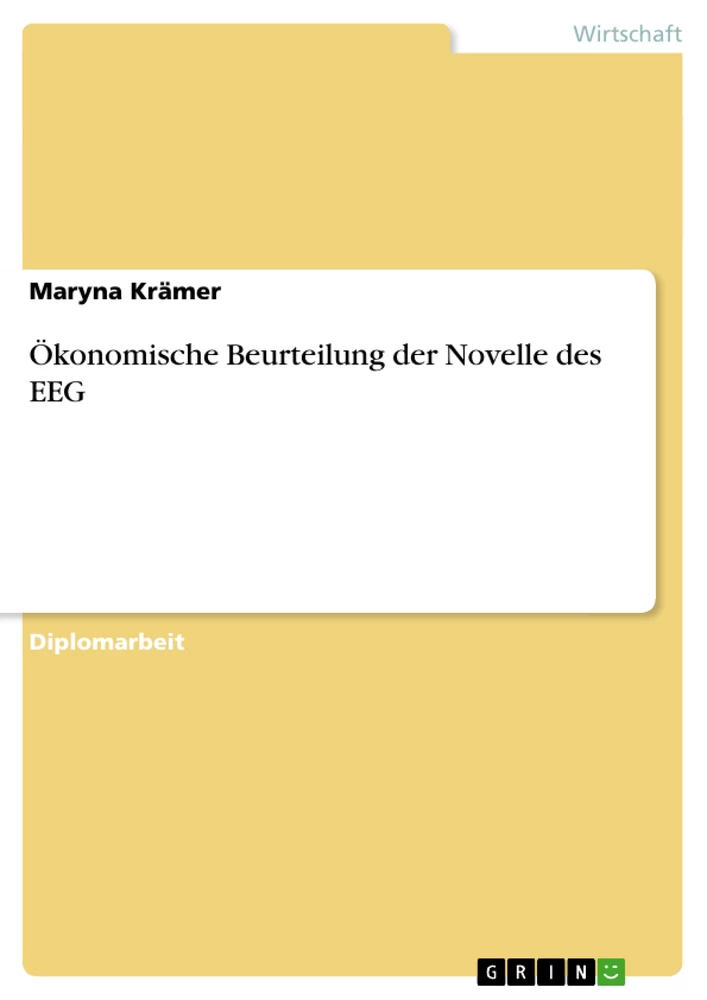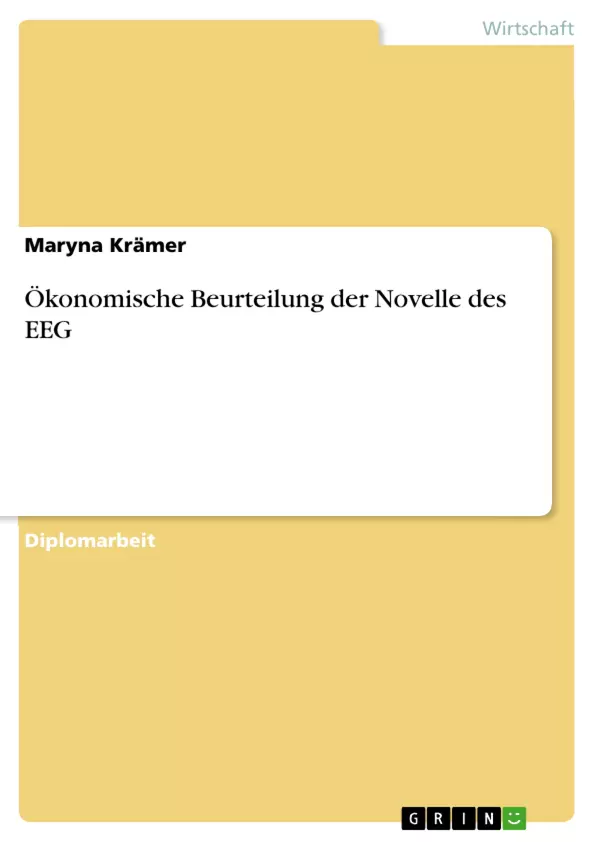In Artikel 20a des Grundgesetzes heißt es: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen …“ .
Nachhaltige Energieversorgung ist eines der wichtigen Ziele der Politik. Auch zukünftige Energieversorgung sollte unter Berücksichtigung ökologischer Ziele und gleichzeitigen wirtschaftlichen Wachstums realisiert werden. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 1. April 2000 hat die Bundesregierung ein wirksames Instrument für den Ausbau Erneuerbarer Energien (EE) und damit sowohl für nachhaltige Energieversorgung als auch für mehr Klimaschutz geschaffen. Dies steht im Einklang mit dem Richtziel der Europäischen Union (EU) und dem Kyoto-Protokoll .
Der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten EU-Energieverbrauch soll sich bis 2010 auf 12 % verdoppeln, der EE-Anteil an der Stromproduktion der gesamten EU soll von knapp 14 % im Jahr 1997 auf rund 22 % im Jahr 2010 steigen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind in der Richtlinie 2001/77/EG für alle EU-Mitgliedsstaaten individuelle Richtziele festgelegt, je nach Stand der technischen Entwicklung und den damals aktuellen Anteilen der erneuerbaren Energie. Das Richtziel für Deutschland lag bei einer Steigerung von rund 6,25 % im Jahr 2000 auf 12,5 % bis 2010.
Die Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes am 01.04.2000 hat zu einem deutlichen Aufschwung der stromerzeugenden Technologien zur Nutzung der regenerativen Energiequellen in Deutschland geführt. Der Anteil der EE am gesamten Stromverbrauch in Deutschland ist von 6,3 % im Jahr 2000 auf rund 11,6 % im Jahr 2007 gestiegen. Die EEG-Ausbauziele sind schon im Jahr 2007 überschritten worden. Der EE-Anteil am Bruttostromverbrauch wurde für 2007 mit 13 % Grenze prognostiziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
- Ziele, Grundsätze und Anwendungsbereiche
- Klimaprogramm und Versorgungssicherheit
- Die EEG-Regelungen im Einzelnen
- Abnahme- und Übertragungspflicht
- Vergütungen und Vergütungsdauer
- Degression der Vergütungssätze
- Zusätzliche Vergütungen (Boni)
- Ausgleichsmechanismus
- Ergänzende Regelungen
- Kosten des EEG
- Der Subventionsbegriff des EEG
- Novelle des EEG
- Erneuerbare Energien und deren Vergütungssätze 2004-2009
- Allgemeine Vergütungsbestimmungen
- Vergütung für Strom aus Deponiegas, Klärgas und Grubengas
- Vergütung für Strom aus Wasserkraft
- Vergütung für Strom aus Biomasse (ohne Deponie- und Klärgas)
- Vergütung für Strom aus Geothermie (Erdwärme)
- Vergütung für Strom aus Windenergie
- Windenergie Repowering
- Offshore-Windkraft
- Vergütung für Strom aus solarer Strahlungsenergie
- Erzeugungsmanagement – Einspeisemanagement
- Eigenvermarktung vs. Direktvermarktung
- Vorgesehene gesetzliche Regelung nach EEG und ihre Begründung
- Alternative Vorschläge und Stellungnahme der Industrie
- Wälzungsmechanismus des EEG
- Gültiger Mechanismus
- Grundlagen und die Notwendigkeit des Mechanismus
- Darstellung des Wälzungsmechanismus
- Bestimmung der Umlage nach EEG
- Besondere Ausgleichsregelung
- Alternativer Wälzungsmechanismus
- Ausgangssituation
- Alternativer EEG-Wälzungsmechanismus nach Vorschlag des Verbandes Kommunaler Unternehmen
- Ziel und Vorgehensweise des alternativen Wälzungsmechanismus
- Vorteile dieses veränderten Wälzungsmechanismus
- Wirkungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes von 2000 bis 2006
- Was ist besser – Förderung durch das EEG oder andere Fördermodelle?
- Bewertung der Förderung erneuerbarer Energien durch das EEG
- Alternative Fördermodelle regenerativer Stromerzeugung
- Ökonomische Wirkungen
- Umsatzentwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland
- Erneuerbare Energien als Beschäftigungsmotor
- Erneuerbare Energien als Exportschlager
- Differenzkosten des EEG (2000-2006) und die Auswirkungen auf die Endverbraucher
- Ökologische Wirkungen. Der Beitrag der EEG zum Klima- und Naturschutz
- Zukünftige Auswirkungen des EEG
- Entwicklungen der EEG-Vergütungszahlungen ab 2009
- Differenzkostenentwicklung nach dem EEG ab 2009
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der ökonomischen Beurteilung der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) aus dem Jahr 2004. Ziel ist es, die Auswirkungen der Gesetzesänderung auf die Förderung erneuerbarer Energien, die Kosten des EEG und die Auswirkungen auf die Endverbraucher zu analysieren.
- Die Entwicklung der Vergütungssätze für erneuerbare Energien
- Der Wälzungsmechanismus des EEG und seine Auswirkungen
- Die ökonomischen und ökologischen Wirkungen des EEG
- Zukünftige Entwicklungen des EEG und die Auswirkungen auf die Energieversorgung
- Alternative Fördermodelle für erneuerbare Energien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und erläutert die Ziele, Grundsätze und Anwendungsbereiche des Gesetzes. Anschließend werden die EEG-Regelungen im Einzelnen betrachtet, einschließlich der Abnahme- und Übertragungspflicht, der Vergütungen und der Degression der Vergütungssätze. Die Kosten des EEG und der Subventionsbegriff werden ebenfalls diskutiert.
Im dritten Kapitel wird die Novelle des EEG aus dem Jahr 2004 analysiert. Die Änderungen der Vergütungssätze für verschiedene erneuerbare Energiequellen werden detailliert dargestellt, sowie die neuen Regelungen zum Erzeugungsmanagement und zur Eigenvermarktung.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Wälzungsmechanismus des EEG. Der gültige Mechanismus wird erläutert, einschließlich der Grundlagen, der Darstellung des Wälzungsmechanismus und der Bestimmung der Umlage. Ein alternativer Wälzungsmechanismus wird ebenfalls vorgestellt.
Kapitel 5 untersucht die Wirkungen des EEG von 2000 bis 2006. Die ökonomischen und ökologischen Wirkungen werden analysiert, einschließlich der Umsatzentwicklung der erneuerbaren Energien, der Beschäftigungseffekte und der Differenzkosten des EEG.
Das sechste Kapitel befasst sich mit den zukünftigen Auswirkungen des EEG. Die Entwicklungen der EEG-Vergütungszahlungen und die Differenzkostenentwicklung ab 2009 werden prognostiziert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), die Förderung erneuerbarer Energien, die Vergütungssätze, den Wälzungsmechanismus, die ökonomischen und ökologischen Wirkungen, die Differenzkosten, die Energieversorgung und alternative Fördermodelle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)?
Das EEG zielt darauf ab, den Ausbau regenerativer Energiequellen zu fördern, um Klimaschutzziele zu erreichen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.
Was änderte die EEG-Novelle 2004?
Die Novelle passte die Vergütungssätze für verschiedene Technologien (wie Wind, Solar, Biomasse) an, führte neue Boni ein und optimierte den Ausgleichsmechanismus für die Kostenverteilung.
Wie funktioniert der Wälzungsmechanismus?
Der Mechanismus stellt sicher, dass die Mehrkosten für die Förderung erneuerbarer Energien gleichmäßig auf alle Stromverbraucher über die EEG-Umlage verteilt werden.
Was sind Differenzkosten im EEG?
Differenzkosten sind der Unterschied zwischen der festen Einspeisevergütung für Ökostrom und dem tatsächlichen Marktpreis für konventionellen Strom an der Börse.
Welche ökonomischen Wirkungen hat das EEG?
Es fungiert als Beschäftigungsmotor in der Umwelttechnologie-Branche, fördert Innovationen und macht Deutschland zu einem führenden Exporteur für grüne Technologien.
- Arbeit zitieren
- Maryna Krämer (Autor:in), 2008, Ökonomische Beurteilung der Novelle des EEG, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115177