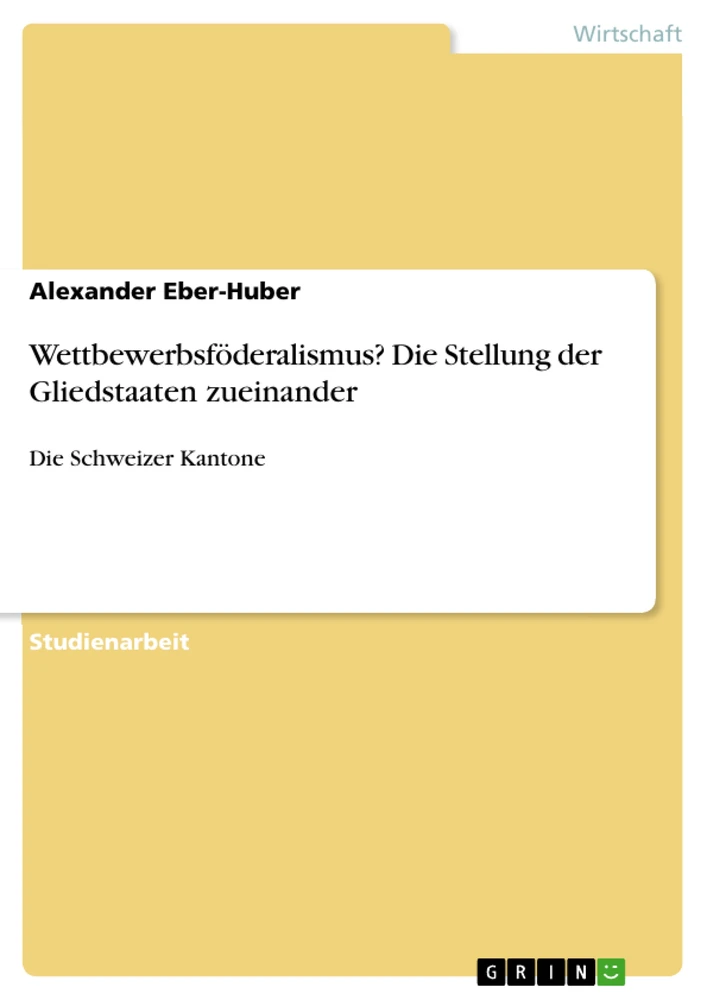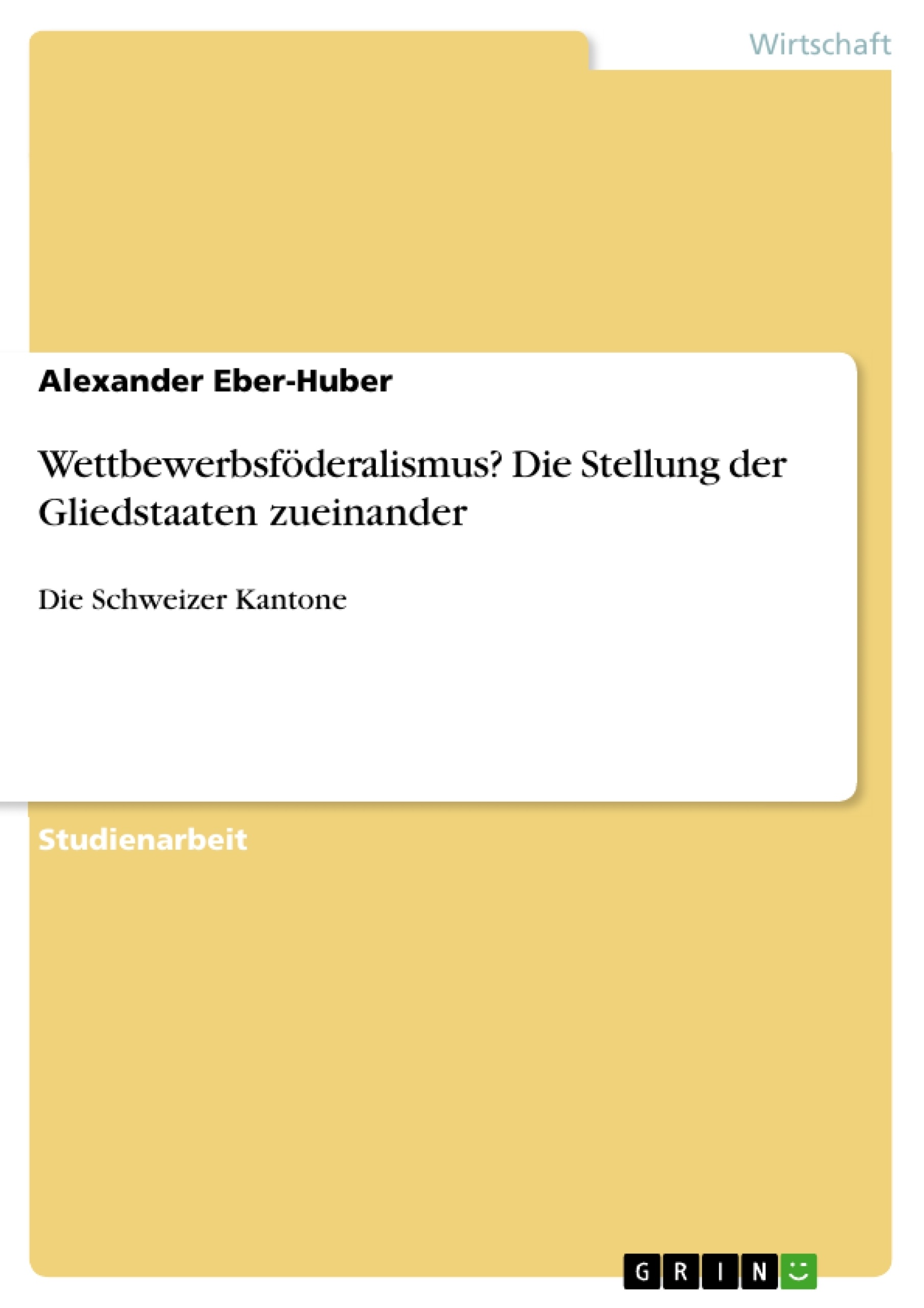Die vorliegende Arbeit soll im Rahmen des Blockseminars „Reformen der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern“ in Deutschland einen Blick auf den Nachbarn Schweiz werfen. Die Schweiz - im Gegensatz zu Deutschland sehr vom Wettbewerbs- Föderalismus geprägt – gilt weithin als Muster-Föderalstaat. Sie hat es geschafft bis heute nicht zum Zentralismus zu verfallen. Bestrebungen des Bundes mehr Macht an sich zu reißen, wurden, wie diese Arbeit zeigen wird, durch die Neuregelung des Schweizerischen Finanzausgleichs zum Jahr 2008 eingedämmt.
Gliederung
1 Einleitung
2 Theoretische Argumente zum Föderalismus
2.1 Präferenzheterogenität
2.2 Das Tiebout-Modell
2.3 Das Dezentralisierungstheorem
2.4 Externalitäten
2.5 Umverteilung über ein Steuer Transfer-System und regionale Konvergenz
2.6 Polit-ökonomische Argumente
3 Föderales System in der Schweiz
3.1 Schweizer Geschichte und Institutionen
3.2 Das schweizerische System heute
3.2.1 Aufgaben und Gesetzgebung – Steuereinnahmen und Ausgaben des Bundes
3.2.2 Aufgaben und Gesetzgebung – Steuereinnahmen und Ausgaben der Kantone
3.3 Fiskalischer Wettbewerb der Schweizer Kantone
3.4 Finanzausgleich in der Schweiz: Bund und Kantone
3.4.1 Allgemeine Einnahmensituation der Schweizer Kantone vor der Nivellierung des Finanzausgleichs
3.4.2 Der neue Schweizer Finanzausgleich (NFA)
4 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Anlage 1: Abkürzungen der Kantonsnamen der Schweiz
1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit soll im Rahmen des Blockseminars „Reformen der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern“ in Deutschland einen Blick auf den Nachbarn Schweiz werfen. Die Schweiz - im Gegensatz zu Deutschland sehr vom Wettbewerbs- Föderalismus geprägt – gilt weithin als Muster-Föderalstaat. Sie hat es geschafft bis heute nicht zum Zentralismus zu verfallen. Bestrebungen des Bundes mehr Macht an sich zu reißen, wurden, wie diese Arbeit zeigen wird, durch die Neuregelung des Schweizerischen Finanzausgleichs zum Jahr 2008 eingedämmt.
Zu Beginn meiner Arbeit werde ich sowohl auf die positiven als auch auf die negativen Argumente für und gegen Föderalismus eingehen und dabei meinen Schwerpunkt zunächst auf die theoretischen Aspekte legen (Abschnitt 2). Hierbei werde ich zunächst die Präferenzheterogenität (Abschnitt 2.1) herausarbeiten und dann folgend das Tiebout-Modell darstellen (Abschnitt 2.2). Davon ausgehend werde ich das Dezentralisierungstheorem (Abschnitt 2.3) von Oates und die Erweiterung von Blankert erläutern um dann schließlich auf die durch den Föderalismus hervorgerufenen Externalitätenprobleme (Abschnitt 2.4) einzugehen. Abschließend werde ich auf die Umverteilungsproblematik im föderalen System herausarbeiten und auf die regionale Konvergenz (Abschnitt 2.5) eingehen, bevor ich die polit-ökonomischen Argumente für den Föderalismus (Abschnitt 2.6) erörtere.
In Abschnitt 3 folgt eine Beschreibung des „System Schweiz“. Der geschichtliche Hintergrund bildet dabei den Einsteg (Abschnitt 3.1) Davon ausgehend werde ich näher auf die Aufgabenverteilung und die Einnahmen-/Ausgabenseite des Schweizerischen Bundes (Abschnitt 3.2.1) und der Kantone (Abschnitt 3.2.2) eingehen. Abschnitt 3.3. „Fiskalischer Wettbewerb der Schweizer Kantone“ wird darlegen, dass der fiskalische Wettbewerb zwischen den Kantonen nicht zu einem „race to the bottom“1 führt. Abschnitt 3.4 beschreibt den Finanzausgleich in der Schweiz. Ich beginne mit einer Analyse der Einnahmen und Ausgabensituation der Schweizer Kantone vor dem Jahr 2008 (Abschnitt 3.4.1). Meine Betrachtung endet in der Analyse der Nivellierung des Schweizerischen Finanzausgleichs zum 01.01.2008 (Abschnitt 3.4.2). Im gesamten Abschnitt 3 werde ich immer wieder Bezüge zu den bereits dargelegten theoretischen Ansätzen aus Abschnitt 2 herstellen, um so anhand der Schweizerischen Praxis Parallelen zu den verschiedenen Föderalismustheorien aufzeigen zu können.
In Abschnitt 4 folgen abschließende Bemerkungen und eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit, sowie eine Bewertung der Nivellierung des Schweiz- erischen Finanzausgleichs.
2 Theoretische Argumente zum Föderalismus
2.1 Präferenzheterogenität
Wenn man davon ausgeht, dass die Präferenzen der einzelnen Individuen in einer Gebietskörperschaft heterogen sind, kommt man zu dem Schluss, dass das Angebot der öffentlichen Güter immer den Präferenzen des Medianwählers entsprechen muss. Je homogener die Präferenzen sind, desto effizienter kann daher eine Gebietskörperschaft auf die Präferenzen der Inländer eingehen. Dies vermeidet Wohlfahrtsverluste und spricht somit für einen ausgeprägten Föderalismus, welcher bei Annahme von ausgeprägter Heterogenität allerdings in einer 1-Mann-Gebietskörperschaft gipfeln würde, was allerdings im Gegensatz zu der Annahme von positiven Skalenerträgen stehen würde. Es ]muss also ein gesundes Mittelmaß bei der Wahl der Größe der Gebietskörperschaft gewählt werden, um Effizienz zu gewährleisten (Isele 2001).
2.2 Das Tiebout-Modell
Das Tiebout-Modell (Tiebout 1956) analysiert das Verhalten der Steuerzahler. Es geht davon aus, dass es mehrere Gebietskörperschaften (am Beispiel Schweiz: Kantone) gibt, welche im Steuerwettbewerb zueinander stehen. Die unterschiedlichen Gebietskörperschaften setzten unterschiedliche Steuern fest und stellen im Gegenzug unterschiedliche Arten von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen für ihre Einwohner bereit. Vorausgesetzt, dass die Faktoren Arbeit und Kapital vollständig mobil sind, wählen sie bei vollständigen Informationen2 über Höhe der Steuer und Art der bereitgestellten Güter diejenige Region aus, welche für sie das optimale Paket an öffentlichen Gütern und Dienstleitungen anbietet. Die fiskalische Äquivalenz3 nach Olsen (1969) wäre auf diese Weise erfüllt. Es kommt zu voting by feet; ineffizient bereitstellende Regionen würden folglich von den Einwohnern gemieden werden. Unterschiedliche Steuersätze werden somit dadurch begründet, dass demgegenüber auch unterschiedliche öffentliche Leitungen stehen.
Allerdings steht und fällt die Tiebout-Analyse (1) mit der Annahme vollständiger Mobilität, welche in der Realität zumindest kurz- und mittelfristig nicht vereinbar ist (Schildknecht 2002) und (2) durch die Hinzunahme von Externalitäten, welche ebenso der fiskalischen Äquivalenz-Annahme gegenüberstehen (Feld 2002).
2.3 Das Dezentralisierungstheorem
Setzt man einen zutreffenden Tiebout-Modell-Zustand voraus, so gilt das Olsonsche Korrespondenzprinzip (auch: Äquivalenzprinzip) (Olson 1969), welches besagt, dass die- jenigen, welche die von der Gebietskörperschaft bereitgestellten Güter bezahlen, auch die Empfänger der öffentlichen Güter sind. Das Dezentralisierungstheorem von Oates (1972) greift diese Annahme auf und kommt so zu dem Schluss, dass eine dezentrale Bereitstellung und Finanzierung auf der kleinst möglichen Ebene erfolgen soll.
Blankert (1991) erweitert das Modell von Oates. Er nimmt als Akteure in das Korrespondenz- Prinzip noch die Entscheidungsbefugten über die Ausgaben mit hinein und schafft somit gedanklich eine in sich geschlossene Modellwelt. Diese Modellwelt ermöglicht es, dass die zur Verfügung gestellten Leitungen der Gebietskörperschaft den Präferenzen der Inländer genau entsprechen.
Hinzu kommt, dass dezentrale Regierungen durch Informationsvorteile die Frustrationskosten der Bürger minimieren. Durch Migrationsprozesse sortieren sich die Individuen nach ihren persönlichen Präferenzen in die einzelnen Gebietskörperschaften ein (Feld 2004a).
2.4 Externalitäten
Fiskalische Externalitäten (Wanderungsexternalitäten) und Skalenerträge im Konsum. Die Zuwanderung in eine Gebietskörperschaft hat immer 2 Seiten. Zum einen verringern sich die Kosten durch die Zuwanderung auf den Einzelnen gesehen in der Zuwander-Gebiets- körperschaft, zum anderen erhöhen sich die Kosten für die Zurückgebliebenen in der Abwander-Region. Dies geschieht aufgrund von positiven Skalenerträgen4 bei Nichtrivalität der öffentlich angebotenen Güter. Werden diese nicht bei den Entscheidungen über öffentliche Güter berücksichtigt, so führt dies zu fiskalisch externen Effekten (Feld 2000).
Externalitäten (Nutzenspillovers). Es gibt zwei Arten von Externalitäten. Zum einen die räumlichen Externalitäten, die sich in positive und negative räumliche Externalitäten gliedern lassen. Negativ wäre zum Beispiel der Bau einer Mülldeponie in einem nicht besiedelten Teil einer Gebietskörperschaft, welche aber an ein besiedeltes Gebiet des Nachbarn grenzt. Bei positiven räumlichen Externalitäten handelt es sich beispielsweise um den Bau eines Schwimmbads durch eine Gebietskörperschaft. Dieser Bau wird durch die Steuerzahlungen der Inländer finanziert und im laufenden Betrieb bezuschusst. Allerdings können auch die Bewohner der Nachbar-Region das Schwimmbad nutzen, sie erfahren dadurch einen positiven Nutzen ohne für diesen zahlen zu müssen. Diese Problematik nennt man auch Stadt-Umland- oder Speckgürtel-Problematik (Bogner 2004). Eine Kompensation der fiskalischen Externalitäten könnte durch Steuerexport5 erfolgen (Noiset 2003).
2.5 Umverteilung über ein Steuer Transfer-System und regionale Konvergenz
Umverteilung über ein Steuer Transfer System. Eine Umverteilung über ein Steuer Transfer System in einem föderalistischen System ist mit großen Problemen behaftet. Wie im Tiebout- Modell dargelegt, werden die Individuen mit einem niedrigeren Einkommen gemäß ihren Präferenzen in die Gebietskörperschaft wandern, die ein hohes Maß an öffentlichen Gütern bzw. hohe Sozial-Leistungen bereitstellt. Diejenigen, die relativ hohe Einkommen beziehen, und somit Netto-Zahler sind, werden in eine Region wechseln, in der Sie entweder Netto- Leistungs-Empfänger sind oder in der die öffentlichen Leistungen bzw. Sozial-Leistungen niedriger sind, womit dann auch die Steuerbelastung niedriger ist. Es wird also so lange gewandert, bis wir homogene Gebietskörperschaften vorfinden: nur Arme und nur Reiche (bei angenommenen zwei Gebietskörperschaften). Eine Finanzierung der öffentlichen Güter bzw. Sozialleistung und somit auch die Umverteilung wäre nun durch das voting by feet des Tiebout-Modells nicht mehr möglich (Feld 2004b).
R egionale Konvergenz6 ist daher ohne einen Finanzausgleich (vertikal oder horizontal) nicht mehr möglich (Feld 2002), wobei die Autoren Feld, Zimmermann und Doring (2003) auch aufzeigen, dass Rand-Regionen ohne gute Infrastruktur oft als einziges Attraktivitätskriterium einen niedrigeren Steuersatz vorweisen können, welcher ihnen einen Zuzug von Unternehmen und Individuen aus attraktiven Stadt-Regionen gewährleistet. Somit rechtfertigen Standortvorteile höhere Steuern (Baldwin und Krugmann 2002).
[...]
1 „race to the bottom“ meint das sich gegenseitige Unterbieten bei der Steuersatzwahl bis hin zur Null- Besteuerung
2 vollständige Interformation = Alle (Markt-)Teilnehmer sind vollständige über sämtliche Angebote informiert.
3 fiskalische Äquivalenz = Steuerzahlungen in einer Region entsprechen den öffentlichen Leistungen in dieser.
4 Das bedeutet, dass ein zusätzlicher Nutzer die Durchschnittskosten für alle senkt, somit die Grenzkosten sinken, bei einer Abwanderung steigen die Kosten jedoch für den Einzelnen.
5 Gemeint ist, dass die Firmen, welche sich in einer Gebietskörperschaft ansiedeln, nur zu geringem Teil den in den dort wohnenden Individuen gehören, die Inländer daher ineffizient hohe Staatsausgaben zu tätigen, da diese ja vom Gewinn der in „Ausländer-Hand“ befindlichen Firmen in Form von höheren Steuern bezahlt werden müssen. Diese können dagegen nichts unternehmen, da Sie Outsider sind, somit keinen Einfluss auf die Steuerpolitik der Gebietskörperschaft haben. (Huizinga und Nielsen 1997)
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit dem Föderalismus, insbesondere mit dem Schweizer Föderalismus, und vergleicht diesen mit dem deutschen System. Sie untersucht die theoretischen Argumente für und gegen Föderalismus, beschreibt das schweizerische System und analysiert den fiskalischen Wettbewerb und den Finanzausgleich in der Schweiz.
Welche theoretischen Argumente für Föderalismus werden diskutiert?
Die Arbeit behandelt die Präferenzheterogenität, das Tiebout-Modell, das Dezentralisierungstheorem von Oates und Blankert, Externalitäten (fiskalische Externalitäten und Nutzen-Spillovers) sowie die Umverteilungsproblematik und regionale Konvergenz.
Was ist Präferenzheterogenität im Zusammenhang mit Föderalismus?
Präferenzheterogenität bezieht sich auf die unterschiedlichen Präferenzen der Individuen in einer Gebietskörperschaft. Je homogener die Präferenzen, desto effizienter kann die Gebietskörperschaft auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen. Allerdings sollte die Größe der Gebietskörperschaft so gewählt werden, dass ein gesundes Mittelmaß zwischen Homogenität und Skalenerträgen besteht.
Was besagt das Tiebout-Modell?
Das Tiebout-Modell analysiert das Verhalten der Steuerzahler, die zwischen verschiedenen Gebietskörperschaften mit unterschiedlichen Steuern und öffentlichen Gütern wählen. Bei vollständiger Mobilität und Informationen wählen die Steuerzahler die Region mit dem optimalen Paket an öffentlichen Gütern und Dienstleistungen.
Was ist das Dezentralisierungstheorem?
Das Dezentralisierungstheorem besagt, dass öffentliche Güter und Dienstleistungen auf der kleinstmöglichen Ebene bereitgestellt und finanziert werden sollen, um die Präferenzen der Bürger bestmöglich zu berücksichtigen.
Welche Externalitäten werden im Zusammenhang mit Föderalismus erwähnt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen fiskalischen Externalitäten (Wanderungsexternalitäten) und Nutzen-Spillovers (räumliche Externalitäten). Wanderungsexternalitäten entstehen durch Zuwanderung in eine Gebietskörperschaft, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben kann. Nutzen-Spillovers beziehen sich auf den Nutzen, den Bürger einer Nachbarregion aus öffentlichen Gütern einer anderen Gebietskörperschaft ziehen, ohne dafür zu bezahlen (Stadt-Umland-Problematik).
Was ist das Problem der Umverteilung im föderalen System?
Die Umverteilung über ein Steuer-Transfer-System in einem föderalen System kann dazu führen, dass Individuen mit niedrigerem Einkommen in Regionen mit hohen Sozialleistungen wandern, während Individuen mit hohem Einkommen in Regionen mit niedrigeren Steuern ziehen. Dies kann zu homogenen Gebietskörperschaften führen (nur Arme oder nur Reiche) und die Finanzierung öffentlicher Güter erschweren.
Was bedeutet regionale Konvergenz?
Regionale Konvergenz bezeichnet die Angleichung der Verhältnisse in den verschiedenen Regionen. Ohne Finanzausgleich (vertikal oder horizontal) ist eine regionale Konvergenz oft nicht möglich.
Wie ist das schweizerische System aufgebaut?
Die Arbeit beschreibt die Aufgabenverteilung und die Einnahmen-/Ausgabenseite des Schweizerischen Bundes und der Kantone. Sie analysiert den fiskalischen Wettbewerb zwischen den Kantonen und den Finanzausgleich in der Schweiz vor und nach der Nivellierung im Jahr 2008.
Was wird unter fiskalischem Wettbewerb der Schweizer Kantone verstanden?
Fiskalischer Wettbewerb bezieht sich auf den Wettbewerb zwischen den Kantonen um Steuerzahler und Unternehmen durch unterschiedliche Steuersätze und öffentliche Leistungen. Die Arbeit argumentiert, dass der fiskalische Wettbewerb in der Schweiz nicht zu einem "race to the bottom" führt.
Was ist der neue Schweizer Finanzausgleich (NFA)?
Der neue Schweizer Finanzausgleich (NFA) ist ein System zur Nivellierung der finanziellen Unterschiede zwischen den Kantonen. Die Arbeit analysiert die Einnahmensituation der Schweizer Kantone vor dem NFA und die Auswirkungen der Nivellierung nach dem 01.01.2008.
- Arbeit zitieren
- Alexander Eber-Huber (Autor:in), 2008, Wettbewerbsföderalismus? Die Stellung der Gliedstaaten zueinander, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115214