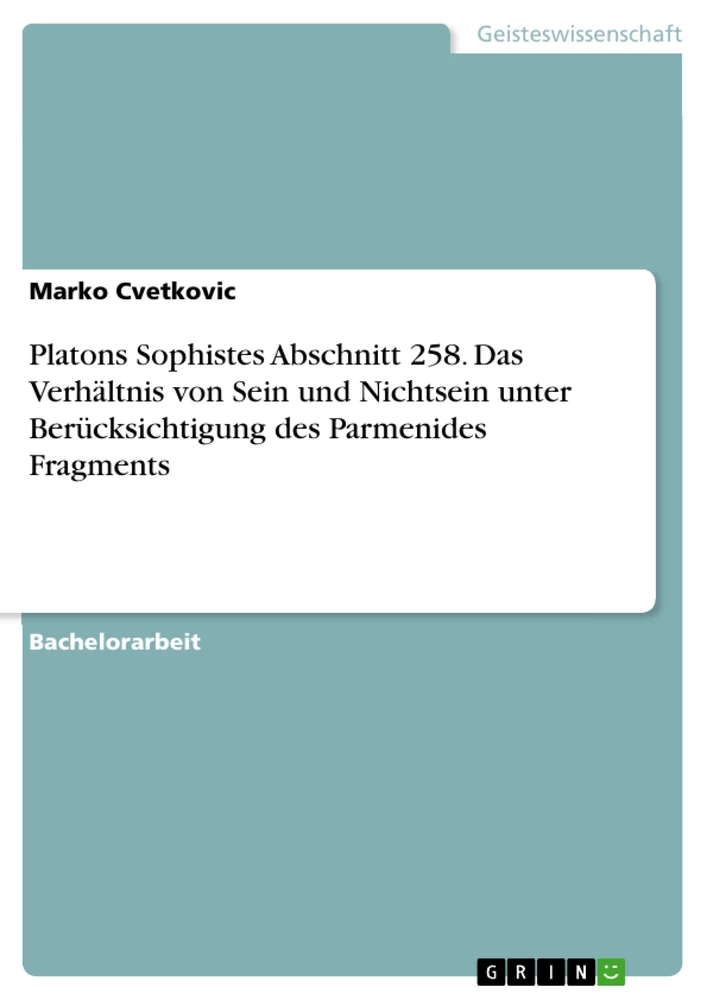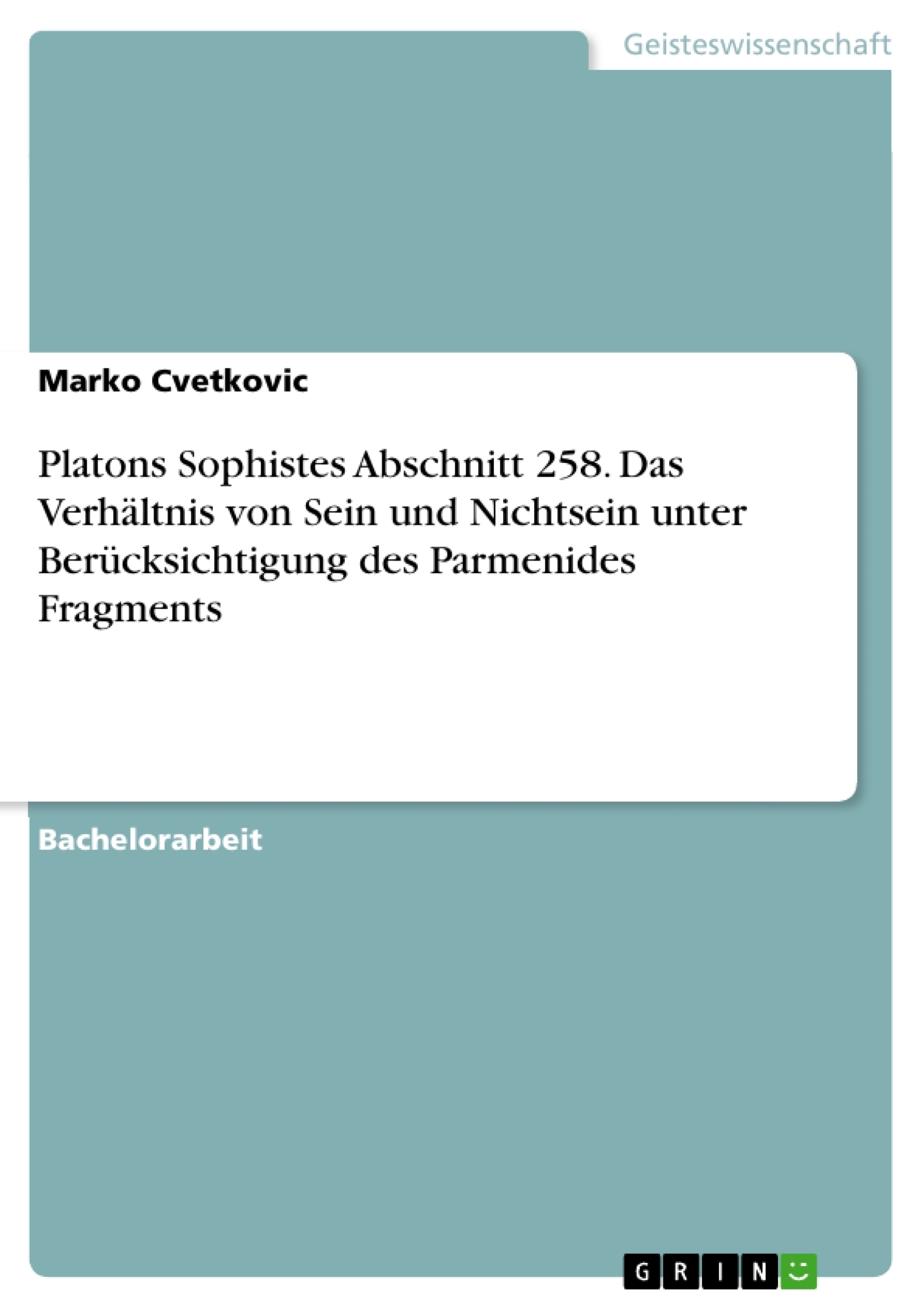Diese Bachelorarbeit handelt von Platons Sophistes Abschnitt 258 und dem Verhältnis von τὸ ὂν und τὸ μὴ ὂν unter Berücksichtigung des Parmenides Fragments. In Abschnitt 258 zeigt der Dialogführer, wie das Nichtseiende und das Seiende gleichermaßen gedacht werden können und wie diese, unter Berücksichtigung der fünf megista gene, miteinander in Verbindung stehen. Folgende Fragen stellen sich, um Abschnitt 258 möglichst genau verstehen zu können und die darauffolgende (mögliche) Verbundenheit zwischen Platon und Parmenides nachvollziehbar zu machen.
Wie kommt es, dass das Nichtseiende genauso am Sein teilhaben kann wie das Seiende selbst und welche Rolle spielen die Begriffe ταὐτόν (dasselbe) und ἔτερον (anderes)? Wie schlussfolgert Platon von der Anteilnahme am Sein der θατέρου ϕύσις (Natur des Anderen), auf den Sophisten selbst und welche Bedeutung hat die Negierung μὴ (nicht-) in diesem Zusammenhang? Inwiefern verstößt der Fremde gegen Parmenides Verbot und wie rechtfertigt er dies? Ist Parmenides Fragment wirklich so zu verstehen, wie Platon es im Sophistes auffasst? Können eventuell terminologische Widersprüche und Überschneidungen, der Grund für die häufige Interpretation sein, Platons und Parmenides Lehre wären nicht (zumindest teilweise) vereinbar?
Inhaltsverzeichnis
- Siglenverzeichnis
- Einleitung: Dem Sophisten auf der Spur.
- Parmenides Verbot
- Die Negation μn (me)
- Die fünf μέуiστα yέvn (megista gene)
- τῆς θατέρου μορίου φύσεως
- Interpretation: Parmenides Fragment.
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht Platons Sophistes und sein Verhältnis zur Lehre des Parmenides. Der Fokus liegt dabei auf dem Abschnitt 258a-e, in dem Platon die Teilhabe des Nichtseienden am Seienden untersucht. Das Ziel der Arbeit ist es, die Argumentation Platons zu analysieren und zu verstehen, wie er mit dem Verbot des Parmenides umzugehen versucht.
- Platons Sophistes und die Lehre des Parmenides
- Das Nichtseiende und seine ontologische Stellung
- Die fünf größten Ideen (µέуiστα yέvŋ)
- Die Beziehung zwischen Sein und Nichtsein
- Die Interpretation von Parmenides Fragment
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einführung bietet einen Überblick über Platons Sophistes und die zentrale Rolle des Nichtseienden in der Argumentation des Dialogs. Sie stellt die Problematik dar, dass der Sophist, obwohl er scheinbar verschiedene Fähigkeiten besitzt, nur einem einzigen Kunstbegriff zugeordnet werden kann.
- Parmenides Verbot: In diesem Kapitel wird das Verbot des Parmenides, dass das Nichtseiende nicht seiend sein kann, eingeführt und seine Bedeutung für Platons Sophistes hervorgehoben.
- Die Negation μn (me): Dieses Kapitel behandelt die Rolle der Negation "nicht" (μn) in Platons Argumentation und ihre Beziehung zum Nichtseienden.
- Die fünf μέуiστα yέvn (megista gene): Die fünf größten Ideen, die von Platon in Sophistes eingeführt werden, werden hier vorgestellt und ihre Bedeutung für die Untersuchung des Nichtseienden erläutert.
- τῆς θατέρου μορίου φύσεως: Die Natur des Anderen (еatέrou Qúσiv) wird in diesem Kapitel diskutiert und ihre Rolle in der Beziehung zwischen Sein und Nichtsein hervorgehoben.
- Interpretation: Parmenides Fragment: Platons Interpretation des Fragments des Parmenides wird in diesem Kapitel analysiert und mögliche Interpretationskonflikte zwischen den beiden Philosophen werden thematisiert.
Schlüsselwörter
Platon, Sophistes, Parmenides, Nichtseiende, Seiende, μέуiστα yέvŋ, τò µǹ ôv, τò öv, Natur des Anderen, Verbot, Interpretation, Philosophie, Antike
Häufig gestellte Fragen
Was thematisiert Platons "Sophistes" in Abschnitt 258?
In diesem Abschnitt untersucht Platon das Verhältnis von Sein und Nichtsein und zeigt auf, wie das Nichtseiende am Sein teilhaben kann.
Was war das Verbot des Parmenides?
Parmenides lehrte, dass man über das Nichtseiende weder denken noch sprechen könne, da es schlichtweg nicht existiere.
Was sind die "megista gene"?
Dies sind die fünf größten Gattungen oder Ideen: Sein, Ruhe, Bewegung, Identität (Dasselbe) und Differenz (Anderes).
Wie definiert Platon das "Nichtseiende" neu?
Er definiert es nicht als das absolute Nichts, sondern als das "Andere" (heteron), wodurch es eine Form von Existenz erhält.
Warum ist diese Untersuchung für den Begriff des Sophisten wichtig?
Nur wenn das Nichtseiende (und damit das Falsche) existieren kann, lässt sich der Sophist als jemand definieren, der Trugbilder und falsche Reden erzeugt.
- Citar trabajo
- Marko Cvetkovic (Autor), 2021, Platons Sophistes Abschnitt 258. Das Verhältnis von Sein und Nichtsein unter Berücksichtigung des Parmenides Fragments, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1152502