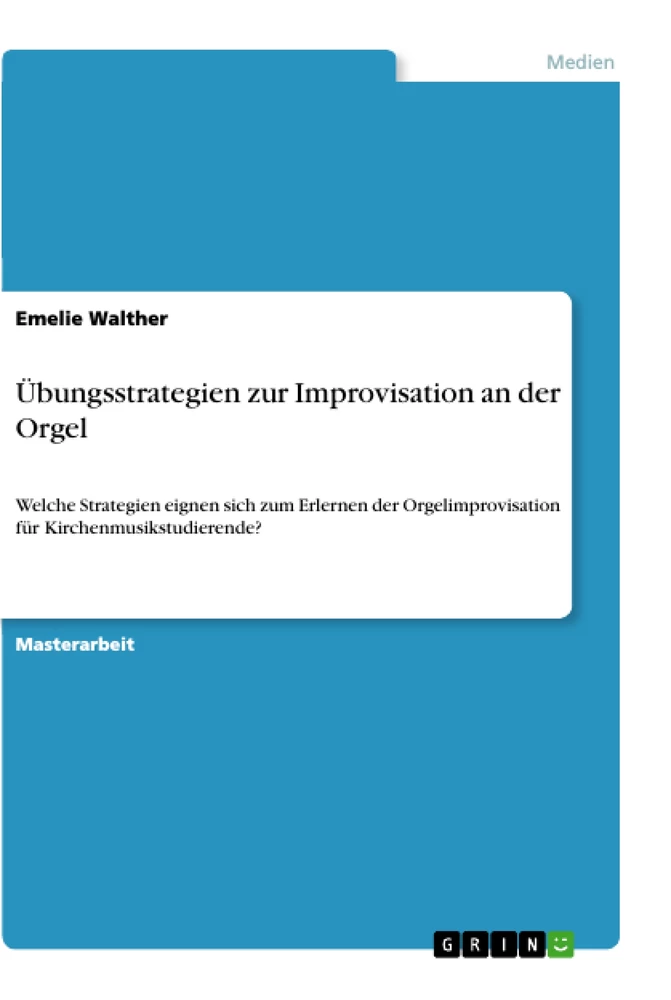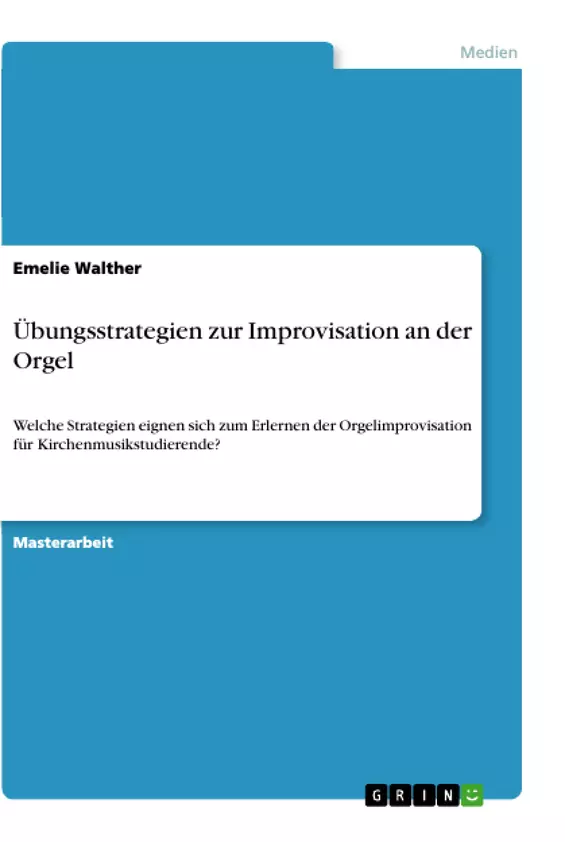Das Üben von Improvisation unterscheidet sich grundsätzlich vom Literaturspiel. Improvisation ist ein individueller, nicht greifbarer und zudem sehr schlecht erklärbarer Prozess. Aber Improvisation ist erlernbar. Das unterstreicht nicht nur die Jahrhunderte alte Tradition der Kirchenmusik, sondern auch eine Fülle an Improvisationsschulen oder -ratgebern und Kompendien aus gleichermaßen Jazz und Klassik. Was diese Ratgeber nicht verraten, ist das Wie des Übens. Wie übe ich eine Kadenz so, dass ich sie auch anwenden kann? Wie finde ich Inspirationen ohne die Hilfe eines Lehrers? Wie erarbeite ich mir stiltypische Harmonien und Formen und vor allem, wie übertrage ich sie auf eigene Ideen?
An diese Fragen soll sich diese Arbeit anschließen. Sie stützt sich dabei auf das im Literaturspiel schon weiter verbreitete Konstrukt der Übestrategien. Solche Strategien sollen dem Übenden helfen, sich aus vermeintlichen Sackgassen zu manövrieren oder gar nicht erst hineinzulaufen. Im Kapitel 2 wird zunächst der Begriff der Improvisation definiert und genauer auf die Charakteristika der (liturgischen) Orgelimprovisation eingegangen. Die Arbeit widmet sich dann zunächst sog. improvisatorischen Kompetenzen, die zum Erlernen der Improvisation notwendig sind, um anschließend empirische Erkenntnisse zum Thema Üben darzustellen. Nachdem im Kapitel 5 Forschungsdesign und -aufbau dieser Arbeit näher beleuchtet wurden, werden im Kapitel 6 die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Forschung dargestellt und anschließend aufeinander bezogen und interpretiert. Schließlich werden aufbauend auf dem wissenschaftlichen Fundament sowie den Erkenntnissen der Forschung im Kapitel 8 konkrete Übestrategien formuliert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff der Improvisation
- Merkmale (liturgischer) Orgelimprovisation
- Die Sonderrolle der Orgelimprovisation
- Improvisatorische Kompetenzen
- Grundsätzliche Überlegungen zu improvisatorischen Kompetenzen
- Instrumentaltechnische Fertigkeiten
- Musiktheoretisches Wissen
- Repertoirekenntnisse
- Kreativität
- Gehör und Höraufmerksamkeit
- Reaktionsvermögen und Interaktion
- Begabung
- Improvisation lernen und üben
- Was ist Üben?
- Parallelen zum Sprachlernen
- Blick in das historische Improvisationslernen
- Übestrategien
- Forschungsdesign
- Forschungsfrage
- Datenerhebung
- Datenanalyse
- Das Dilemma der Intuition
- Untersuchungsergebnisse
- Ergebnisse der quantitativen Umfrage
- Improvisatorische Vorerfahrungen
- Selbsteinschätzung und Mindset
- Unterricht in Improvisation bzw. Liturgisch Orgel
- Üben von Improvisation
- Zusammenfassung
- Ergebnisse der qualitativen Experteninterviews
- Übungstypen
- Umsetzung auf die Tasten – die Grundvoraussetzung
- Emotion
- Kreativität
- Ergebnisse der quantitativen Umfrage
- Interpretation der Forschungsergebnisse
- Übungstypen
- Umsetzung auf die Tasten
- Lernziele
- Technische Aspekte
- Emotion und Mindset
- Kreativität und Inspiration
- Konkrete Übestrategien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Thematik des Erlernens der Orgelimprovisation, speziell für Kirchenmusikstudierende. Sie analysiert die Herausforderungen, die mit der Entwicklung improvisatorischer Fähigkeiten verbunden sind, und untersucht effektive Übestrategien, die das Erlernen und die Weiterentwicklung der improvisatorischen Kompetenz unterstützen.
- Die spezifischen Anforderungen der Orgelimprovisation im Kontext der Kirchenmusik
- Die Bedeutung und Rolle von improvisatorischen Kompetenzen
- Empirische Erkenntnisse über die Praxis des Improvisationslernens
- Die Entwicklung und Anwendung effektiver Übestrategien für die Orgelimprovisation
- Die Rolle von Kreativität, Emotion und Intuition im improvisatorischen Prozess
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Orgelimprovisation ein und skizziert die Problemstellung, die in dieser Arbeit untersucht wird. Es werden typische Erfahrungen und Herausforderungen beim Erlernen der Improvisation, insbesondere für Kirchenmusikstudierende, beleuchtet.
- Zum Begriff der Improvisation: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Improvisation" und untersucht die spezifischen Merkmale der Orgelimprovisation im Kontext der Liturgie.
- Improvisatorische Kompetenzen: Hier werden die wichtigsten Kompetenzen und Fähigkeiten analysiert, die für das Erlernen der Improvisation erforderlich sind. Die Kapitel befasst sich mit Themen wie Instrumentaltechnik, Musiktheorie, Repertoirekenntnissen, Kreativität, Gehör, Reaktionsvermögen und Begabung.
- Improvisation lernen und üben: In diesem Kapitel werden grundlegende Aspekte des Übens im Kontext der Improvisation beleuchtet. Es werden Parallelen zum Sprachlernen gezogen und die historische Entwicklung des Improvisationslernens betrachtet. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse und Erläuterung verschiedener Übestrategien.
- Forschungsdesign: Dieses Kapitel beschreibt das Forschungsdesign der Arbeit. Es werden die Forschungsfrage, die Datenerhebungsmethoden, die Datenanalyse sowie das grundlegende Konzept der Arbeit vorgestellt.
- Untersuchungsergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Forschung präsentiert. Die Ergebnisse sowohl der quantitativen Umfrage als auch der qualitativen Experteninterviews werden dargestellt und analysiert.
- Interpretation der Forschungsergebnisse: Die gewonnenen Erkenntnisse aus der quantitativen und qualitativen Forschung werden in diesem Kapitel interpretiert. Es werden Schlussfolgerungen gezogen, die sich auf die Praxis des Improvisationslernens beziehen.
Schlüsselwörter
Orgelimprovisation, Kirchenmusik, Übestrategien, improvisatorische Kompetenzen, Kreativität, Emotion, Lernprozess, Forschungsdesign, qualitative und quantitative Forschung, Musiktheorie, Instrumentaltechnik, Liturgie, Repertoire, Experteninterviews, Umfrage, empirische Datenanalyse.
- Citar trabajo
- Musikpädagogin, Kirchenmusikerin Emelie Walther (Autor), 2021, Übungsstrategien zur Improvisation an der Orgel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1152592